Die Ukraine Zwischen Ost Und West
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Page 1 (1/31/20) Waltz in E-Flat Major, Op. 19 FRÉDÉRIC CHOPIN
Page 1 (1/31/20) Waltz in E-flat major, Op. 19 FRÉDÉRIC CHOPIN (1810-1849) Composed in 1831. Chopin’s Waltz in E-flat major, Op. 18, his first published specimen of the genre and one of his most beloved, was composed in 1831, when he was living anxiously in Vienna, almost unknown as a composer and only slightly appreciated as a pianist. In 1834, he sold it to the Parisian publisher Pleyel to finance his trip with Ferdinand Hiller to the Lower Rhineland Music Festival at Aachen, where Hiller introduced him to his long-time friend Felix Mendelssohn. The piece was dedicated upon its publication to Mlle. Laura Horsford, one of two sisters Chopin then counted among his aristocratic pupils. (Sister Emma had received the dedication of the Variations on “Je vends des scapulaires” from Hérold’s Ludovic, Op. 12 the year before.) The Waltz in E-flat follows the characteristic Viennese form of a continuous series of sixteen- measure strains filled with both new and repeated melodies that are capped by a vigorous coda. Ballade No. 1 in G minor, Op. 23 FRÉDÉRIC CHOPIN Composed 1831. In the Ballades, “Chopin reaches his full stature as the unapproachable genius of the pianoforte,” according to Arthur Hedley, “a master of rich and subtle harmony and, above all, a poet — one of those whose vision transcends the confines of nation and epoch, and whose mission it is to share with the world some of the beauty that is revealed to them alone.” Though the Ballades came to form a nicely cohesive set unified by their temporal scale, structural fluidity and supranational idiom, Chopin composed them over a period of more than a decade. -

Liszt and Christus: Reactionary Romanticism
LISZT AND CHRISTUS: REACTIONARY ROMANTICISM A Dissertation Submitted to the Temple University Graduate Board In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree DOCTOR OF PHILOSOPHY by Robert Pegg May 2020 Examining Committee Members: Dr. Maurice Wright, Advisory Chair, Music Studies Dr. Michael Klein, Music Studies Dr. Paul Rardin, Choral Activities Dr. Christine Anderson, Voice and Opera, external member © Copyright 2020 by Robert Pegg All Rights Reserved € ii ABSTRACT This dissertation seeks to examine the historical context of Franz Lizt’s oratorio Christus and explore its obscurity. Chapter 1 makes note of the much greater familiarity of other choral works of the Romantic period, and observes critics’ and scholars’ recognition (or lack thereof) of Liszt’s religiosity. Chapter 2 discusses Liszt’s father Adam, his religious and musical experiences, and his influence on the young Franz. Chapter 3 explores Liszt’s early adulthood in Paris, particularly with respect to his intellectual growth. Special attention is given to François-René, vicomte de Chateaubriand and the Abbé Félicité de Lamennais, and the latter’s papal condemnation. After Chapter 4 briefly chronicles Liszt’s artistic achievements in Weimar and its ramifications for the rest of his work, Chapter 5 examines theological trends in the nineteenth century, as exemplified by David Friedrich Strauss, and the Catholic Church’s rejection of such novelties. The writings of Charles Rosen aid in decribing the possible musical ramifications of modern theology. Chapter 6 takes stock of the movements for renewal in Catholic music, especially the work of Prosper Gueranger and his fellow Benedictine monks of Solesmes, France, and of the Society of Saint Cecilia in Germany. -

Boston Symphony Orchestra Concert Programs, Season 39,1919
ACADEMY OF MUSIC . PHILADELPHIA Monday Evening, January 5, at 8.15 *'.. 1% "v V Mly$fr BOSTON ^wd -^ SYMPHONY ORCHESTRA INCORPORATED THIRTY-NINTH SEASON J9J9-J920 / ',i V ll |U«.,....,|.U PRSQRsnnc THIS IMSTBUMEINIT ©F QUALITY SlOJXOtir CL6AB AS A ©5'I~L " TZ^ Highest Class Talking Machine in the World" Josef Hofmann says: "The Orchestra is the greatest MUSICAL MEDIUM and stimu- lus of the Community." The Talking Machine is the only Musical Instrument that brings the orchestra into the home 1311 WALNUT STREET PHILADELPHIA ACADEMY OF MUSIC, PHILADELPHIA Thirty-fifth Season in Philadelphia INCORPORATED Thirty-ninth Season, 1919-1920 PIERRE MONTEUX, Conductor WITH HISTORICAL AND DESCRIPTIVE NOTES BY PHILIP HALE MONDAY EVENING, JANUARY 5 AT 8.15 COPYRIGHT, 1920, BY BOSTON SYMPHONY ORCHESTRA, INCORPORATED W. H. BRENNAN, Manager G. E. JUDD, Assistant Manager — ww% I 1 Xl p <m* A name that is spoken with the full pride of ownership—that carries with it the deep satis- faction of possessing the ultimate expression of man's handiwork in Musical Art. A name that is cherished as a Family Tradition that keeps afresh for the next generation the associations and fond remembrances which cluster around the home piano. Supreme achievement of patience, skill and ex- perience, founded on inborn Ideals of Artistry. vmp i mmm iJPs f Catalogue and prices on application Sold on convenient payments Old pianos taken in exchange Inspection invited 107-109 East 14th Street New York Subway Express Stations at the Door REPRESENTED BY THE FOREMOST DEALERS EVERYWHERE Thirty-ninth Season, 1919-1920 PIERRE MONTEUX, Conductor Violins. -
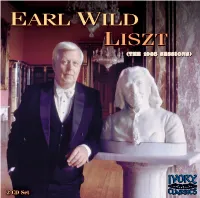
72001 for PDF 11/05
EARL WILD LISZT THE 1985 SESSIONS DISC 1 From “Années de Pèlerinage” Second Year: Italy (S161/R10b) 1 Après une lecture du Dante (Fantasia quasi Sonata) 15:58 [“Dante Sonata”] (Andante maestoso - Presto agitato assai - Tempo I (Andante) - Andante (quasi improvvisato) - Andante - Recitativo - Adagio - Allegro moderato - Più mosso - Tempo rubato e molto ritenuto - Andante - Più mosso - Allegro - Allegro vivace - Presto - Andante (Tempo I)) 2 Sonetto 47 del Petrarca 6:20 (Preludio con moto - Sempre mosso con intimo sentimento) 3 Sonetto 104 del Petrarca 6:31 (Agitato assai - Adagio - Agitato) 4 Sonetto 123 del Petrarca 7:04 (Lento placido - Sempre lento - Più lento - (Tempo iniziale)) From “Années de Pèlerinage” Third Year (S163/R10e) 5 Les jeux d’eau à la Villa d’Este 7:41 (Fountains of the Villa d’Este) (Allegretto) 6 Ballade No.2 in B minor (S171/R16) 13:59 (Allegro moderato - Lento assai - Tempo I - Lento assai - Allegretto - Allegro deciso - Allegretto - Allegretto sempre legato - Allegro moderato - Un poco più mosso - Andantino) From “Liebesträume, 3 Notturnos” (S541/R211) 7 Liebesträume (Notturno) No.2 in E flat Major (2nd Version) 4:27 (“Seliger Tod”) (Quasi lento, abbandonandosi) 8 Liebesträume (Notturno) No.3 in A flat Major 4:26 (“O lieb, so lang du lieben kannst!”) (Poco allegro, con affetto) 9 Concert Étude No.3 in D flat Major (“Un Sospiro”) (S144/R5) 5:14 (Allegro affettuoso) Total Playing Time : 72:16 – 2 – DISC 2 Bach/Liszt: Fantasia and Fugue in G minor (S463/R120) 11:12 1 Fantasia (Grave) 5:49 2 Fugue (Allegro) 5:23 Sonata -

Boston Symphony Orchestra Concert Programs, Season
NEW NATIONAL THEATRE, WASHINGTON Twenty-sixth Season, J90^-J907 DR. KARL MUCK, Conductor programme of % Fifth and Last Matinee WITH HISTORICAL AND DESCRIP- TIVE NOTES BY PHILIP HALE TUESDAY AFTERNOON, MARCH 19 AT 4.30 PRECISELY PUBLISHED BY C. A. ELLIS, MANAGER 08SIP GABRILOWITSCH the Russian Pianist will play in America this season with the Principal Orchestras, the Kneisel Quartet, the Boston Symphony Quartet, Leading Musical Organizations throughout the country, and in Recital GABRILOWITSCH will play only the ifaun&ife PIANO ifejm&ifaittlhtdk Boston New York For particulars, terms, and dates of Gabrilowitsch, address HENRY L. MASON 492 Boylston Street, Boston 2 Boston Symphony Orchestra PERSONNEL TWENTY-SIXTH SEASON, 1906-1907 Dr. KARL MUCK, Conductor Willy Hess, ConcertmeisUr> and the Members of the Orchestra in alphabetical order. Adamowski, J. Hampe, C. Moldauer, A. Adamowski, T. Heberlein, H. Mullaly, J. Akeroyd, J. Heindl, A. Muller, F. Heindl, H. Bak, A. Helleberg, J. Nagel, R. Bareither, G. Hess, M. Nast, L. Barleben, C. Hoffmann, J. Barth, C. Hoyer, H. Phair, J. Berger, H. Bower, H. Keller, J. Regestein, E» Brenton, H. Keller, K. Rettberg, A. Brooke, A. Kenfield, L. Rissland, K. Burkhardt, H. Kloepfel, L. Roth, O. Butler, H. Kluge, M. Kolster, A. Sadoni, P. Currier, F. Krafft, W. Sauer, G. Debuchy, A. Krauss, H. Sauerquell, J. Kuntz, A. Sautet, A. Dworak, J. Kuntz, D. Schuchmann, F. Eichheim, H. Kunze, M. Schuecker, H. Eichler, J. Kurth, R. Schumann, C. Elkind, S. Schurig, R. Lenom, C. Senia, T. Ferir E. Loeffler, E. Seydel, T. Fiedler, B. Longy, G. Sokoloff, N. Fiedler, E. Lorbeer, H. -

Franz Liszt: the Ons Ata in B Minor As Spiritual Autobiography Jonathan David Keener James Madison University
James Madison University JMU Scholarly Commons Dissertations The Graduate School Spring 2011 Franz Liszt: The onS ata in B Minor as spiritual autobiography Jonathan David Keener James Madison University Follow this and additional works at: https://commons.lib.jmu.edu/diss201019 Part of the Music Commons, Religious Thought, Theology and Philosophy of Religion Commons, and the Social and Behavioral Sciences Commons Recommended Citation Keener, Jonathan David, "Franz Liszt: The onS ata in B Minor as spiritual autobiography" (2011). Dissertations. 168. https://commons.lib.jmu.edu/diss201019/168 This Dissertation is brought to you for free and open access by the The Graduate School at JMU Scholarly Commons. It has been accepted for inclusion in Dissertations by an authorized administrator of JMU Scholarly Commons. For more information, please contact [email protected]. Franz Liszt: The Sonata in B Minor as Spiritual Autobiography Jonathan David Keener A document submitted to the Graduate Faculty of JAMES MADISON UNIVERSITY In Partial Fulfillment of the Requirements For the degree of Doctor of Musical Arts School of Music May 2011 Table of Contents List of Examples………………………………………………………………………………………….………iii Abstract……………………………………………………………………………………………………………….v Introduction and Background….……………………………………………………………………………1 Form Considerations and Thematic Transformation in the Sonata…..……………………..6 Schumann’s Fantasie and Alkan’s Grande Sonate…………………………………………………14 The Legend of Faust……………………………………………………………………………………...……21 Liszt and the Church…………………………………………………………………………..………………28 -

Boston Symphony Orchestra Concert Programs, Season 39,1919
NEW NATIONAL THEATRE . WASHINGTON Tuesday Afternoon, January 6, at 4.30 N :^ mm^-, W uW % BOSTON %y\\i iv^ SYAPHONY ORCHESTRA INCORPORATED THIRTY NINTH SEASON W9-J920 PRSGRSttME UPRIGHT PIANOS GRAND PIANOS THE CHICKERING-AMPICO REPRODUCING PIANOS play the interpretations of the world's foremost pianists—tone for tone, phrase for phrase—the exact duplication of the artists' own renditions from actual recordings. UPRIGHT AND GRAND STYLES ARTHUR JORDAN PIANO CO. 1239 G ST., Cor. 13th WASHINGTON, D. C. HOMER L. KITT. Sec'y-Treas. NEW NATIONAL THEATRE WASHINGTON INCORPORATED Thirty-ninth Season. 1919-1920 PIERRE MONTEUX, Conductor WITH HISTORICAL AND DESCRIPTIVE NOTES BY PHILIP HALE TUESDAY AFTERNOON, JANUARY 6 AT 4.30 COPYRIGHT, 1920, BY BOSTONSSYMPHONY ORCHESTRA, INCORPORATED W. H. BRENNAN, Manager G. E. JUDD, Assistant Manager — A name that is spoken with the full pride of ownership—that carries with it the deep satis- faction of possessing the ultimate expression of man's handiwork in Musical Art. A name that is cherished as a Family Tradition that keeps afresh for the next generation the associations and fond remembrances which cluster around the home piano. Supreme achievement of patience, skill and ex- perience, founded on inborn Ideals of Artistry. mp <m If 1 £ Jft Catalogue and prices on application Sold on convenient payments Old pianos taken in exchange Inspection invited STE» 107-109 East 14th Street New York Subway Express Stations at the Door REPRESENTED BY THE FOREMOST DEALERS EVERYWHERE Thirty-ninth Season, 1919-1920 PIERRE MONTEUX, Conductor Violins. Fradkin, F. Roth, 0. Rissland, K. Mahn, F. Concert-master. -

A Study of the Personality of Franz Liszt with Special
· ~ I (; A STUDY OF THE PERSONALITY OF FRANZ LISZT WITH SPECIAL REFERENCE TO THE CONTRADICTIONS IN HIS NATURE Submitted for the Degree of MASTER OF MUSIC Rhodes University by BERYL EILEEN ENSOR-SMITH January 1984 (ii} CONTENTS Chapter I Background Page 1 CAREER CONFLICTS Chapter II Pianist/Composer Page 17 Chapter III Showman/Serious Musician Page 33 PERSONALITY CONFLICTS Chapter IV Ambiguity in Liszt's Relationships - Personal and Spiritual Page 77 Chapter V Finally- Resignation ... Dogged Perseverance . .. Hopeful Optimism Page 116 ----oooOooo---- (iii) ILLUSTRATIONS Liszt, the Child At the end of Chapter I Liszt, the Young Man At the end of Chapter II Liszt, the performer At the end of Chapter III Liszt, Strength or Arrogance? At the end of Chapter IV L'Abbe Liszt Liszt, Growing Older Liszt, the Old Man At the end of Chapter V Liszt, from the last photographs Liszt . .. The End ----oooOooo---- A STUDY OF THE PERSONALITY OF FRANZ LISZT WITH SPECIAL r~FERENCE TO THE CONTRADICTIONS IN HIS NATURE Chapter I BACKGROUND "The man who appears unable to find peace there can be no doubt that we have here to deal with the extraordinary, multiply-moved mind as well as with a mind influencing others. His own life is to be found in his music." (Robert Schumann 19.4) Even the birth of Franz Liszt was one of duality - he was a child of the borderline between Austria and Hungary. His birthplace, even though near Vienna, was on the confines of the civilized world and not far removed from the dominions of the Turk. -

LIS T IMAGINATION Mephisto Walzer on String
LIS T IMAGINATION Mephisto Walzer on String Transcriptions and Composition by André Parfenov for Violin and Piano Parfenov Duo Iuliana Münch, violin André Parfenov, piano Franz LISZT (1811–1886) Bearbeitungen und Komposition von André Parfenov für Violine und Klavier – Transcriptions and Composition by André Parfenov for Violin and Piano 1 Mephisto-Walzer No. II (R 182, SW/SH 515, NG 2 A 288) 13:40 2 Bagatelle ohne Tonart (Mephisto-Walzer No. IV, R 60, SW/SH 216a, NG A338) 3:29 3 Mephisto-Walzer No. III (R38, SW/SH 216, NG2 A 325) 8:26 4 Mephisto-Polka (R 39, SW/SH 217, NG2 A317) 4:31 5 Mephisto-Walzer No. I (R 181, SW/SH 514, NG2 A 189) 14:39 André Parfenov 6 Mephisto-Zugabe frei nach einem Thema von dem vierten Mephisto-Walzer von F. Liszt 8:27 Total Time: 53:15 Parfenov Duo Iuliana Münch, (Violine | violin) André Parfenov, (Klavier | piano) 8.551445 2 Gewidmet meinen Eltern, Michael Parfenov und Vera Werke anderer Komponisten für das Klavier bearbeitet Luzius wie zum Beispiel die Sinfonien Beethovens. Die Vorwort des Komponisten und Pianisten langen expressiven Passagen und melodischen Kurven der Streichinstrumente werden zu Tremoli Franz Liszt war Mitte 40, als er seinen ersten Mephisto- oder begleitenden Figurationen. Liszt hat also das Walzer komponierte. Grundlage war hier nicht das musikalische Material aus den Möglichkeiten des berühmte Drama von Goethe, sondern eine Szene Klaviers heraus neu gedacht. aus dem „Faust“ von Nikolaus Lenau. Während einer Genau das habe ich nun für die Violine getan. Hochzeit in einer Dorfschänke nimmt sich Mephisto die Es geht darum, den Geiste von Liszts Werken zu Violine eines Musikers und stimmt sie zunächst, was erhalten und sie mit der speziellen Klangfarbe und den Liszt mit lautmalerischen Quinten darstellt. -

December 1971
• • Wl m zn 1 First City takes great pride in its totally wide travel, cultural and h4fstorical tours, new concept in banking. The First Citian and exclusive investment and estate Program, built around the First Citian management seminars. In addition/ they Income Certificate, features an exclusive receive special First Citians invitations to combination of benefits never before symphony concerts, theatre presentations offered by a bank. and evenings of gourmet dining. First Citians receive interest on their Join First Citians and wear our ~~Symbol savings paid monthly, like income, while of Pride." enjoying social activities such as world First City National Bank now pays the highest interest rate allowed by law on all savings instruments: Regular Savings .......... 4% % Investor Savings . 5% Savings Time Certificates 6months ..... 5% 1 year ........ 5%% 2years .. .' .... 5%% M19mber F.O,LC. Call today for our new brochure ... 229-6616 - or write itians 1001 Main Street, Houston, Texas 77002. providing the vitd ·nK between hPJ and the fine arts. SOUTHWEST ART GAllERY MAGAZINE concerns itself with art news and events here in the Southwest. SOUTHWEST ART GAllERY MAGAZINE communicates between _the museums, galleries, and the public. If Southwest Art Gallery Magazine is for you, use this coupon to enter your subscription. Dear Subscription Department: Please enter my subscription for one year at $10.00. Name····-···-···---··------------····------·--······---------·---------·······-------------·-··-···----·-··· Address···············--·-····-------··--------·······------------------·--···········-····················- City ..................................State ••••••••••••••••••••••••••••••••. Zip-~---··········--·-····----- 0 Payment Enclosed 0 Bill Me Above rates apply to U.S., A.P.O., and F .P.O. addresses only. Canada add $1.00 per year. THE BEST ASKOURH 94.5 FM STEREO 100,000 watts of the world's greatest music in high fidelity stereophonic sound. -
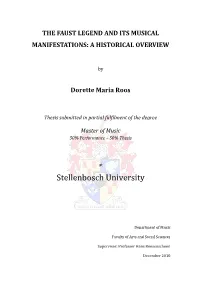
Final Thesis Dorette Roos
THE FAUST LEGEND A ND ITS MUSICAL MANIFEST ATIONS : A HISTORICAL OVERVIEW by Dorette Maria Roos Thesis su bmitted in partial fulfilment of the degree Master of Music 50% Performance – 50% Thesis at Stellenbosch University Department of Music Faculty of Arts and Social Sciences Supervisor: Professor Hans Roosenschoon December 2010 Declaration I, the undersigned, hereby declare that the work contained in this thesis is my own original work and that I have not previously in its entirety or in part, submitted it at any university for a degree. D.M. Roos _____________________________________ Signature Dorette Maria Roos Student Number 15491668 01 / 09 / 2010 Copyright © 2010 Stellenbosch University All rights reserved 2 Acknowledgements I would like to express my gratitude to my supervisor, Professor Hans Roosenschoon, for his guidance, mentorship and encouragement throughout this study. A particular acknowledgement is extended to Miss Esmeralda Tarentaal in the Stellenbosch Music Library for her help and skills. I would like to express my sincere appreciation to my family for their motivation and assistance with this thesis – not forgetting their continuous love, inspiration, proof- reading and suggestions. Lastly, a special word of thanks to my friend Babette, for her constant positivity and enthusiasm. 3 Abstract This thesis explores the Faust legend and its musical manifestations since the 19 th century. The objective is to provide a thorough background to the legend, before drawing up an account of compositions inspired by the Faust legend. Firstly, the origin of the legend is investigated, followed by a brief summary of the most important literary works on the subject of Faust . -

Boston Symphony Orchestra Concert Programs, Season 39,1919
CITY AUDITORIUM . SPRINGFIELD Sunday Afternoon, January 11, at 3.00 **i BOSTON SYAPHONY ORCHESTRA INCORPORATED THIRTY-NINTH SEASON J9J9-J920 PR3GRHAME AUSPICES OF SPRINGFIELD Y.M.C.A. x.r- Just as you enjoy the exquisite interpre- tations of the Boston Symphony Orchestra at their concert, you can enjoy them when- ever you wish on the Victrola. It is one of the great triumphs of record- ing that enables you to hear so large an organization in your home, and it is sig- nificant that so famous an orchestra as the Boston Symphony makes Victor Records. The absolute faithfulness of these Victor Records when played on the Victrola parallels the actual performance of this great orchestra itself. Any Victor dealer will gladly play any of the Boston Symphony Orchestra records for you. Victrolas $25.00 to $950. CAMDEN, N. J. HIS MASTERS VOICE" 1 CITY AUDITORIUM SPRINGFIELD INCORPORATED Thirty-ninth Season, 1919-1920 PIERRE MONTEUX, Conductor WITH HISTORICAL AND DESCRIPTIVE NOTES BY PHILIP HALE SUNDAY AFTERNOON, JANUARY 1 AT 3.00 COPYRIGHT, 1920, BY BOSTON SYMPHONY ORCHESTRA, INCORPORATED W. H. BRENNAN, Manager G. E. JUDD, Assistant Manager — A name that is spoken with the full pride of ownership—that carries with it the deep satis- faction of possessing the ultimate expression of man's handiwork in Musical Art. A name that is cherished as a Family Tradition that keeps afresh for the next generation the associations and fond remembrances which cluster around the home piano. Supreme achievement of patience, skill and ex- perience, founded on inborn Ideals of Artistry. Catalogue and prices on application Sold on convenient payments Old pianos taken in exchange Inspection invited 107-109 East 14th Street New York Subway Express Stations at the Door REPRESENTED BY THE FOREMOST DEALERS EVERYWHERE Thirty-ninth Season, 1919-1920 PIERRE MONTEUX, Conductor Violins.