Festuca Spp.): Naturnahe Begrünung Oder Florenverfälschung?
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Vascular Plants of Massachusetts
The Vascular Plants of Massachusetts: The Vascular Plants of Massachusetts: A County Checklist • First Revision Melissa Dow Cullina, Bryan Connolly, Bruce Sorrie and Paul Somers Somers Bruce Sorrie and Paul Connolly, Bryan Cullina, Melissa Dow Revision • First A County Checklist Plants of Massachusetts: Vascular The A County Checklist First Revision Melissa Dow Cullina, Bryan Connolly, Bruce Sorrie and Paul Somers Massachusetts Natural Heritage & Endangered Species Program Massachusetts Division of Fisheries and Wildlife Natural Heritage & Endangered Species Program The Natural Heritage & Endangered Species Program (NHESP), part of the Massachusetts Division of Fisheries and Wildlife, is one of the programs forming the Natural Heritage network. NHESP is responsible for the conservation and protection of hundreds of species that are not hunted, fished, trapped, or commercially harvested in the state. The Program's highest priority is protecting the 176 species of vertebrate and invertebrate animals and 259 species of native plants that are officially listed as Endangered, Threatened or of Special Concern in Massachusetts. Endangered species conservation in Massachusetts depends on you! A major source of funding for the protection of rare and endangered species comes from voluntary donations on state income tax forms. Contributions go to the Natural Heritage & Endangered Species Fund, which provides a portion of the operating budget for the Natural Heritage & Endangered Species Program. NHESP protects rare species through biological inventory, -

1 Anleitung Für Die Geographische Artendatenbank Nachdem Sie Die
Anleitung für die geographische Artendatenbank Nachdem Sie die Anwendung gestartet haben, können Sie mit den entsprechenden Werkzeugen zur gewünschten geographischen Lage finden. Im linken Auswahlmenü wählen Sie bitte "Artenfunde digitalisieren". Mit dem Button können Sie einen Punkt in die Karte setzen. Bitte beachten Sie unbedingt, dass bevor ein Punkt gesetzt wird alles geladen ist. Es müssen ungefähr 1,4 MB (Artenliste mit ca. 19.000 Arten) geladen werden. Links erscheint dann ein Disketten Symbol . Nach klick auf das Symbol erscheint ein Fenster, in dem die erforderlichen Angaben einzutragen sind. Die Felder bis „Ort des Fundes“ sind Pflichtfelder, hier müssen unbedingt Eingaben gemacht werden. 1 Die Eingabe über Autor und E-Mail des Autors sowie Bemerkungen sollten ebenso eingegeben werden. Diese Angaben werden in der Datenbank gespeichert, jedoch nicht veröffentlicht. Diese Angaben dienen intern dazu, die Wertigkeit der Eingaben beurteilen zu können. Es stehen z.B. beim "Artenname" Pulldown-Listen zur Verfügung, dadurch wird eine einheitliche Eingabe garantiert. Es stehen ca. 19.000 Arten zur Verfügung. Sollte es für eine Art keinen deutschen Namen geben, steht der wissenschaftliche Name zur Verfügung. Die Liste ist alphabetisch sortiert. Außerdem werden in der Liste keine ü,ö,ä und ß verwendet. Die Namen werden mit Umlauten geschrieben. Die vollständige Liste finden Sie im Anhang zu dieser Anleitung. Das Datum ist im Format JJJJ-MM-TT (z.B. 2012-01-27) einzugeben. Das wäre der 27. Januar 2012. Beenden Sie alle Eingaben durch drücken auf "Speichern". Während Ihrer aktuellen Internetsitzung haben Sie die Möglichkeit mit dem Button die Eingabe des Datensatzes wieder aus der Datenbank zu löschen. -

Syntaxonomická Klasifikácia a Ekologická Charakteristika Xerotermných Rastlinných Spoločenstiev V Západokarpatsko-Panónskom Regióne
Syntaxonomická klasifikácia a ekologická charakteristika xerotermných rastlinných spoločenstiev v západokarpatsko-panónskom regióne Dizerta čná práca RNDr. Daniela Dúbravková rod. Michálková Slovenská akadémia vied v Bratislave Botanický ústav Oddelenie geobotaniky Školiteľ: RNDr. Mária Zaliberová, CSc. Konzultant: doc. RNDr. Jiří Kolbek, CSc., DSc. Stupeň odbornej kvalifikácie: philosophiae doctor Bratislava 2010 ZADÁVACÍ LIST DIZERTAČNEJ PRÁCE Školiace pracovisko: Botanický ústav Slovenskej akadémie vied v Bratislave Meno a priezvisko doktoranda: Daniela Dúbravková Číslo a názov študijného odboru (-ov): 15-07-9 Botanika Názov študijného programu: Botanika Školiteľ doktoranda: RNDr. Mária Zaliberová, CSc. Pracovisko, na ktorom doktorand vykonáva doktorandské štúdium: Botanický ústav SAV Dátum nástupu na štúdium: 2. 9. 2004 Doktorandské štúdium a vypracovanie dizertačnej práce je viazané na projekt (-y): APVT-51-015804, VEGA 2/5084/25, VEGA 2/0181/09, projekt SK0115 „Manažmentové modely pre travinné biotopy“, ktorý je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky Názov dizertačnej práce: Syntaxonomická klasifikácia a ekologická charakteristika xerotermných rastlinných spoločenstiev v západokarpatsko-panónskom regióne Cieľ práce: 1) Skompletizovať a digitalizovať staršie fytocenologické zápisy xerotermnej vegetácie Slovenska z existujúcich publikovaných a nepublikovaných prác a uložiť ich do Slovenskej národnej fytocenologickej databázy pre potreby ich použitia -

I. Festuca Sect. Eskia Willk. (Poaceae)
INFORMATORE BOTANICO ITALIANO, 39 (1) 199-232, 2007 199 Contributi per la realizzazione della Flora critica d’Italia Il genere Festuca e i generi affini per la nuova “Flora critica d’Italia”. I. Festuca sect. Eskia Willk. (Poaceae) B. FOGGI, G. ROSSI, G. PAROLO e C. WALLOSSEK ABSTRACT - The Genus Festuca, and allied genera, for the new “Flora critica d’Italia”. I. Festuca sect. Eskia Willk. (Poaceae) - A review of the knowledge on the genus Festuca sect. Eskia in Italy is presented. Eleven species are treated. Two new taxo- nomical combinations (F. luedii and F. winnebachensis) are published. For each species the complete description, the ploidy level, the distribution in the Italian provinces and the ecology are reported. New illustrations are published. Finally a new determination key, based on specimens collected in Italy, is presented. One species (Festuca varia) has been deleted from the Italian flora. Key words: chorology, determination key, ecology, Festuca sect. Eskia, new combinations Ricevuto il 19 Aprile 2007 Accettato il 20 Aprile 2007 INTRODUZIONE WILLKOMM (1861) descrive la sect. Eskia basandosi CONERT (1996) considera la sect. Eskia compren- su alcune specie della flora iberica caratterizzate dalla dente, oltre alle specie generalmente riunite nel grup- presenza di ligule evidenti e dalla palea e lemma con po “varia”, anche alcune specie a foglie larghe come margini scariosi più o meno sviluppati. La sect. Eskia F. laxa Host, F. spectabilis Bertol., F. pulchella Willk. può essere considerata un gruppo omogeneo Schrader; queste tre specie, che HACKEL (1882) di specie appartenenti al subgen. Festuca e poste, da riunisce nella sect. -

Bakalářská Práce
Přírodov ědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Katedra botaniky BAKALÁ ŘSKÁ PRÁCE Pavla K řížková Srovnání morfologie p říčných řez ů listy travin Vedoucí práce: RNDr.Radim J.Vašut, Ph.D. obor : Biologie – geologie a ochrana životního prost ředí místo a datum odevzdání : v Olomouci dne 26. 6. 2013 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalá řskou práci zpracovala samostatn ě a že jsem uvedla všechny použité informa ční zdroje. V Olomouci dne 26. 6. 2013 ………………………………. Pavla K řížková Pod ěkování Na tomto míst ě bych cht ěla pod ěkovat vedoucímu práce RNDr. Radimu J. Vašutovi Ph.D., za vedení bakalá řské práce, vst řícnost, poskytnutí materiálu a cenných rad, za čas věnovaný na konzulta čních hodinách. Dále bych cht ěla pod ěkovat Mgr. Zuzan ě Trojanové, za ochotu pomoci p ři práci s mikroskopem. BIBLIOGRAFICKÁ IDENTIFIKACE Jméno a p říjmení: Pavla K řížková Název práce: Srovnání morfologie p říčných řez ů listy travin (vybraní zástupci čeledi Poaceaea a Cyperaceae) Typ práce: Bakalá řská práce Pracovišt ě: Katedra botaniky Vedoucí práce: RNDr. Radim J. Vašut, Ph.D. Rok obhajoby práce: 2013 Abstrakt Práce má za úkol p řiblížit čtená ři vybrané druhy úzkolistých trav z čeledi Poaceae (lipnicovité), jejich význam v přírod ě, postavení trav v systému rostlin. V práci jsem vybrané druhy trav odlišila na základ ě rozdílné morfologie. Stru čné morfologické popisy jednotlivých druh ů jsem doplnila mikrofotografiemi p říčných řez ů částmi vegetativních orgán ů trav - list ů a obrázky, které napomáhají k lepšímu ur čení jednotlivých druh ů. Má práce by m ěla poukázat na to, že ur čování není vždy jednozna čné a snadné, zejména u rodu kost řav. -
![And Rush (Juncaceae) Specimens from Johannes Scheuchzer's Collection at the Herbarium of Natural History Museum Vienna [W] 121- 141 Ann](https://docslib.b-cdn.net/cover/7010/and-rush-juncaceae-specimens-from-johannes-scheuchzers-collection-at-the-herbarium-of-natural-history-museum-vienna-w-121-141-ann-4427010.webp)
And Rush (Juncaceae) Specimens from Johannes Scheuchzer's Collection at the Herbarium of Natural History Museum Vienna [W] 121- 141 Ann
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien Jahr/Year: 2015 Band/Volume: 117B Autor(en)/Author(s): Pignotti Lia, Rainer Heimo, Vitek Ernst Artikel/Article: Grass (Gramineae) and rush (Juncaceae) specimens from Johannes Scheuchzer's collection at the Herbarium of Natural History Museum Vienna [W] 121- 141 Ann. Naturhist. Mus. Wien, B 117 121–141 Wien, Jänner 2015 Grass (Gramineae) and rush (Juncaceae) specimens from Johannes Scheuchzer's collection at the Herbarium of Natural History Museum Vienna [W] L. Pignotti*, H. Rainer* & E. Vitek* Abstract 44 specimens of grasses (Gramineae) and 2 of rushes (Juncaceae) from the herbarium of the Swiss pre-Lin- naean botanist Johannes Scheuchzer (1684–1738) are stored in the collections of the Natural History Museum Vienna [W]. Their historical, botanical and nomenclatural significance is briefly discussed. Key Words: Scheuchzer; Gramineae, Juncaceae; historic collection. Zusammenfassung 44 Belege der Gramineae und 2 der Juncaceae des Schweizer vor-linnéischen Sammlers Scheuchzer wur- den im Herbarium des Naturhistorischen Museums Wien [W] identifiziert. Ihre historische, botanische und nomenklatorische Bedeutung wird diskutiert. Introduction The thoroughness and value of Johannes Scheuchzer's botanical works have made it difficult to believe that botany only represented a minor part of his life. He was born on March the 20th 1684 in Zürich. He travelled, at a very young age, through the Alps with his brother Johann Jacob (1672–1733), who was 12 years his senior and a pioneer palaeobotanist and palaeontologist (STAFLEU & COWAN 1985). He participated in his brother's scientific activities before beginning studies in medicine. -

En La Península Ibérica
LagacaliaLagascalia 33,33: 2013183-274 (2013) 183 Universidad de Sevilla. I.S.S.N. 0210-7708 CHECKLIST DE FESTUCA L. (POACEAE) EN LA PENÍNSULA IBÉRICA J. A. Devesa1,5, P. Catalán2, J. Müller3, C. Cebolla4 & E. Ortúñez4 1 Departamento de Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal, Facultad de Cien cias, Campus de Rabanales, Universidad de Córdoba, Córdoba. 2 Departamento de Ciencias Agrarias y del Medio Natural, Escuela Politécnica Superior, Universidad de Zaragoza, Huesca. 3 Institut für spezielle Botanik, Friedrich-Schiller-Universität, Philosophenweg 16, Jena. 4 Departamento de Biología Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de Madrid. 5 [email protected] (Recibido el 23 de Septiembre de 2013) Resumen. Se ha elaborado una checklist actualizada del género Festuca en la Pe- nínsula Ibérica. El catálogo incluye 73 especies, que suman 98 taxones si se consideran las subespecies y variedades, de los que casi el 40% son endémicos del territorio. Para cada taxón se recoge el nombre válido y las sinonimias más importantes, la indicación locotípica, el número cromosómico, las características ecológicas, la distribución general y en el territorio, y la información bibliográfica de interés. Además, se recogen en varios apéndices los nombres sin asignación, los híbridos interespecíficos detectados en el territorio, los híbridos intergenéricos conocidos, los taxones excluidos provisionamente y aquellos cuya presencia es probable en el territorio. Palabras clave: Poaceae, Festuca, taxonomía, nomenclatura, checklist, corología, Península Ibérica. Summary. Checklist of Festuca L. (Poaceae) in the Iberian Peninsula. We present an updated checklist of the genus Festuca in the Iberian Peninsula. The catalogue includes 73 species, suming up 98 taxa considering infraspecific taxa (subspecies and varieties). -
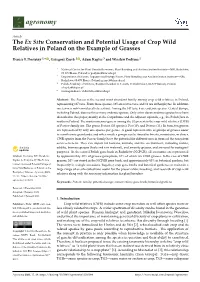
The Ex Situ Conservation and Potential Usage of Crop Wild Relatives in Poland on the Example of Grasses
agronomy Article The Ex Situ Conservation and Potential Usage of Crop Wild Relatives in Poland on the Example of Grasses Denise F. Dostatny 1,* , Grzegorz Zurek˙ 2 , Adam Kapler 3 and Wiesław Podyma 1 1 National Centre for Plant Genetic Resources, Plant Breeding and Acclimatization Institute—NRI, Radzików, 05-870 Błonie, Poland; [email protected] 2 Department of Grasses, Legumes and Energy Plants, Plant Breeding and Acclimatization Institute—NRI, Radzików, 05-870 Błonie, Poland; [email protected] 3 Polish Academy of Sciences, Botanical Garden in Powsin, Prawdziwka 2, 02-973 Warsaw, Poland; [email protected] * Correspondence: [email protected] Abstract: The Poaceae is the second most abundant family among crop wild relatives in Poland, representing 147 taxa. From these species, 135 are native taxa, and 11 are archeophytes. In addition, one taxon is now considered to be extinct. Among the 147 taxa, 8 are endemic species. Central Europe, including Poland, does not have many endemic species. Only a few dozen endemic species have been identified in this paper, mainly in the Carpathians and the adjacent uplands, e.g., the Polish Jura in southern Poland. The most numerous genera among the 32 present in the crop wild relatives (CWR) of Poaceae family are: The genus Festuca (33 species), Poa (19), and Bromus (11). In turn, ten genera are represented by only one species per genus. A good representative of groups of grasses occur in xerothermic grasslands, and other smaller groups can be found in forests, mountains, or dunes. CWR species from the Poaceae family have the potential for different uses in terms of the ecosystem services benefit. -

Numerical Evaluation of Grasslands Dominated by Sesleria Juncifolia Agg
HACQUETIA 13/1 • 2014, 57–77 DOI: 10.2478/hacq-2014-0012 NumerIcAl evAluAtIoN of grAsslands domINAted by SeSleria juncifolia Agg. in serbia Eva KABAŠ1,*, Snežana VUKOJIČIĆ1, Antun ALEGRO2, Boštjan SURINA3, Nevena KUZMANOVIĆ1, Vedran ŠEGOTA4 & Dmitar LAKUŠIĆ1 Abstract Phytosociological and numerical analyses of grasslands dominated by Sesleria juncifolia s.l. in Serbia were per- formed in order to resolve their syntaxonomy and nomenclature. Twelve relevés were sampled on Mt. Mučanj (western Serbia), which were then compared with similar relevés from other parts of the Balkan Peninsula by means of numerical analyses. The relevés were classified using cluster analysis, while the ordination was con- ducted using Detrended Correspondence Analysis (DCA). The results suggest the occurrence of two floristi- cally well defined Dinaric associations in Serbia: Seslerio juncifoliae-Edraianthetum graminifolii ass. nova from Mt. Mokra Gora (Oxytropidion urumovii, Elyno-Seslerietea) and Diantho petraeae-Seslerietum juncifoliae ass. nova (Chrysopogono-Saturejion, Festuco-Brometea) from Mt. Mučanj. Key words: Balkan Peninsula, classification, ordination, Seslerietum juncifoliae s.l., syntaxonomy, vegetation. Izvleček Naredili smo fitocenološko in numerično analizo travišč v katerih prevladuje vrsta Sesleria juncifolia s.l. in pred- stavili sintaksonomske in nomenklaturne rešitve. Dvanajst vegetacijskih popisov smo naredili na gori Mučanj (zahodna Srbija) in jih z numeričnimi metodami primerjali s podobnimi popisi z drugih delov Balkanskega polotoka. Popise smo klasificirali s klastrsko metodo, za ordinacijo smo uporabili korespondenčno analizo z odstranjenim trendom (DCA). Rezultati kažejo na obstoj dveh floristično dobro utemeljenih dinarskih en- demičnih asociacij v Srbiji: Seslerio juncifoliae-Edraianthetum graminifolii ass. nova z Mokre Gore (Oxytropidion urumovii, Elyno-Seslerietea) in Diantho petraeae-Seslerietum juncifoliae ass. -
Full Text Article
Lectotypification of taxa belonging to the “Festuca circummediterranea” group Bruno Foggi, Claudia Quercioli, Matilde Gennai, Enio Nardi & Maria Adele Signorini Abstract Résumé FOGGI, B., C. QUERCIOLI, M. GENNAI, E. NARDI & M. A. SIGNORINI FOGGI, B., C. QUERCIOLI, M. GENNAI, E. NARDI & M. A. SIGNORINI (2012). Lectotypification of taxa belonging to the “Festuca circummediter- (2012). Lectotypification des taxas du groupe «Festuca circummediterranea». ranea” group. Candollea 67: 221-228. In English, English and French abstracts. Candollea 67: 221-228. En anglais, résumés anglais et français. This paper reports the lectotypifications of the names Festuca Cet article traite des lectotypifications des noms Festuca ovina ovina var. laevis Hack., Festuca ovina subsp. laevis Hack., var. laevis Hack., Festuca ovina subsp. laevis Hack., Festuca Festuca circummediterranea Patzke, Festuca duriuscula circummediterranea Patzke, Festuca duriuscula var. campana var. campana N. Terracc. and Festuca campana (N. Terracc.) N. Terracc. et Festuca campana (N. Terracc.) Alexeev. Un Alexeev. As the lectotype of Festuca duriuscula var. campana nouveau lectotype pour Festuca duriuscula var. campana N. Terracc. previously designated by Alexeev is to be consid- N. Terracc. est désigné, comme le dernier lectotype désigné ered a neotype, a new lectotype is proposed. par Alexeev est considéré comme invalide. Key-words POACEAE – Festuca circummediterranea group – Nomen- clature – Typification – Italy Addresses of the authors: BF, CQ, MG, EN: Università di Firenze, Dipartimento di Biologia Evoluzionistica – Laboratori di Botanica, via G. La Pira, 4 I-50121 Firenze, Italy. Email (BF): [email protected] MAS: Dipartimento di Biotecnologie Agrarie – sez. Botanica ambientale e applicata, piazzale delle Cascine, 28 I-50123 Firenze, Italy. Submitted on September 13, 2010. -
Is the Tussock Form of Festuca Novae-Zelandiae of Recent Origin?
4 Is the Tussock Form of Festuca novae-zelandiae of Recent Origin? Janice M. Lord* Department of Plant & Microbial Sciences, University of Canterbury, Christchurch Tussock grasses are characteristic plants of much of montane Canterbury. Possible factors involved in the evolution of the tussock form include modification of the microclimate of the interior leaves resulting in reduced water-stress etc., or protection of the interior leaves from the attentions of herbivores. The tightly packed form of tussocks also means that an individual plant can better resist invasion of its 'territory'. Modification of the microclimate of interior leaves may be an important factor in the success of tussock grasses such as Festuca novae-zelandiae (hard tussock) in the relatively dry, windy Canterbury high country (Wardle 1963). However, wetland sedges such as Schoenus pauciflorus, Carex secta, Carex Comans, Carex buchananii, Uncinia uncinata, Uncinia caespitosa, and many others also form tussocks, so desiccation cannot be a primary factor in all cases. Grazing and browsing may have played a role in the evolution of the tussock form in New Zealand. New Zealand had a number of large ground-dwelling birds such as geese, swans, ducks and rails (Holdaway 1989) that would have frequented open areas and river flood-plains. These areas would have been the pre-human habitat of short-tussocks such as Festuca novae-zelandiae and Poa cita. These birds may have attacked tussock grasses and sedges in the same way that kea, takahe and Canada geese do today. Of course this is all assuming that the tussock habit is 'natural' for New Zealand taxa and evolved in response to conditions found within New Zealand; for genera such as Chionochloa this is a reasonable assumption. -

Fescues of the Intravaginal Group of Festuca L. Section Festuca in the Lowland and Montane Areas of the Northeastern Iberian Peninsula
Collectanea Botanica vol. 32 (2013): 43–57 ISSN: 0010-0730 doi: 10.3989/collectbot.2013.v32.005 Fescues of the Intravaginal group of Festuca L. section Festuca in the lowland and montane areas of the northeastern Iberian Peninsula S. PYKE Jardí Botànic de Barcelona, Consorci de Museus de Ciències Naturals, c. Font i Quer, s/n, ES-08038, Barcelona, Spain E-mail: [email protected] Editor: J. M. Montserrat Received 15 November 2012; accepted 10 November 2013 Abstract FESCUES OF THE INTRAVAGINAL GROUP OF FESTUCA L. SECTION FESTUCA IN THE LOWLAND AND MONTANE AREAS OF THE NORTHEASTERN IBERIAN PENINSULA.— Morphologically similar fescues occur across the study area (Mediterranean area of the northeastern Iberian Peninsula) at low and middle elevations. With the exception of the high mountain or alpine species, these populations are reviewed here, with particular attention being paid to the Festuca inops (F. gracilior) group, as well as to some other species, in particular F. lemanii, which are not easily understood and can complicate identification, especially where the taxa occur sympatrically. The application of the binomen F. inops De Not. to some of the Iberian populations constituting the F. inops group is discussed. New records for F. tarraconensis, F. occitanica, F. michaelis and F. heteroidea amplify the distribution range of these little-known taxa within the Iberian Peninsula. Key words: distribution; Festuca; identification; Mediterranean; morphology; NE Iberian Peninsula; Poaceae. Resumen ESPECIES DEL GRUPO INTRAVAGINAL DE FESTUCA L. SECCIÓN FESTUCA EN LOS PISOS BASAL Y MONTANO DEL NORDESTE DE LA PENÍNSULA IBÉRICA.— Diferentes especies de Festuca morfológicamente afines crecen en gran parte del territorio objeto de esta reseña (tierras mediterráneas del nordeste de la Península Ibérica), a baja y mediana altitud.