Arnold Wiebel
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Erfahrungen Erinnerungen Gedanken
Hanfried Müller Erfahrungen Erinnerungen Gedanken Zur Geschichte von Kirche und Gesellschaft in Deutschland seit 1945 GNN Verlag ISBN 978-3-89819-314-6 © 2010 by GNN Gesellschaft für Nachrichtenerfassung und Nachrichtenverbrei- tung, Verlagsgesellschaft für Sachsen/Berlin mbH, Badeweg 1, D- 04435 Schkeuditz Alle Rechte vorbehalten Gesamtherstellung: GNN Schkeuditz 4 Noch kurz vor seinem Tode am 3. März 2009 war Hanfried Müller mit sei- ner »Autobiographie« befaßt, in der ein Kapitel deutscher Geschichte und Kirchengeschichte festgehalten werden sollte. Nicht um seine Person ging es ihm also und schon gar nicht um private Befindlichkeit, wohl aber um eine Geschichtsschreibung, die gesellschaftliche und kirchenpolitische Verhältnisse und Entwicklungen im Fokus persönlicher Erfahrungen und Erinnerungen widerspiegelt. Seine Aufzeichnungen sind ein Torso geblieben. Dennoch enthält bereits der publizierbare Text eine solche Fülle an grundsätzlicher historischer Einsicht und politischer Erkenntnis, daß seine Lektüre weit über den Blickwinkel subjektiver Wertungen hinausträgt. Von Hanfried Müller war, selbstredend, keine Retrospektive zu erwarten, der sich bürgerliches Herrschaftsbewußtsein und schon gar nicht deutsche Kleinbürgerlichkeit akkommodieren könnten. Schließlich verstieß er als Sohn aus »guter Gesellschaft« gegen die ehernen Prinzipien dieser Gesell- schaft; und schon zu seinen Lebzeiten ist ihm sein Klassenverrat niemals verziehen worden. Seine »Erinnerungen« zeichnen nach, warum und wie er und seine Frau Rosemarie Müller-Streisand einen Weg gegangen sind, der - ebenso außer- gewöhnlich wie konsequent - mitten in den Klassenkampf des Kalten Krieges führte, mithin also auch in die Auseinandersetzung mit einem Kir- chenverständnis, dem weitgehend die Signaturen einer konservativen Partei eigneten und das schon deshalb Müllers reformatorische Theologie als Zumutung und Provokation empfinden mußte. Die Aufzeichnungen enden 1973. Die bereits detailliert konzipierten Kapi- tel V. -

A Dialogical Approach from an African
SOME ASPECTS OF CHRISTOLOGY: A DIALOGICAL APPROACH FROM AN AFRICAN PERSPECTIVE WITH SPECIAL REFERENCE TO THE THEOLOGY OF OTTO WEBER by Rev.Peter K. C. arap Bisem B.D. Dip.Th. A THESIS SUBMITTED FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY IN THE FACULTY OF DIVINITY, UNIVERSITY OF GLASGOW. April, 1991 Peter K.C. arap Bisem. ProQuest Number: 13833802 All rights reserved INFORMATION TO ALL USERS The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. In the unlikely event that the author did not send a com plete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if material had to be removed, a note will indicate the deletion. uest ProQuest 13833802 Published by ProQuest LLC(2019). Copyright of the Dissertation is held by the Author. All rights reserved. This work is protected against unauthorized copying under Title 17, United States C ode Microform Edition © ProQuest LLC. ProQuest LLC. 789 East Eisenhower Parkway P.O. Box 1346 Ann Arbor, Ml 48106- 1346 T1I2- GLASGOW UNIVERSITY fl ^LIBRARY CONTENTS Page Title Quotation i Dedication ii Acknowledgements iii - v Copyright vi Summary vii-viii Abbreviations ix Part One: The Context and Intention of Otto Weber’s Theology Introduction 1- 3 CHAPTER One- Otto Weber's Theological Milieu 4-64 - background - Nineteeth Century theology on the crossroads - reckoning with National socialism - revelation and the question of Existential interpretation Chapter Two - Biographical Sketch on Otto Weber 65-70 Chapter Three - Otto Weber's background Anthropol|[y: 7 1 - -

MENNQNITE LIFE JULY 1965 an Illustrated Quarterly Published by Bethel College, North Newton Kansas
MENNQNITE LIFE JULY 1965 An Illustrated Quarterly Published by Bethel College, North Newton Kansas EDITOR Cornelius Krahn ASSOCIATE EDITORS John F. Schmidt, Walter Klaassen DESIGN CONSULTANT Robert Regier DEPARTMENT EDITORS Faith and Life Walter Klaassen, Chairman Henry Poettcker (Bible) Leland Harder (Church) Russell Mast (Worship) Heinold Fast (Theology) John Howard Yoder (Theology) Orlando Waltner (Missions) Esko Loewen (Service) Social and Economic Life J. Winfield Fretz, Chairman J. Ploward Kauffman (Family) Calvin Redekop (Community) Eldon Gräber (Education) Howard Raid (Agriculture) John Sawatzky (Industry) Paul Peachey (Sociology) Jacob Loewen (Anthropology) Fine Arts Paul Friesen, Co-chairman Elaine Rich, Co-chairman Mary Eleanor Bender (Literature) Warren Kliewer (Drama) Walter Jost (Music) Robert Regier (Art) History and Folklife Melvin Gingerich, Co-chairman John F. Schmidt, Co-chairman COVER: Irvin B. Horst (History) Ecumenical worship service at Bethlehem Church in N. van der Zijpp (History) Prague conducted by (from left to right) Metropoli Delbert Grätz (Genealogy) tan Nikodim (U.S.S.R.), J. L. Hromadka (Prague) Gerhard Wiens (Folklore) and Martin Niemoeller (Germany). Mary Emma Showalter Eby (Foods) BACK COVER: Prague Castle and Charles Bridge. ADMINISTRATION Vernon Neufeld, President PHOTO CREDITS: Albert J. Meyer, Dean Cover: Siegfried Krueger; Inside and Back Cover: J. Jenicek; pp. 103 and 119 Obrarnve zpravod.njstvi, Erwin C. Goering, Dir. of Public Affairs CTK; p. 116 P. J. Dyck. Plartzel W. Schmidt, Controller MENNONITE July, 1969 Volume XX Number 9 LIFE CONTRIBUTORS Peace or Revolution: The Coming Struggle 99 PAUL PEACHEY, Executive Secretary "f the By Paul Peachey Church Peace Mission, Washington, D. C., lias attended several meetings of the Peace Conference. -

Insolvenzrecht Im Bundle Für Nur Ca
€ 14,– 9. Jahrgang ∙ August 2017 ∙ Ausgabe 4 ∙ ISSN 1867-5328 ∙ 15238 achbuchjournal Rezension. ❙ Porträt. Interview. Buchkauf. WIRTSCHAFT Europa in der Krise!? NEU Der Odysseus Komplex. Pragmatischer Vorschlag zur Lösung der Eurokrise Werner Verlag Der schwarze Juni. Brexit, Flücht- lingswelle, Euro-Desaster – Wie die Neugründung Europas gelingt The Euro and the Battle of Ideas Einzigartig in der Verknüpfung SPRACHWISSENSCHAFTEN von Baurecht und Baubetrieb Otto Böhtlingk: ein Gelehrtenleben ASTRONOMIE Neuerscheinungen RECHT Insolvenzrecht Im Bundle für nur ca. € 269,– Bank- und Kapitalmarktrecht ISBN 978-3-8041-5141-3 Arbeitsrecht THEOLOGIE | RELIGION Muslime und Christen Dietrich Bonhoeffer und Hans Joachim Iwand BIOGRAFIEN Bauvorhaben laufen selten reibungslos. Oft gibt es Kapellmann/Schiffers/Markus Frauen in der Reformationszeit Streit um Leistungspfl icht und Leistungsumfang, um Vergütung, Nachträge und die ordnungsgemäße Ausführung und Vergütung Behinderungsfolgen beim oder es kommt zur (Teil-)Aufkündigung des Vertrags Bauvertrag ZEITGESCHICHTE durch eine der Parteien. Buchenwald und Mittel-Dora Band 1: Einheitspreisvertrag Wege, Orte, Räume der NS-Verfolgung Das zweibändige Grundlagenwerk erläutert die damit 6. Aufl age 2017, Kriegsgefangenen lager Bergen-Belsen verbundenen Fragen in beispielgebender Systema- ca. 1.050 Seiten, gebunden, Eidgenossen contra Genossen tik und Tiefe. Die rechtlichen und baubetrieblichen ca. € 169,– Aspekte werden dabei praxisgeeignet verknüpft, zu ISBN 978-3-8041-5139-0 Die DDR im Blick -

"Messianic Secret" in Marks Gospel: an Historical Survey
THE "MESSIANIC SECRET" IN MARKS GOSPEL: AN HISTORICAL SURVEY by BRIAN GEORGEPOWLEY A thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy in the Faculty of Divinity of the University of Glasgow March, 1979- TO MY FATHER AND IN MEMORYOF MY MOTHER -1- COIITENTS Paýýe CONTENTS I PREFACE 3 4 ABBREVIATIONS INTRODUCTION 5 THE SECRETIDENTITY OF JESUS Ih MAWS GOSPEL 11 Mark's Introduction 12 The Authority of Jesus: Exorcisms and Debates 14 Parables 18 Miracles 20 The Blindness of the Disciples 23 26 Messiahship and Discipleshi. p Challenge to Jerusalem 34 The Passion and Resurrection 36 Conclusion 39 WREDEAND THE END OF LIBERALISM (1901-1914) 41 The Theological Climate at the Turn of the Century 42 The State of the'Leben-Jesu-Forschuna 46 Wredeand Schweitzer' 50 Reactions on the Continent 65 Reactions in Britain 70 Conclusion 76 III. THEECLIPSE OF THEHISTORICAL JESUS (BETWEEN THE WARS) 80 The Theology of Crisis and Form Criticism 81 The Debate with Bultmann 89 H.J. Ebeling 100 -2- Page Work in Britain 103 R. H. Lightfoot and the Apologetic Theory 115 Conclusion 123 IV. TOWARDSTHE THEOLOGYOF THE "MESSIANIC SECRET" (THE POST-WARPERIOD) 126 The Central Tradition'in Britain 127 The "Pauline" Interpretation 143 E. Sj8berg and the Son of Man 147 The New Quest of the Historical Jesus and Early Redaction Criticism 152 T. A. Burkill,. G. Minette de Tillesse and Others 168 Recent British Work 186 Some American Contributions 2o6 Recent Work on the Continent 218 Conclusion 225 CONCLUSIONS 227 BIBLIOGRAPHY 233 a PREFACE I began this thesis during William Barclay's tenure of the Chair I living in of Divinity and Biblical Criticism. -

Spiritual Leaders in the IFOR Peace Movement
A Lexicon of Spiritual Leaders In the IFOR Peace Movement Version 4 Page 1 of 156 10.4.2012 Dave D’Albert Disclaimer:................................................................................................................................................................... 5 Forward:...................................................................................................................................................................... 5 The Start of it all............................................................................................................................................................... 6 1914............................................................................................................................................................................. 6 Bilthoven Meeting 1919............................................................................................................................................... 6 Argentina.......................................................................................................................................................................... 7 Adolfo Pérez Esquivel 1931-....................................................................................................................................... 7 Others with little or no information............................................................................................................................... 7 D. D. Lura-Villanueva ............................................................................................................................................ -

Hans Joachim Iwand in Dortmund 1937-1945
1 Hans Joachim Iwand in Dortmund 1937-1945 Im Oktober 1937 ist Hans Joachim Iwand mit seiner Familie und dem ausgewiesenen Predigerseminar der Bekennenden Kirche in Ostpreußen in Dortmund angekommen. Iwand war durch die Geheime Staatspolizei ausgewiesen worden und seine Wahl war auf Westfalen gefallen, wo Fritz Heuner, der Pfarrer an St. Marien in Dortmund und ein Freund des Bloestauer Seminars war, wohnte. Damit war zunächst ein langer Irrweg zu Ende, der über Bloestau, das nordöstlich von Königsberg liegt, nach Jordan, ein ostbrandenburgisches Dorf im Kreis Meseritz, und dann nach Dortmund führte. Die Ausweisung Iwands und damit der Vikare der Bekennenden Kirche wurde damit begründet, dass Iwand die „kirchenpolitische Lage in völlig unsachgemäßer Weise erörtert und hierbei staatsfeindliche Reden geführt habe“.1 Hans Joachim Iwand wurde am 11. Juli 1899 in Schlesien im Dorf Schreibendorf als Sohn eines Pfarrers geboren. 1917 schrieb er sich an der Evangelischen Fakultät an der Friedrich-Wilhelms- Universität in Breslau ein. Dann wurde Iwand 1917 zum Wehrdienst eingezogen. 1921 schloss er sich kurzeitig einem Freikorps an. Ab 1919 studierte er wieder in Breslau. Dort traf er auf den jungen Professor Rudolf Hermann (1887 -1962), mit dem er besonders durch die Erforschung der Theologie Martin Luthers verbunden blieb. In seiner tiefgründigen und bis heute lesenswerten Schrift „Glaubensgerechtigkeit nach Luthers Lehre“ hat Iwand 1941 in Dortmund im Vorwort geschrieben: „Dass ich hierbei der Lutherforschung weithin zu großem Dank verpflichtet bin, werden Kenner heraushören. Eines Mannes möchte ich aber doch in diesem Vorwort in Dankbarkeit gedenken: Rudolf Hermann, Professor in Greifswald. Ihm verdanke ich – wie mancher andere, der damals nach dem Weltkrieg bei ihm studierte, dass wir diesen Eingang in Luthers Theologie fanden, dass wir hier selbst zu Theologen geworden sind.“2 Diese Schrift war Martin Niemöller gewidmet, der damals schon in Haft war. -

Book Reviews KERYGMA and MYTH
46 THE CHURCHMAN Smith together consult (and, if may be, pray) about John Brown who is ill and whom God wants to be well. Book Reviews KERYGMA AND MYTH. Ed. H. W. Bartsch. Trans. R. H. Fuller. S.P.C.K. 22/6. We have heard a good deal recently of the demythologization of the New Testament demanded by Rudolf Bultmann, but apart from a few specialists it is doubtful whether many students know exactly what it is that Bultmann suggests, or what criticisms he has had to meet from contemporary German writers. To make good that unfortunate ignorance a symposium of statements, originally collected in German, has now been made available to the English speaking public, with an interesting appreciation by Austin Farrer. The most important of the series is, of course, the original essay by Bultmann entitled New Testament and Mythology. This is followed by a detailed and penetrating criticism by Julius Schniewind, which provokes Bultmann to what Farrer regards as the most careful and exact presentation of his view. Further contributions are made by E. Lohmeyer, H. Thielicke and F. K. Schumann, all of which touch on important aspects of the problem. In a final reply Bultmann tries particularly to defend himself against the charge of reinterpreting the Gospel in terms of current philosophy. To pronounce on a controversy which covers so much ground in such detail and with such an acuteness of theological perception is not easy in the space of a short review, for any judgment which is not backed up by definite evidence is bound to smack of the pontifical. -

Dietrich Bonhoeffer Und Hans Joachim Iwand – Kritische Theologen
Michael Basse / Gerard den Hertog (Hg.) Dietrich Bonhoeffer und Hans Joachim Iwand – Kritische Theologen FSÖTh 157 im Dienst der Kirche Dietrich Bonhoeffer und Hans Joachim Iwand Joachim Hans BonhoefferDietrich und den den Hertog (Hg.) / Basse Basse / den Hertog (Hg.): Bonhoeffer und Iwand – Kritische Theologen im Dienst der Kirche © 2017, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN Print: 9783525564523 — ISBN E-Book: 9783647564524 Basse / den Hertog (Hg.): Bonhoeffer und Iwand – Kritische Theologen im Dienst der Kirche Forschungen zur systematischen und ökumenischen Theologie Herausgegeben von Christine Axt-Piscalar, David Fergusson und Christiane Tietz Band 157 © 2017, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN Print: 9783525564523 — ISBN E-Book: 9783647564524 Basse / den Hertog (Hg.): Bonhoeffer und Iwand – Kritische Theologen im Dienst der Kirche Michael Basse /Gerard den Hertog (Hg.) Dietrich Bonhoeffer und Hans Joachim Iwand – Kritische Theologen im Dienst der Kirche Vandenhoeck & Ruprecht © 2017, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen ISBN Print: 9783525564523 — ISBN E-Book: 9783647564524 Basse / den Hertog (Hg.): Bonhoeffer und Iwand – Kritische Theologen im Dienst der Kirche Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. ISSN 0429-162X ISBN 978-3-647-56452-4 Weitere Ausgaben und Online-Angebote sind erhältlich unter: www.v-r.de © 2017, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Theaterstraße 13, D-37073 Göttingen/ Vandenhoeck & Ruprecht LLC, Bristol, CT, U.S.A. www.v-r.de Alle Rechte vorbehalten. Das Werkund seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages. -

Iwand-Vortrag Beienrode 10-2009
60 Jahre Haus der helfenden Hände Festrede zum Stiftungsempfang der Evangelischen Stiftung Neuerkerode im Haus der helfenden Hände in Beienrode am 19. Oktober 2009 von Landesbischof Prof. Dr. Friedrich Weber Sehr geehrte Damen und Herren, Mehrfach ist heute Abend der Name Hans-Joachim Iwand gefallen. Was hat Hans Iwand mit Beienrode zu tun? Wer war Hans-Joachim Iwand? Hans-Joachim Iwand (1899-1960), war Pastor und lutherischer Theologe der bekennenden Kirche, also jenem Teil der Kirche, der sich vom nationalsozialistischen Staat distanzierte und teilweise im Widerstand arbeitete. Nach 1945 haben diese Männer und Frauen versucht ihre Erfahrungen in die Gestaltung der neuen evangelischen Kirche in Deutschland einzubringen, maßgeblich beteiligt war dabei auch Hans-Joachim Iwand. Er war ein wichtiger Berater bei der Entwicklung einer Grundordnung für die EKD und sein Vorentwurf liegt dem Darmstädter Wort des Bruderrats der Bekennenden Kirche von 1947 zugrunde. Fast prophetisch muten in der heutigen konfessionellen Situation seine in einem Vortrag am 8. Mai 1947 in Berlin gemachten Anmerkungen zur konfessionellen Lage zwischen den Evangelischen an: „Selbstverständlich wird es Lutherische und Reformierte geben, aber beide müssen wissen, dass das Erbe ist. Das Wort Gottes, das uns heute begegnet, ist nicht konfessionelle bestimmt. Die Gemeinden begreifen den konfessionellen Kampf nicht mehr als einen Kampf um ihr Heil.“ 1 Ohne die überragende Bedeutung des Theologen Iwand, ohne seine unermüdliche Initiative und seinen Wagemut ist die Existenz -
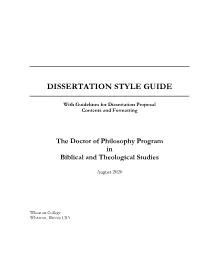
Dissertation Style Guide
DISSERTATION STYLE GUIDE With Guidelines for Dissertation Proposal Contents and Formatting The Doctor of Philosophy Program in Biblical and Theological Studies August 2020 Wheaton College Wheaton, Illinois USA Wheaton College 501 College Avenue Wheaton, Illinois 60187-5593 Graduate Biblical and Theological Studies: 630-752-5197 Fax: 630-752-5902 E-Mail: [email protected] © 2018 by Wheaton College Printed in the United States of America Wheaton College reserves the right to change without notice any statement in this publication concerning, but not limited to, citation and bibliography style, formatting, abbreviations, and shortened publisher names. 2 Dissertation Style Guide TABLE OF CONTENTS PREFACE ............................................................................................................... 10 1. GENERAL FORMATTING .............................................................................. 11 1.1. Recommended Software ................................................................................................................... 11 1.2. Paper .................................................................................................................................................... 11 1.3. Fonts .................................................................................................................................................... 11 1.4. Line Spacing ....................................................................................................................................... 12 1.5. -

Freedom 1N Christ-Gift and Uemand
CONCORDIA . THEOLOGICAL MONTHLY "JJ ___ m m c~ -I <)SERVE Vol. XL Special Issue No.6 & 7 Freedom 1n Christ-Gift and uemand EDGAR KRENTZ "F reedom," a word we often hear and FREEDOM AS GIFT a concept we highly prize, is surpris The Pauline teaching on freedom can ingly rare in the New Testament. A rapid only be understood from the vantage point survey of the words eleutheria, eleutheroo, of Pauline eschatology. Liberty is present and eleutheros in a concordance will show only because Christ has freed us ( eleu that in any sense other than the sociological therosen, aorist, Gal. 5: 1 ) . We have this (free man as opposed to slave) the term liberty "in Christ" (GaL 2: 4). But Christ is practically confined to Paut! He is the marks the end of one age and the begin only one to use freedom consistently in ning of a new age for those who are "in a religious sense. Him." He came at the pleroma tou chro In Paul the concept freedom occurs in nwt (Gal 4;4) He rescued us from this this religious sense in the four letters "present evil age" (Gal. 1: 4) through His Romans, First and Second Corinthians, self-giving on our behalf. He accomplished and Galatians. It is there used as a polemi what we could not do. At a given moment cal summary of the Christian existence that in history, a "life radically sacrificed for is under attack from Judaizing Christians, others" 4 freed us. The basis for Christian Judaism, or libertine (gnosticizing?) freedom in Paul is not a carefully worked Christians.