Die Landsgemeinde Von Appenzell Ausserrhoden
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Gemeindeschulleitungen Schuljahr 2021/2022
Gemeindeschulleitungen Schuljahr 2021/2022 Gemeinde Name/Adresse Telefon Erreichbar Urnäsch Wehrle Martin 071 364 14 83 Mo / Di Schulanlage Au, Unterdorfstr. 36, 9107 Urnäsch Fr Vormittag [email protected] Herisau Häberli Michael 071 354 55 30 Mo - Fr Waisenhausstr. 10, 9100 Herisau michael.hä[email protected] Porta Alex 071 354 55 63 Mo - Fr Waisenhausstr. 10, 9100 Herisau [email protected] Stäheli Markus 071 354 55 29 Mo - Do Waisenhausstr. 10, 9100 Herisau [email protected] van Willigen Carol 071 354 55 53 Mo - Do Waisenhausstr. 10, 9100 Herisau [email protected] Schwellbrunn Nef Claudio 071 352 75 81 Mo - Do Schulhaus Sommertal, 9103 Schwellbrunn [email protected] Hundwil Niethammer-Schai Tamara 071 367 20 28 Mo / Mi / Fr Schulhaus Mitledi, 9064 Hundwil Vormittag [email protected] Stein Jakob Thomas 071 367 15 64 Mo / Di Schulanlage, Dorf 655, 9063 Stein Mi - Fr Vormittag [email protected] Schönengrund Gächter Petra 071 361 10 61 Schulhaus Kugelmoos, 9105 Schönengrund [email protected] Departement Bildung und Kultur – eHandbuch für die Volksschule im Kanton Appenzell Ausserrhoden 08.2021 Waldstatt Kölbener Vreni 071 351 73 19 Mo / Di / Do Schule Waldstatt, Schulstr. 2/4, 9104 Waldstatt [email protected] Teufen Niederteufen Haltiner-Bächtiger Janine 071 333 59 71 Di / Fr Schulhausstr. 5, 9052 Niederteufen [email protected] Landhaus Lussmann Priska 071 335 07 55 Mo - Fr Landhausstrasse 5, 9053 Teufen [email protected] Sekundarschule Schöni Urs 071 335 07 64 Mo / Di / Mi / Fr Gremmstrasse 9b, 9053 Teufen [email protected] Bühler Graf Eva (interim) 071 793 17 29 Hermoos 1, 9055 Bühler [email protected] Gais Zehnder Marco 071 791 80 87 Schulhausstr. -

Verzeichniss Aller Gegenwärtigen Geschlechter Ausserrohdischer Landsleute Und Landsassen
Verzeichniss aller gegenwärtigen Geschlechter ausserrohdischer Landsleute und Landsassen Objekttyp: Index Zeitschrift: Appenzellisches Monatsblatt Band (Jahr): 16 (1840) Heft 10 PDF erstellt am: 24.09.2021 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch http://www.e-periodica.ch 152 Verzeichniß aller gegenwärtigen Geschlechter anßer- rohdischer Landsleute und Landsaßen. ES versteht sich wol von selbst/ daß dieses Register nur die Geschlechter der Mannspersonen enthält. W» wir Bescheid wis- sen/ wann einzelne Geschlechter, oder wenigstens besondere Zweige derselben, ins Landrccht aufgenommen wurden, haben wir in Anmerkungen Auskunft gegeben. Bei jedem Geschlechte sind die Gemeinden genannt, in welchen dasselbe verbürgcrr ist, und vorn an dieser Rubrik wird die Zahl dieser Gemeinden genannt. -

Die Älteste Darstellung Der Landsgemeinde Von Appenzell Ausserrhoden
Die älteste Darstellung der Landsgemeinde von Appenzell Ausserrhoden Autor(en): Steinmann, Eugen Objekttyp: Article Zeitschrift: Unsere Kunstdenkmäler : Mitteilungsblatt für die Mitglieder der Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte = Nos monuments d’art et d’histoire : bulletin destiné aux membres de la Société d’Histoire de l’Art en Suisse = I nostri monumenti storici : bollettino per i membri della Società di Storia dell’Arte in Svizzera Band (Jahr): 15 (1964) Heft 2 PDF erstellt am: 26.09.2021 Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-392847 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch http://www.e-periodica.ch DIE ÄLTESTE DARSTELLUNG DER LANDSGEMEINDE VON APPENZELL AUSSERRHODEN Mancher Besucher von Trogen mag sich über das herrschaftliche Aussehen des Pfarr- und Gemeindehauses wundern. -

Vom Dilemma Zum Trilemma
Meinungsbildung in der direkten Demokratie – Vorbild Landsgemeinde? REFERAT VOM 19. MÄRZ 2019 IM RAHMEN DER VERANSTALTUNG CAMPUS FÜR DEMOKRATIE VERNETZT IN GLARUS Marlène Gerber Année Politique Suisse [email protected] ANNÉE POLITIQUE SUISSE ⋅ INSTITUT FÜR POLITIKWISSENSCHAFT ⋅ UNIVERSITÄT BERN ⋅ FABRIKSTRASSE 8 ⋅ 3012 BERN Année Politique Suisse o Chronik der Schweizer Politik seit 1966 o Synthese politischer Geschäfte und gesellschaftlicher Debatten o Zeitungsarchiv zu nationaler und kantonaler Politik o Angesiedelt am Institut für Politikwissenschaft der Universität Bern Année Politique Suisse o Bis 2014: Jahrbuch Schweizerische Politik Année Politique Suisse o Ab 2015: Frei zugängliche Online-Plattform o https://anneepolitique.swiss Aufbau Theoretische Überlegungen Aktuelle Erkenntnisse Relevanz und Einfluss von Landsgemeindedebatten Partizipation und Nutzung des Rederechts Synthese Theoretische Überlegungen Urnen- vs. Versammlungsdemokratie Spiegel Online Urnen- vs. Versammlungsdemokratie Walliser Bote Urnen- vs. Versammlungsdemokratie Urne Versammlung «vote-centric» «talk-centric» Präferenzen sind fix Präferenzen sind formbar Ergebnis als Ergebnis als Aggregation fixer gemeinsam gefällter individueller Entscheid nach Präferenzen deliberativem Austausch Chambers (2003) Funktionen des deliberativen Demokratiemodells o Epistemische Funktion o Ethische Funktion o Demokratische Funktion Mansbridge et al. (2012) Epistemische Funktion o Ziel • Meinungsbildung auf Basis von sachbezogenen und relevanten Argumenten • Stärkung der -

•Bericht Regioprojekt
Kantonale Fachstellen für Natur- und Landschaftsschutz St.Gallen, Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden Amphibienschutz Appenzeller Vorderland 2004: Erhaltung und Vernetzung der gefährdeten Amphibienarten im Appenzeller Vorderland und angrenzenden St.Galler Gebieten Schlussbericht St.Gallen, 30. April 2004 Ökonzept GmbH, Dr. Jonas Barandun Lukasstrase 18, CH – 9008 St.Gallen Telefon 071 246 32 42; [email protected] Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung und Projektinhalt . 1 2. Projektgebiet . 1 3. Grundlagen & Vorgehen . 1 4. Amphibienvorkommen . 2 5. Gewässerangebot . 3 6. Massnahmenprogramm . 4 7. Anhang . 6 Amphibienschutz Appenzeller Vorderland 2004 Seite 1 1. Einleitung und Projektinhalt Im Appenzeller Vorderland sowie auf angrenzendem St.Galler Gebiet sind Feuerweiher und ähnliche Kleingewässer fast die einzigen geeigneten Laichgewässer für Amphibien. Besonders geeignet scheinen diese Gewässer für Geburtshelferkröten und Fadenmolche gewesen zu sein, welche hier über lange Zeit ein stabiles Netz von Vorkommen entwickelten. Seit den 80er Jahren haben Feuerweiher ihre Funktion allmählich verloren und wurden seither oft zugedeckt oder anders genutzt. Als Folge davon hat sich die Amphibienfauna wesentlich verändert. Eine Überprüfung von Vorkommen der Geburtshelferkröten im Sommer 2002 hat ergeben, dass die Art im Gebiet inzwischen weitgehend verschwunden ist. Im Inventar der Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung IANB wurden provisorisch 2 Feuerweiher in der Gemeinde Oberegg aufgenommen mit dem Hinweis, dass eine geeignete Lösung für die besondere Situation im Gebiet zu suchen sei. Pro Natura St.Gallen-Appenzell hat in der Gemeinde Wolfhalden aufgrund der lokalen Initiative von Lukas Tobler 1999 ein Projekt zur Erhaltung von geeigneten Bedingungen in Feuerweihern sowie zur gezielten Förderung von Geburtshelferkröten gestartet. Dank dem grossen persönlichen Einsatz konnten mit finanzieller Unterstützung durch den Kanton AR inzwischen mehrere Gewässer aufgewertet werden. -

Liberal and Radical Democracies: the Swiss Cantons Compared
World Political Science Review 2014; 10(2): 385–423 Marc Bühlmann*, Adrian Vatter, Oliver Dlabac and Hans-Peter Schaub Liberal and Radical Democracies: The Swiss Cantons Compared Abstract: This article examines the widespread hypothesis that German-speak- ing Swiss cantons exhibit radical-democratic characteristics, while the Latin cantons possess stronger liberal-representative democratic profiles. Empirical and multi-dimensional measuring of the quality of democracy in the cantons shows that this hypothesis does not do the complexity of cantonal democracy justice. Today’s position of the cantons along the axes of liberal and radical democracy is best explained with reference to the strong liberal and democratic constitutional movements within the cantons during the middle of the 19th century. Keywords: measuring the quality of democracy; liberal democracy; radical democracy; Switzerland; path dependence (Erblast hypothesis). DOI 10.1515/wpsr-2014-0017 1 Introduction A key concern of empirical research on democracy is to assess and compare different types of political regimes. Measuring democracy plays a prominent role. Its origins lie in the works of Lipset (1959) and Dahl (1956) and have been continued and developed in numerous other studies (for a summary see: Lauth 2004; Pickel and Pickel 2006). The existing empirical works distinguish them- selves noticeably in that they focus almost exclusively on the national level while the subnational level is practically ignored. This gap in the research *Corresponding author: Marc Bühlmann, Institute of Political Science, University of Bern, Switzerland, e-mail: [email protected] Adrian Vatter and Hans-Peter Schaub: Institute of Political Science, University of Bern, Switzerland Oliver Dlabac: Department of Political Science, University of Zurich, Switzerland 386 Marc Bühlmann et al. -

Gemeindeblatt März 2019
MÄRZ 2019 ÄMTER & KOMMISSIONEN Frühlingssingen 4 Seniorenausflug 5 Dorfführung 5 KIRCHGEMEINDEN Kirchenkalender 12 DORFLEBEN Alain Berset in Trogen 19 Velobörse 28 Pfadi-Schnuppertag 33 Kinder-Sportcamp 35 2 GEMEINDEBLATT SPEICHER MÄRZ 2019 // ÄMTER & KOMMISSIONEN EDITORIAL GFS, GAST Immer diese Abkürzungen. Wer kennt es lernte, wann ein GFS zum Einsatz kommt, nicht, der GP (Gemeindepräsident) hat was dann zu tun ist und wie der FS (Füh- mit dem GR (Gemeinderat) den Antrag der rungsstandort) eingerichtet sein sollte. FIKO (Finanzkommission) besprochen. Wir lernten aber auch, was die Aufgaben Nur für Insider. Innerhalb von Organisatio- der EL Front (Einsatzleitung Front) wie nen und Gruppierungen etabliert sich eine Kapo (Kantonspolizei) oder FW (Feuer- eigene Sprache, die es zu lernen gilt. Sonst wehr) sind. Zudem kann in ausserordent- gehört man nicht dazu. lichen Lagen die Bevölkerung mit ICARO Ich möchte Sie zu Insidern machen. Zu- (Information Catastrophe Alarm Radio mindest in zwei Bereichen. In den letzten Organisation = Dringliche Radiomeldung) Wochen waren zwei wichtige Anlässe informiert werden. Der GP hat viele neue auf dem Programm. Zum einen fand ein Abkürzungen gelernt für eine Organisa- Einführungskurs für neue Mitglieder des tion, die hoffentlich selten oder besser gar Gemeindeführungsstabes statt. Zum an- nie zum Einsatz kommt. deren wurde ein Workshop zur Überarbei- tung des Altersleitbildes der Gemeinden Da ist es mit GAST (Gutes Alter Speicher Speicher und Trogen durchgeführt. Das Trogen) schon viel einfacher. Zusammen liest sich dann in etwa so: mit der Gemeinde Trogen arbeitet eine AG (Arbeitsgruppe) an der Überarbeitung des Der GFS (Gemeindeführungsstab) ist eine AL (Altersleitbild). Wie der Stand ist und Organisation, die in Krisensituationen der welche spannenden Ergebnisse am WS Gemeinde zum Zuge kommt. -

Local and Regional Democracy in Switzerland
33 SESSION Report CG33(2017)14final 20 October 2017 Local and regional democracy in Switzerland Monitoring Committee Rapporteurs:1 Marc COOLS, Belgium (L, ILDG) Dorin CHIRTOACA, Republic of Moldova (R, EPP/CCE) Recommendation 407 (2017) .................................................................................................................2 Explanatory memorandum .....................................................................................................................5 Summary This particularly positive report is based on the second monitoring visit to Switzerland since the country ratified the European Charter of Local Self-Government in 2005. It shows that municipal self- government is particularly deeply rooted in Switzerland. All municipalities possess a wide range of powers and responsibilities and substantial rights of self-government. The financial situation of Swiss municipalities appears generally healthy, with a relatively low debt ratio. Direct-democracy procedures are highly developed at all levels of governance. Furthermore, the rapporteurs very much welcome the Swiss parliament’s decision to authorise the ratification of the Additional Protocol to the European Charter of Local Self-Government on the right to participate in the affairs of a local authority. The report draws attention to the need for improved direct involvement of municipalities, especially the large cities, in decision-making procedures and with regard to the question of the sustainability of resources in connection with the needs of municipalities to enable them to discharge their growing responsibilities. Finally, it highlights the importance of determining, through legislation, a framework and arrangements regarding financing for the city of Bern, taking due account of its specific situation. The Congress encourages the authorities to guarantee that the administrative bodies belonging to intermunicipal structures are made up of a minimum percentage of directly elected representatives so as to safeguard their democratic nature. -

Die Volksabstimmungen in Appenzell A. R. Im Lichte Der Statistik (1849-1908)
Die Volksabstimmungen in Appenzell A. R. im Lichte der Statistik (1849-1908) Objekttyp: Index Zeitschrift: Appenzellische Jahrbücher Band (Jahr): 36 (1908) PDF erstellt am: 28.09.2021 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch http://www.e-periodica.ch Die Volksabstimmungen in Appenzell A. R. im Lichte der Statistik (1849-1908). Vmi J. J. Tobler, Ratsschreiber. Entscheide der Landsgemeinde. Datum Gegenstand der Landagememdp Entscheid ") 1848, Aug. 27. Hundwil. Neue Bundesverfassung A. 1850, April 28. Trogen. Gesetz über das Strassenwesen, 1. Entwurf 1851, April 27. Hundwil. Gesetz über das Strassenwesen, 2. Entwurf 1852, April 25. Trogen. Umwandlung der gesetzlichen Geldansatze in neue Schweizerwährung 1854, April 30. -

Blickpunkt Oktober 2020.Pdf
Blickpunkt Grub Mitteilungen aus der Gemeinde Grub AR Nr. 659 | 30. Oktober 2020 Liebi Grueberinne ond Grueber, gschätzti Leserinne ond Leser vom Blickpunkt Herbst: Die Blätter fallen, fallen wie von weit, als welkten in den Himmeln ferne Gärten ... So fängt ein bekanntes Gedicht an, das an die dritte Jahreszeit erinnert. Herbst, eine Zeit auch um sich langsam auf die eher ruhi- gere und stillere Jahreszeit vorzubereiten. Herbst, auch eine Zeit, schon mal zurück zu schauen, was das Jahr so brachte. 2020, ein ver- rücktes Jahr bis jetzt. Ich denke, anfangs Jahr konnte sich noch nie- mand vorstellen, was da noch alles auf uns zukommen wird. Editorial Bei mir selbst ist doch auch einiges anders geworden, angefan- gen vor rund drei Jahren. Auf der Suche nach einem Eigenheim für die Familie stiessen wir auf ein Inserat, das auf ein Haus in der Grub hinwies. Nach anfänglichem Zögern bezüglich dem Standort Grub entschlossen wir uns dennoch, es wenigstens einmal anzuschauen. Mit Erstaunen konnten wir feststellen, dass Grub verkehrstechnisch Bruno Tanner Gemeinderat doch ganz gut lag; zehn Minuten auf die Autobahn oder nach Rorschach und eine Busverbindung bis spät in die Nacht hinein für Besuche an die OLMA/OFFA waren schon gute Argumente. In der Zwischenzeit sind wir zu dritt und fühlen uns hier schon sehr wohl und heimelig. Mit der Wahl in den Gemeinderat von diesem Frühling ging für mich ein neues Kapitel los. Mit dem «Hochbau» ist da etwas ganz neues dazugekommen. Für mich mit technischem Hintergrund ist es vom Grundgedanken her nicht so fremd, wenn auch der Inhalt komplett neu ist. -
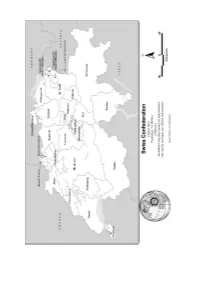
Gdbook7-Swissconfederation.Pdf
11_Swiss.fm Page 320 Wednesday, February 17, 2010 12:39 PM 11_Swiss.fm Page 321 Wednesday, February 17, 2010 12:39 PM Swiss Confederation thomas fleiner and maya hertig Like the United States, the Swiss federation was created from the bottom up, based on a covenant (foedus) uniting formerly independent states. However, while the framers of the United States Constitution chose feder- alism mainly to strengthen local democracy and limit government powers with a view to protecting individual liberty, Swiss federalism was designed primarily to accommodate communal diversity and to provide for peaceful management of deeply rooted conflicts among adherents of different reli- gious, cultural, and political traditions. Federalism implies the existence of at least two orders of government and some autonomy of the constituent units. Given that the constituent units (called cantons) in Switzerland are themselves internally diverse and fragmented, they, too, had to develop strategies of conflict management based on substantial powers of their municipalities. Thus, the Swiss federal polity is composed of three orders of government. introductory overview With a surface area of 41,290 square kilometres and a population of 7.3 mil- lion, Switzerland is a small European country whose neighbours are France, Germany, Italy, Austria, and Lichtenstein. It is composed of twenty-six cantons1 varying greatly in size, population, history, language, and culture. There are four national languages – German (spoken by 64 percent of the population), French (20 percent), Italian (6.5 percent), and Romansh (0.5 percent) – and two major religions (42 percent Roman Catholics and 33 percent Protestants), not to mention the tiny minority of Jewish and Old Catholic inhabitants. -

73 Beschlussprotokoll
ZENTRALSCHWEIZER REGIERUNGSKONFERENZ Beschlussprotokoll der 73. Zentralschweizer Regierungskonferenz vom Donnerstag, den 20. November 2003, 0830 bis 1130 Uhr, in Luzern, Hotel Schweizerhof Vorsitz: Landammann Dr. Gabi Huber, Vizepräsidentin Kanton Luzern Kanton Nidwalden Schultheiss Dr. Markus Dürr Landammann Beat Fuchs Statthalter Dr. Kurt Meyer Landesstatthalter Gerhard Odermatt Regierungsrat Max Pfister Regierungsrätin Lisbeth Gabriel-Blättler Regierungsrat Dr. Anton Schwingruber Regierungsrat Paul Niederberger Regierungsrätin Yvonne Schärli Regierungsrätin Beatrice Jann-Odermatt Regierungsrat Dr. Leo Odermatt Kanton Uri Regierungsrat Beat Tschümperlin Landammann Dr. Gabi Huber Landschreiber Josef Baumgartner Landesstatthalter Josef Arnold Regierungsrat Isidor Baumann Kanton Zug Regierungsrat Oskar Epp Statthalterin Brigitte Profos Regierungsrat Martin Furrer Regierungsrat Joachim Eder Regierungsrat Peter Mattli Regierungsrat Hanspeter Uster Regierungsrat Dr. Markus Stadler Regierungsrat Hans-Beat Uttinger Landschreiber Dr. Tino Jorio Kanton Schwyz Landesstatthalter Kurt Zibung Kanton Zürich Regierungsrat Lorenz Bösch Regierungsrätin Dorothée Fierz Regierungsrätin Regine Aeppli Kanton Obwalden Staatsschreiber Beat Husi Landammann Maria Küchler-Flury Landstatthalter Elisabeth Gander-Hofer Regierungsrat Hans Hofer Sekretariat ZRK Regierungsrat Hans Wallimann Vital Zehnder, Konferenzsekretär Landschreiber Urs Wallimann Madeleine Meier, Aussenbeziehungen Kt Luzern [Aktennotiz] Zentralschweizer Regierungskonferenz Dorfplatz 2 6371 Stans