Vom Dilemma Zum Trilemma
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Die Älteste Darstellung Der Landsgemeinde Von Appenzell Ausserrhoden
Die älteste Darstellung der Landsgemeinde von Appenzell Ausserrhoden Autor(en): Steinmann, Eugen Objekttyp: Article Zeitschrift: Unsere Kunstdenkmäler : Mitteilungsblatt für die Mitglieder der Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte = Nos monuments d’art et d’histoire : bulletin destiné aux membres de la Société d’Histoire de l’Art en Suisse = I nostri monumenti storici : bollettino per i membri della Società di Storia dell’Arte in Svizzera Band (Jahr): 15 (1964) Heft 2 PDF erstellt am: 26.09.2021 Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-392847 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch http://www.e-periodica.ch DIE ÄLTESTE DARSTELLUNG DER LANDSGEMEINDE VON APPENZELL AUSSERRHODEN Mancher Besucher von Trogen mag sich über das herrschaftliche Aussehen des Pfarr- und Gemeindehauses wundern. -

Liberal and Radical Democracies: the Swiss Cantons Compared
World Political Science Review 2014; 10(2): 385–423 Marc Bühlmann*, Adrian Vatter, Oliver Dlabac and Hans-Peter Schaub Liberal and Radical Democracies: The Swiss Cantons Compared Abstract: This article examines the widespread hypothesis that German-speak- ing Swiss cantons exhibit radical-democratic characteristics, while the Latin cantons possess stronger liberal-representative democratic profiles. Empirical and multi-dimensional measuring of the quality of democracy in the cantons shows that this hypothesis does not do the complexity of cantonal democracy justice. Today’s position of the cantons along the axes of liberal and radical democracy is best explained with reference to the strong liberal and democratic constitutional movements within the cantons during the middle of the 19th century. Keywords: measuring the quality of democracy; liberal democracy; radical democracy; Switzerland; path dependence (Erblast hypothesis). DOI 10.1515/wpsr-2014-0017 1 Introduction A key concern of empirical research on democracy is to assess and compare different types of political regimes. Measuring democracy plays a prominent role. Its origins lie in the works of Lipset (1959) and Dahl (1956) and have been continued and developed in numerous other studies (for a summary see: Lauth 2004; Pickel and Pickel 2006). The existing empirical works distinguish them- selves noticeably in that they focus almost exclusively on the national level while the subnational level is practically ignored. This gap in the research *Corresponding author: Marc Bühlmann, Institute of Political Science, University of Bern, Switzerland, e-mail: [email protected] Adrian Vatter and Hans-Peter Schaub: Institute of Political Science, University of Bern, Switzerland Oliver Dlabac: Department of Political Science, University of Zurich, Switzerland 386 Marc Bühlmann et al. -

Local and Regional Democracy in Switzerland
33 SESSION Report CG33(2017)14final 20 October 2017 Local and regional democracy in Switzerland Monitoring Committee Rapporteurs:1 Marc COOLS, Belgium (L, ILDG) Dorin CHIRTOACA, Republic of Moldova (R, EPP/CCE) Recommendation 407 (2017) .................................................................................................................2 Explanatory memorandum .....................................................................................................................5 Summary This particularly positive report is based on the second monitoring visit to Switzerland since the country ratified the European Charter of Local Self-Government in 2005. It shows that municipal self- government is particularly deeply rooted in Switzerland. All municipalities possess a wide range of powers and responsibilities and substantial rights of self-government. The financial situation of Swiss municipalities appears generally healthy, with a relatively low debt ratio. Direct-democracy procedures are highly developed at all levels of governance. Furthermore, the rapporteurs very much welcome the Swiss parliament’s decision to authorise the ratification of the Additional Protocol to the European Charter of Local Self-Government on the right to participate in the affairs of a local authority. The report draws attention to the need for improved direct involvement of municipalities, especially the large cities, in decision-making procedures and with regard to the question of the sustainability of resources in connection with the needs of municipalities to enable them to discharge their growing responsibilities. Finally, it highlights the importance of determining, through legislation, a framework and arrangements regarding financing for the city of Bern, taking due account of its specific situation. The Congress encourages the authorities to guarantee that the administrative bodies belonging to intermunicipal structures are made up of a minimum percentage of directly elected representatives so as to safeguard their democratic nature. -
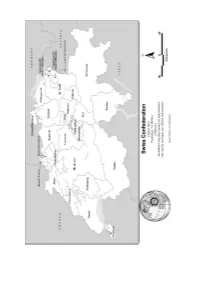
Gdbook7-Swissconfederation.Pdf
11_Swiss.fm Page 320 Wednesday, February 17, 2010 12:39 PM 11_Swiss.fm Page 321 Wednesday, February 17, 2010 12:39 PM Swiss Confederation thomas fleiner and maya hertig Like the United States, the Swiss federation was created from the bottom up, based on a covenant (foedus) uniting formerly independent states. However, while the framers of the United States Constitution chose feder- alism mainly to strengthen local democracy and limit government powers with a view to protecting individual liberty, Swiss federalism was designed primarily to accommodate communal diversity and to provide for peaceful management of deeply rooted conflicts among adherents of different reli- gious, cultural, and political traditions. Federalism implies the existence of at least two orders of government and some autonomy of the constituent units. Given that the constituent units (called cantons) in Switzerland are themselves internally diverse and fragmented, they, too, had to develop strategies of conflict management based on substantial powers of their municipalities. Thus, the Swiss federal polity is composed of three orders of government. introductory overview With a surface area of 41,290 square kilometres and a population of 7.3 mil- lion, Switzerland is a small European country whose neighbours are France, Germany, Italy, Austria, and Lichtenstein. It is composed of twenty-six cantons1 varying greatly in size, population, history, language, and culture. There are four national languages – German (spoken by 64 percent of the population), French (20 percent), Italian (6.5 percent), and Romansh (0.5 percent) – and two major religions (42 percent Roman Catholics and 33 percent Protestants), not to mention the tiny minority of Jewish and Old Catholic inhabitants. -

Innerrhoder Landsgemeinde
Innerrhoder Landsgemeinde Am letzten Sonntag im April versammeln sich die stimm- berechtigten Innerrhoderinnen und Innerrhoder in Ap- penzell zur Landsgemeinde. Am Vormittag findet der Landsgemeindegottesdienst statt, an dem auch die Mit- glieder der Standeskommission (Kantonsregierung) und des Kantonsgerichts sowie die Ehrengäste teilnehmen. Punkt zwölf Uhr beginnt der Aufzug der Standeskom- mission, des Kantonsgerichts und der Ehrengäste vom Rathaus zum Landsgemeindeplatz. Angeführt werden sie von der Musikgesellschaft Harmonie Appenzell, die einen langsamen Marsch spielt. Die Rhodsfähnriche und Junker der sieben Innerrhoder Rhoden geben mit ihren Uniformen und Fahnen dem Aufzug eine farben- Die Landsgemeinde (© Marc Hutter / Kanton Appenzell Inner- prächtige Note. Die Behördenmitglieder tragen den rhoden, 2002) schwarzen Amtsmantel, die Männer zusätzlich das Sei- tengewehr (Säbel oder Degen) und einen Hut. Sobald die grosse Glocke vom nahen Kirchturm verklungen ist, eröffnet der regierende Landammann die Landsge- meinde mit einer Ansprache. Nach der Wahl der beiden Landammänner schwören Landammann und Landvolk Verbreitung AI im feierlichsten Akt der Landsgemeinde den Landsge- meindeeid. Vor den Abstimmungen über die Sachge- Bereiche Gesellschaftliche Praktiken schäfte (Verfassungs-, Gesetzes- und Kreditvorlagen) Version Juni 2018 werden die Mitglieder der Standeskommission und des Kantonsgerichts bestätigt oder neu gewählt. Bei den Autoren Roland Inauen, Franziska Ebneter Kast Sachvorlagen haben die Stimmberechtigten die Mög- lichkeit, das Wort zu ergreifen und für oder gegen die Vorlage zu argumentieren. Nach der Landsgemeinde er- folgt der Abzug in gleicher Weise wie der Aufzug. Die Liste der lebendigen Traditionen in der Schweiz sensibilisiert für kulturelle Praktiken und deren Vermittlung. Ihre Grundlage ist das UNESCO-Übereinkommen zur Bewahrung des immateriellen Kulturerbes. Die Liste wird in Zusammenarbeit und mit Unterstützung der kantonalen Kulturstellen erstellt und geführt. -

Armed Election in Switzerland : the Landsgemeinde, the Original Form of Democracy in Switzerland
Armed Election in Switzerland : the Landsgemeinde, the Original Form Of Democracy In Switzerland Autor(en): Thürer, George Objekttyp: Article Zeitschrift: The Swiss observer : the journal of the Federation of Swiss Societies in the UK Band (Jahr): - (1950) Heft 1137 PDF erstellt am: 27.09.2021 Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-690419 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch http://www.e-periodica.ch 5510 THE SWISS OBSERVER June 9th, 1950. ARMED ELECTION IN SWITZERLAND. on which the " Landainmann " (the president of the cantonal leans the The Landsgemeinde, The Original Form Of government) during proceedings. Then come, in solemn procession, the five cantonal Democracy In Switzerland. -

Development of Direct Democracy in Swiss Cantons Between 1997 and 2003
Munich Personal RePEc Archive Development of Direct Democracy in Swiss Cantons between 1997 and 2003 Fischer, Justina AV University of Hohenheim 8 July 2009 Online at https://mpra.ub.uni-muenchen.de/16140/ MPRA Paper No. 16140, posted 10 Jul 2009 00:42 UTC Development of Direct Democracy in Swiss Cantons between 1997 and 2003 Justina AV Fischer University of Hohenheim Abstract This paper describes institutions of direct democracy between 1997 and 2003 in 26 Swiss cantons (states), specifically the statutory initiative and referendum, the constitutional initiative, and the fiscal referendum. In particular, it discusses their applications, but also the legal requirements for making use of them, including the signature requirements, the time available for their collection, and the financial thresholds. Optional and mandatory forms of these direct-legislative institutions are distinguished. This paper also provides calculations of the index and sub-indices of direct democracy for the additional years 1997 to 2003, in continuation of Stutzer (1999), using the identical methodology. Extending Trechsel and Serdült (1999) and Stutzer (1999) this paper includes the political institutions of the so-called Landsgemeinde cantons. Description of these institutions is based on the author‟s reading of 26 cantonal constitutions in their versions between 1997 and 2003. JEL-codes: H11; H73; K19; H40; H72; N40; D70; I31 Keywords: institutions; direct democracy; direct legislation; initiative; referendum; fiscal referendum; constitution; Switzerland: culture [email protected] and [email protected] , at the time of writing: University of St. Gallen, Switzerland. Current main affiliation: Chair for Household and Consumer Economics, University of Hohenheim, Fruwirthstrasse 48, Kavaliershaus 4 112, DE-70599 Stuttgart, Germany. -

The Distribution of Powers in Switzerland Will Notice, at First View, the Country’S Astonishing Difference from All Other Federal Countries
From: Distribution of Powers and Responsibilities in Federal Countries Book 2 in the series Global Dialogue on Federalism SWISS CONFEDERATION Thomas Fleiner Switzerland’s federal constitution, adopted in 1848 after a civil war, was a compromise that sought to accommodate both the liberals (mainly Protestants) promoting a unitary state and the conservatives (mainly Roman Catholics) defending the former Confederation. In addition, the Constitution had to accommodate the linguistic diversity among the four official language groups.i Based on a highly decentralized federalism, the Cantons (the constituent units of the federation) maintained their far-reaching original autonomy, now as self-rule within a federation, and continued to share their sovereignty with the federation. The constitutional concept of Switzerland’s distribution of powers reflects a “bottom-up” construction of the federation and depends, finally, on the residual powers of the Cantons and, in some instances, even municipalities. As a logical consequence the Swiss Constitution does not distribute the powers between the Confederation and the Cantons in a final list, and it does not provide powers for the Cantons.ii In principle it determines exclusively the powers delegated to the Confederation.iii Where new powers are delegated to the federal government, they are formulated carefully so that, even within a delegated power, the Cantons still retain some part of their sovereignty. This chapter first addresses the basic constitutional principles behind Swiss federalism and the principal guidelines for the distribution of powers before taking a more in-depth look at the system of distribution of powers, including the autonomy of the Cantons and the specific powers of the Confederation, one of which (i.e., the fiscal system) has undergone important changes as a result of a referendum in late November 2004. -

Development of Direct Democracy in Swiss Cantons Between 1997 and 2003
CORE Metadata, citation and similar papers at core.ac.uk Provided by Research Papers in Economics MPRA Munich Personal RePEc Archive Development of Direct Democracy in Swiss Cantons between 1997 and 2003 Fischer, Justina AV University of Hohenheim 08. July 2009 Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/16140/ MPRA Paper No. 16140, posted 09. July 2009 / 01:11 Development of Direct Democracy in Swiss Cantons between 1997 and 2003 Justina AV Fischer University of Hohenheim Abstract This paper describes institutions of direct democracy between 1997 and 2003 in 26 Swiss cantons (states), specifically the statutory initiative and referendum, the constitutional initiative, and the fiscal referendum. In particular, it discusses their applications, but also the legal requirements for making use of them, including the signature requirements, the time available for their collection, and the financial thresholds. Optional and mandatory forms of these direct-legislative institutions are distinguished. This paper also provides calculations of the index and sub-indices of direct democracy for the additional years 1997 to 2003, in continuation of Stutzer (1999), using the identical methodology. Extending Trechsel and Serdült (1999) and Stutzer (1999) this paper includes the political institutions of the so-called Landsgemeinde cantons. Description of these institutions is based on the author‟s reading of 26 cantonal constitutions in their versions between 1997 and 2003. JEL-codes: H11; H73; K19; H40; H72; N40; D70; I31 Keywords: institutions; direct democracy; direct legislation; initiative; referendum; fiscal referendum; constitution; Switzerland: culture [email protected] and [email protected] , at the time of writing: University of St. -

Die Einführung Des Frauenstimmrechts Im Kanton Appenzell Innerrhoden
Masterarbeit zur Erlangung des akademischen Grades Master of Arts in Allgemeiner Geschichte der Philosophischen Fakultät der Universität Zürich Die Einführung des Frauenstimmrechts im Kanton Appenzell Innerrhoden Verfasser: Orlando Caduff Matrikel-Nr.: 08-705-790 Referent: Prof. Dr. Jörg Fisch Abgabedatum: 29.04.2013 Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung ......................................................................................................................... 4 2. Die politischen Institutionen des Kantons Appenzell Innerrhoden ............................ 6 2.1. Die Landsgemeinde in Appenzell Innerrhoden ................................................................... 7 2.2. Der Grosse Rat des Kantons Appenzell Innerrhoden ........................................................ 8 2.3. Die Standeskommission – die Regierung Innerrhodens ..................................................... 9 2.4. Die innerrhodischen Bezirke ................................................................................................. 9 2.5. Parteien und Verbände als Akteure der innerrhodischen Politik ................................... 10 3. Der Kanton Appenzell Innerrhoden und das Frauenstimmrecht bis 1982 .............. 11 3.1 Die gescheiterte Einführung des Frauenstimmrechts in den Schul- und Kirchgemeinden 1969-1970 ........................................................................................................ 11 3.2. Die Einführung des Frauenstimmrechts auf eidgenössischer Ebene 1971 ..................... 13 3.3. Die Einführung -

Die Aargauer Gemeindeversammlungen
Philippe E. Rochat Die Aargauer Gemeindeversammlungen Empirische Analyse der Einwohnergemeindeversammlungen 2013 bis 2016 Studienberichte des Zentrums für Demokratie Aarau, Nr. 14 März 2019 www.zdaarau.ch Impressum Publikationsreihe des Zentrums für Demokratie Aarau (ZDA) Herausgegeben von Andreas Glaser, Daniel Kübler und Monika Waldis ISBN-Nr: 978-3- 906918-14-3 Bezugsadresse: Zentrum für Demokratie Aarau (ZDA) Villa Blumenhalde, Küttigerstrasse 21 CH-5000 Aarau Telefon +41 62 836 94 44 E-Mail [email protected] www.zdaarau.ch © 2019 beim Autor Die Aargauer Gemeindeversammlungen I Das Wichtigste in Kürze Das System der Gemeindeversammlung ist in der Schweiz weit verbreitet, geniesst insgesamt viel Sympathie und stösst auf breite Akzeptanz. Gleichwohl werden immer wieder Vorbehalte vorgebracht. Kritisiert werden etwa die tiefe Beteiligung und dass das Versammlungssystem anfällig sei für emotionsgeladene Debatten, sozialen Druck und aus der Situation erwachsene, nicht rationale Entscheidungen. Tatsächlich existiert aber nur wenig gesichertes Faktenmaterial zur Versammlungsdemokratie auf kommunaler Ebene. Diesem Umstand nimmt sich der vorliegende Studienbericht an. Er basiert auf der Doktorarbeit des Autors an der Universität Zürich, in deren Rahmen Daten von über 1600 Gemeindeversammlungen in 203 Gemeinden des Kantons Aargau über einen Zeitraum von vier Jahren gesammelt und analysiert wurden. In den Aargauer Gemeinden mit Gemeindeversammlung beträgt die durchschnittliche Beteiligung rund neun Prozent, wobei sich die Werte je nach Gemeinde -

I. Al Li Eii Swiss Legal Culture
Marc Thommen Introduction to Swiss Law Edited by Daniel Hürlimann und Marc Thommen Volume 2 Marc Thommen Introduction to Swiss Law Editor: Prof. Dr. iur. Marc Thommen Zurich, Switzerland This work has been published as a graduate textbook in the book series sui generis, edited by Daniel Hürlimann and Marc Thommen (ISSN 2569-6629 Print, ISSN 2625-2910 Online). The German National Library (Deutsche Nationalbibliothek) lists this work in the Deutsche Nationalbibliografie; detailed bibliographic data is available in the internet via http://dnb.d-nb.de. © 2018 Prof. Dr. Marc Thommen, Zurich (Switzerland) and the authors of the respective chapters. This work has been published under a Creative Commons license as Open Access which requires only the attribution of the authors when being reused. License type: CC-BY 4.0 – more information: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ DOI:10.24921/2018.94115924 Cover image credits: "5014 Gretzenbach" from the book Heimatland © 2018 Julian Salinas and Ursula Sprecher (http://www.juliansalinas.ch). Cover design: © 2018 Egbert Clement The font used for typesetting has been licensed under a SIL Open Font License, v 1.1. Printed in Germany and the Netherlands on acid-free paper with FSC certificate. The present work has been carefully prepared. Nevertheless, the authors and the publisher assume no liability for the accuracy of information and instructions as well as for any misprints. Lectorate: Chrissie Symington, Martina Jaussi Print and digital edition produced and published by: Carl Grossmann Publishers, Berlin, Bern www.carlgrossmann.com ISBN: 978-3-941159-23-5 (printed edition, paperback) ISBN: 978-3-941159-26-6 (printed edition, hardbound with jacket) ISBN: 978-3-941159-24-2 (e-Book, Open Access) v Preface A man picks an apple from a tree behind a bee house in Gretzenbach, a small village between Olten and Aarau.