Johannes Fried
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
Britain and the Dutch Revolt 1560–1700 Hugh Dunthorne Frontmatter More Information
Cambridge University Press 978-0-521-83747-7 - Britain and the Dutch Revolt 1560–1700 Hugh Dunthorne Frontmatter More information Britain and the Dutch Revolt 1560–1700 England’s response to the Revolt of the Netherlands (1568–1648) has been studied hitherto mainly in terms of government policy, yet the Dutch struggle with Habsburg Spain affected a much wider commu- nity than just the English political elite. It attracted attention across Britain and drew not just statesmen and diplomats but also soldiers, merchants, religious refugees, journalists, travellers and students into the confl ict. Hugh Dunthorne draws on pamphlet literature to reveal how British contemporaries viewed the progress of their near neigh- bours’ rebellion, and assesses the lasting impact which the Revolt and the rise of the Dutch Republic had on Britain’s domestic history. The book explores affi nities between the Dutch Revolt and the British civil wars of the seventeenth century – the fi rst major challenges to royal authority in modern times – showing how much Britain’s chang- ing commercial, religious and political culture owed to the country’s involvement with events across the North Sea. HUGH DUNTHORNE specializes in the history of the early modern period, the Dutch revolt and the Dutch republic and empire, the his- tory of war, and the Enlightenment. He was formerly Senior Lecturer in History at Swansea University, and his previous publications include The Enlightenment (1991) and The Historical Imagination in Nineteenth-Century Britain and the Low Countries -

International Workshop 10–11 June 2021, 16.00–19.00 (Gmt+1)
TRANSFER OF KNOWLEDGE — TRANSFER OF IDEAS — TRANSFER OF EXPERIENCES LATIN TRANSLATIONS OF GREEK TEXTS FROM THE 11TH TO THE 13TH CENTURY INTERNATIONAL WORKSHOP 10–11 JUNE 2021, 16.00–19.00 (GMT+1) Organizers: Paraskevi Toma (University of Münster) Péter Bara (Hungarian Academy of Sciences) Realizing the fact that there are different factors that influence translations, we set the dynamics of linguistic and cultural exchange from Greek into Latin as the focus of our workshop. Even though the knowledge of Latin in Byzantium dropped notably after the sixth century, it was surrounded by Latin-speaking territories, while a multilingual community continued to exist in Italy. Furthermore, the Crusades strengthened the ties between the Eastern and Western Mediterranean, a fact that unavoidably entailed knowledge transfer from Greek into Latin. The workshop will examine translators as mediators of knowledge and translated texts as sources of direct as well as indirect/intertextual knowledge. Rich material can be found, for example, in the fields of theology, medicine, and law. As regards translators, we will discuss their educational background and literacy, their networks and social status, along with their (in many cases) multicultural identity. Regarding translated texts, we will explore their literary genre as part of contemporary political or religious dialogue, identify Greek linguistic variants that were adapted by the Latin language, and finally consider the impact of translators themselves on their translations. Further questions to be discussed during the workshop are: v Who commissioned translations and for what purpose? v Did the translators follow a particular translation technique or school? v What role did these persons play as interpreters and as translators? v How have translations of legal and religious texts been used in multilingual environments? v Did translations/interpretations affect political or religious decisions or even cause controversies? * Add MS 47674 (c. -

ENGLISH NAVAL STRATEGY INTHE 1590S
ENGLISH NAVAL STRATEGY INTHE 1590s SIMÓN ADAMS Profesor de Historia de la Universidad de Strathclyde Until quite recently, the Anglo-Spanish "War" in the period after the Armada of 1588 was one of the least studied subjects of the reign of Elizabeth. For many years, the standard narrative account of the 1590s was that published by the American historian E.P. Cheyney in two volumes in 1914 and 1926 (1). In the past decade, however, this situation has been transformed. Professor Wernham's edition of the List and Analysis ofState Papers Foreign Series (2) has been followed by his detailed study of military operations and diplomacy in the years 1588-1595 (3), and then by his edition of the documents relating to the "Portugal Voyage" of 1589 (4). Within the past two years, Professor MacCaffrey has published the final volume of his trilogy on Elizabeth's reign and Professor Loades his monograph on the Tudor Navy, while Dr. Hammer has completed his dissertation on the most controversial of the political figures of the decade, the 2nd Earl of Essex (5). Much therefore is a good deal clearer than it has been. Yet wider questions remain, particularly over the manner in which Elizabeth's government conducted the war with Spain. In their most recent work both Wernham and MacCaffrey argüe from positions they have established earlier: Wernham for a careful and defensive foreign and military policy, MacCaffrey for an essentially reactive one (6). This is a debate essentially about the queen herself, a particulary difficult The place of publication is understood to be London unless otherwise noted. -

HMGS Fall 2010 Newsletter.Pub
THE LOCAL NEWSLETTER FOR THE HMGS-Midwest MINIATURE WARGAMING ENTHUSIAST VOLUME 4 ISSUE 6 F A L L 2 0 1 0 BOD Update - Fall 2010 by Jeff Cohen For those that read the dors an accurate assess- vention. We will also at- news letter but have ment of how many atten- tempt to run ads in many not learned the ews...Little dees come to Little Wars local colleges and universi- Wars is moving. We have and our efforts to bring ties. We will also have fly- signed a two year contract more attendees to the con- ers printed out and avail- with the Pheasant vention, and to attract new able for download from our gamers into the hobby. website. This will allow all INSIDE THIS Run Resort in St Charles Illinois. The primary reason We will run an aggressive HMGS-Midwest members I S S U E : for the move being that promotional campaign to to download and print off BOD Update 1 The Lincolnshire Marriott flyers and distribute them was asking for a 300% in- to local business. We will crease in the rental cost of also aggressively seek out Luther Con 2 their facility. We could not great games for the enjoy- AAR negotiate a price that was ment of one and all. acceptable to us so we Without volunteers we LW 2011 Help 2 found another location for would not have a conven- Needed the convention. tion. We especially need I will be assuming the pri- volunteers to help out at The Dutch mary duties as Convention 3 the front desk during the Revolt/Eighty Director for the 2011 Con- convention. -

The Spanish Match and Jacobean Political Thought, 1618-1624
Opposition in a pre-Republican Age? The Spanish Match and Jacobean Political Thought, 1618-1624 Kimberley Jayne Hackett Ph.D University of York History Department July 2009 Abstract Seventeenth-century English political thought was once viewed as insular and bound by a common law mentality. Significant work has been done to revise this picture and highlight the role played by continental religious resistance theory and what has been termed 'classical republicanism'. In addition to identifying these wider influences, recent work has focused upon the development of a public sphere that reveals a more socially diverse engagement with politics, authority and opposition than has hitherto been acknowledged. Yet for the period before the Civil War our understanding of the way that several intellectual influences were interacting to inform a politically alert 'public' is unclear, and expressions of political opposition are often tied to a pre-determined category of religious affiliation. As religious tension erupted into conflict on the continent, James I's pursuit ofa Spanish bride for Prince Charles and determination to follow a diplomatic solution to the war put his policy direction at odds with a dominant swathe of public opinion. During the last years of his reign, therefore, James experienced an unprecedented amount of opposition to his government of England. This opposition was articulated through a variety of media, and began to raise questions beyond the conduct of policy in addressing fundamental issues of political authority. By examining the deployment of political ideas during the domestic crisis of the early 1620s, this thesis seeks to uncover the varied ways in which differing discourses upon authority and obedience were being articulated against royal government. -

9 a Hidden Source of the Prologue to the I-Ii of The
A HIDDEN SOURCE OF THE PROLOGUE TO THE I-II OF THE SUMMA THEOLOGIAE OF ST. THOMAS AQUINAS MARGHERITA MARIA ROSSI* – TEODORA ROSSI** Pontifical University St Thomas Aquinas, Rome ABSTRACT This article1 investigates a particular aspect of the well-known quotation that opens the Prologue of the Prima Secundae of the Summa Theologiae. For scholars of St. Thomas Aquinas and the Middle Ages, the history of the introduction and story of the translation of the quoted text from St. John Damascene is a matter of undisputed interest. In particular, the cu- rious addition to the Damascene quote, not found in the translations cir- culating at the time Aquinas wrote the Prologue, nor even in the work of other contemparies, presents itself as an enigma. Although the practice of citation in the Middle Ages included taking some liberties from the text itself, it should be noted that this does not mean that it was done without rules or reason. In fact, the citations were chosen and presented in such a way as to respond to the most pressing * Contact: [email protected] ** Contact: [email protected] 1. The authors are deeply indebted to Father Peter Marsalek, SOLT, for graciously volunteering to translate the article into English. Thanks to his Thomistic expertise, Father Marsalek has translated the nuances of a demanding centuries-old theological debate, one which involves Greek and Latin authors to whom St. Thomas Aquinas re- fers. Father Peter Marsalek’s linguistic mastery and his passionate commitment have managed to clarify the most crucial passages of the difficult Italian text. -

Revista Internacional D'humanitats 50 Mai-Ago 2020
Revista Internacional d’Humanitats 50 set-dez 2020 CEMOrOc-Feusp / Univ. Autònoma de Barcelona The translations from Greek into Latin in the Middle Age José Martínez Gázquez -UAB-RABLB1 [email protected] Resumo: O trabalho dos tradutores medievais do grego para o latim foi um fator importante na recuperação do pensamento científico medieval e de sua prática. A redescoberta das raízes comuns da cultura e da religião gerou grande entusiasmo na Itália e escolas de tradução foram sucessivamente abertas em Roma, Nápoles, Salerno, Pisa e Sicília. Seus membros resgataram para o Ocidente textos dos Padres da Igreja e textos técnicos e científicos da ciência grega. Palavras Chave: tradutores do grego para o latim. Textos religiosos e científicos. recuperação do conhecimento. Silvia Gasparian Colello. Faculdade de Educação da USP. Abstract: The work of the medieval translators from Greek to Latin was one of the important factors in the recovery of the medieval scientific thought and their practice. The rediscovery of the shared roots of culture and religion aroused great enthusiasm in Italy, and schools of translations were successively opened in Rome, Naples, Salerno, Pisa and Sicily. Its members recovered for the West lost Greek texts of the fathers of the Church and scientific-technical texts of Greek science. Keywords: Greek-Latin translators, religious and scientific texts, recovery of knowledge. The awareness of the widespread backwardness of the Latin West gradually took root among the scholars of the Early Middle Ages. In its different forms it pervaded cultural and scientific environments and even the sphere of religion. Gradually the Christians came to realize that they had lost the treasures of Greek patristic and hagiography and the works of Greek philosophy and science, and by the Early Middle Ages they saw the urgent need for Latin translations of the works of Greek philosophy and for the development of translations from Arabic . -

De Gulden Passer. Jaargang 82
De Gulden Passer. Jaargang 82 bron De Gulden Passer. Jaargang 82. Vereniging van Antwerpse Bibliofielen, Antwerpen 2004 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_gul005200401_01/colofon.php © 2016 dbnl i.s.m. 7 [De Gulden Passer 2004] Jeanine de Landtsheer & Marcus de Schepper De bibliotheek van Laevinus Torrentius, tweede bisschop van Antwerpen (1525-1595)* Laevinus Torrentius (Lieven vander Beke, Gent, 8 maart 1525 - Brussel, 26 april 1595) was een man met behoorlijk wat invloed op het humanistenmilieu in de Zuidelijke Nederlanden van de tweede helft van de zestiende eeuw.1 Hij verzekerde zijn naam als geleerde door een commentaar op de keizersbiografieën van de Latijnse biograaf Suetonius (ca. 70-ca. 130),2 die hij in 1592 opnieuw publiceerde in een sterk uitgebreide versie, nu aangevuld met een editie van Suetonius. Zijn plan om Horatius uit te geven, bleef steken bij de commentaar op de Ars poetica en verscheen pas postuum in 1608.3 Verder toonde Torrentius zich een verdienstelijk dichter die vlot weg kon met de verschillende versmaten uit de klassieke Latijnse poëzie. De eerste druk van deze Poemata Sacra verscheen bij Plantijn in Antwerpen in 1572, maar de steeds verder aangroeiende verzameling kende nog drie uitgaven, respectievelijk in 1575, 1579 en 1594. Naast Oden aan de vrienden uit de periode dat hij in Rome verbleef en gedichten naar aanleiding van historische gebeurtenissen als de slag bij Lepanto (1571), de moord op Willem de Zwijger (1584) en de inname van Antwerpen door Alexander Farnese (1585), ging Torrentius zich van langsom meer toeleggen op religieuze onderwerpen. Toen hij in de jaren tachtig steeds meer in beslag werd genomen door zijn beroepsbezigheden als rechterhand van de Luikse prins-bisschoppen en vanaf 1587 als tweede bisschop van Antwerpen, ging dat ten koste van zijn literaire activiteiten. -
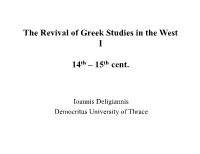
The Revival of Greek Studies in the West I 14Th – 15Th Cent
The Revival of Greek Studies in the West I 14th – 15th cent. Ioannis Deligiannis Democritus University of Thrace • Introduction – Greek in the Middle Ages • The Early Humanism (14th cent.) • 15th cent. – Greek language teaching and learning methods • Chrysoloras’ Erotemata • Guarino da Verona and Battista Guarini • ms. Vat. Urb. Gr. 121 – Italian humanists who studied and/or translated Greek • Guarino Guarini da Verona • Leonardo Bruni • Vittorino da Feltre • Sassolo da Prato • Francesco Filelfo • Lapo da Castiglionchio the younger • Francesco Griffolini d’Arezzo • Lorenzo Valla • Marsilio Ficino • Angelo Poliziano • Other Italian translators Greek in the Middle Ages • Middle Ages Europe: Greek not generally known. • Interest in Latin translations of Greek texts: – Boethius (5th ex. – 6th in.): Aristotle. – John Scottus Eriugena (9th cent.): Gregory of Nyssa, Gregory of Nazianzus, and Maximus the Confessor. – Burgundio of Pisa (12th cent.): John of Damascus, John Chrysostom, Galen. – James of Venice (12th cent.): Aristotle. – Henricus Aristippus (12th cent.): Plato, Euclid, Ptolemy, Aristotle, Gregory of Nazianzus. • 13th cent: a better acquaintance with Greek. • Southern Italy remained the main bridge between Greeks and Latins. • Bartholomew of Messina: Aristotle. • Robert Grosseteste: revision of Burgundio’s translation of John of Damascus, and translations of other works of his, of Dionysius the Areopagite, Aristotle; articles from the Suda Lexicon. • Roger Bacon: wrote a Greek grammar for Latins, significant for the revival of the Greek studies in the West. • William of Moerbeke: translation of Aristotle or revision of existing translations; literal and faithful; classic in the 14th cent. He also translated mathematical treatises (Hero of Alexandria and Archimedes), commentaries of Simplicius, Proclus, etc. -

Ambassadors As Informants and Cultural Brokers Between Byzantium and the West (8Th to 12Th Centuries)
Nicolas Drocourt Ambassadors as Informants and Cultural Brokers between Byzantium and the West (8th to 12th Centuries) Scholars generally consider that diplomacy played a signifi - with Latin titles: the De administrando imperio and the De cant role in the longevity of the Byzantine Empire. Associated cerimoniis 1 . At the crossroads of normative and narrative with military activity, it constituted an undeniable element texts, offi cial correspondence and letters exchanged between explaining how and why the empire lasted for a millennium. chanceries are also fundamental for this subject. Yet we must Offi cial negotiations as well as secret discussions continued keep in mind that all these sources are biased is certain ways; until the very end of the state in 1453. The Byzantines called describing offi cial contacts was never neutral nor objective. themselves »Romans« (῾Ρωμαῖοι) and thought that their vari- Unfortunately, offi cial accounts of diplomatic missions ous neighbours remained barbarians – even the Christian and have not survived from the High Middle Ages, with one excep- Western Latin ones. Yet a quick glance at the extant sources tion: the account written by Liudprand of Cremona, Otto I’s shows that this binary opposition is false in most cases. Seen ambassador, sent to Constantinople in 968. His testimony from Constantinople, these barbarians were not of equal has sparked a great deal of debate among historians and led value; moreover, the basileis could adopt the traditional Ro- to numerous publications 2 . Liudprand’s text also shows the man practice of divide et impera toward them. It is clear that extent to which ambassadors were informants between the Byzantine diplomacy remained very active, involving contacts, different courts. -

University of Groningen Nederlandse Ingenieurs En De
University of Groningen Nederlandse ingenieurs en de fortificatiewerken in het eerste tijdperk van de Tachtigjarige Oorlog, 1573-1604 Westra, Frans IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below. Document Version Publisher's PDF, also known as Version of record Publication date: 1992 Link to publication in University of Groningen/UMCG research database Citation for published version (APA): Westra, F. (1992). Nederlandse ingenieurs en de fortificatiewerken in het eerste tijdperk van de Tachtigjarige Oorlog, 1573-1604. Groningen: s.n. Copyright Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons). Take-down policy If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum. Download date: 12-11-2019 Summary Dutch engineers and the fortifications in the first developments in fortifications and it was here that period of the Eighty Years War, 1573-1604 the pentagonal bastion, which originated from Byzantium, came into use in the beginning of the Due to legislation the major part of the fortifica 16th century. -

The Absence of America on the Early Modern Stage by Gavin R. Hollis A
The Absence of America on the Early Modern Stage by Gavin R. Hollis A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy (English Language and Literature) in The University of Michigan 2008 Doctoral Committee: Professor Valerie J. Traub, Chair Professor Michael C. Schoenfeldt Associate Professor Susan M. Juster Associate Professor Susan Scott Parrish © Gavin Hollis 2008 To my parents ii Acknowledgements In an episode of The Simpsons, Marge urges Bart not to make fun of graduate students because “they’ve just made a terrible life choice.” This may be true, but one of the many advantages of this “life choice” is that I have met, been inspired by, and become firm friends with an array of people on both sides of the pond. The first debt I owe is to my advisors at the University of Michigan, who have seen this project through its many stages of confusion and incoherence. Mike Schoenfeldt, Scotti Parrish, and Sue Juster have been supportive, critical, rigorous, inventive, and excellent company. My biggest debt of gratitude is owed however to Valerie Traub, the chair of my dissertation committee, whose influence on this project and has been, and I hope will continue to be, immense. I’m also indebted to faculty at Trinity Hall, Cambridge and at The Shakespeare Institute who have shaped me as a scholar before I made it these shores. I am especially grateful to Peter Holland, who, it is no exaggeration to say, taught me how to read Shakespeare. Thank you also to John Jowett, Drew Milne, and John Lennard.