Von Der Selbstisolation Zur Integration in Der Welt
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Verheißung Unbeschadeten Fortschritts Wird in Der Ideologie Der Kommu- UNIVERSITY PRESS Nistischen Partei Chinas (Kpch) Durchgängig Aufrechterhalten
Die Verheißung unbeschadeten Fortschritts wird in der Ideologie der Kommu- UNIVERSITY PRESS nistischen Partei Chinas (KPCh) durchgängig aufrechterhalten. Ideologeme bringen die Überzeugung der KPCh zum Ausdruck, dass Entwicklung und Fortschritt unter ihrer Lenkung plan- und durchführbar sind, Entwicklungsziele somit erreichbar werden und zukünftiger Fortschritt generiert werden kann. Ideologeme werden als Legitimationsinstrumente eingesetzt, die sowohl eine konkrete Handlung oder Aufforderung beinhalten, wie Ziele erreicht werden können, als auch auf der Überzeugung basieren, dass der Entwicklungsweg der VR China sowie der angestrebte Fortschritt richtig sind. Sie wirken sinn- stiftend in den jeweiligen Kontext hinein und ermöglichen, dass auch über die Äußerungen der Partei hinaus deren ideologische Inhalte Kontinuität behalten. Herausforderungen wie die Realisierung planungsintensiver Großprojekte mit weitreichenden wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Auswirkungen, z.B. der Bau von Atomkraftwerken oder des Drei-Schluchten-Staudamms, und das Erfordernis einer Auseinandersetzung mit der Nuklearkatastrophe von Fukushima und Naturkatastrophen, wie dem Erdbeben von Wenchuan, bieten Anlass für ein Hinterfragen des von der KPCh propagierten Fortschrittsdenkens. In der vorliegenden Arbeit werden Fortschritts- und Entwicklungsideologeme in der KPCh seit dem Jahr 1949 sowie ihr Aufscheinen in den Fallbeispielen, Diskussion der Atomenergie in der VR China, des Wenchuan-Erdbebens und FAU Studien aus der Philosophischen Fakultät 12 des Drei-Schluchten-Staudamm-Projektes, untersucht. Hierbei wird besonders der Diskurs kritischer Stimmen beleuchtet. Julia Hauser Verheißung unbeschadeten Fortschritts Verheißung Verheißung unbeschadeten Fortschritts ISBN 978-3-96147-164-5 Ideologeme und ihre Funktion in der VR China FAU UNIVERSITY PRESS 2018 FAU Julia Hauser UNIVERSITY PRESS Julia Hauser Verheißung unbeschadeten Fortschritts FAU Studien aus der Philosophischen Fakultät Band 12 Herausgeber der Reihe: Prof. -

The First “Non-Government” Visiting Scholars Delegate in United States
English translation of Chinese article published in Science & Culture Review (Beijing), Vol. 7, No. 2 (2010) pp. 84-94 ______________________________________________________________________________________________ The First “Non-Government” Visiting-Scholar Delegation in the United States of America from People’s Republic of China, 1979-1981 Lui Lam Department of Physics, San Jose State University, San Jose, CA 95192-0106, USA In February, 1979, a delegation of eight scientists from the Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, arrived in Evanston, and became the first group of “non-government” visiting scholars ever set foot in the USA since 1949. This group consists of Qian Yongjia (钱永嘉), LI Tiecheng (李铁成), ZHENG Jiaqi (郑家祺), SHEN Juelian (沈觉涟), WANG Dingsheng (王鼎盛), CHENG Bingying (程丙英), GU Shijie (顾世杰) and LIN Lei (林磊, Lui LAM). Lin stayed for three months while the rest of the group stayed for two years. The work by Lin at Northwestern University was later published in Physical Review Letters, the most prestige physics journal in the world, and became the first paper ever published in this journal by an author from China. Here, the background of the domestic situation in China and the international relationship between China and USA leading to the visit are summarized. The formation of this delegation of visiting scholars is described, followed by the 1979 visit itself. Lastly, the influence of the visit on the careers of the delegates afterwards and on the Chinese reform-opening up movement in general is given. Key words: Institute of Physics, Reform-Opening Up Movement, visiting scholars in USA, Baodiao Movement, Haigui, Physical Review Letters I. -

Mathematics Physics
ADVERTISEMENT FEATURE ADVERTISEMENT FEATURE Micius, developed by Pan’s team, is the world’s first quantum science CROSSING satellite. PHYSICS USTC has one of the most comprehensive individual proteins in living cells in real the understanding of glass transition from a physical science portfolios in China. Its School time. solid-state perspective. They discovered two- ©USTC PHYSICAL of Physical Sciences studies small particles The USTC team, led by CAS member Guo dimensional melting and were the first to and atoms, as well as astronomical bodies Guangcan, has focused on technologies for observe octagonal soft quasicrystals in high- and the universe, covering everything from quantum cryptography, quantum chips and density systems of soft-core particles. Using theoretical physics to photonics engineering, simulators. They simultaneously observed both novel biophysics tools, researchers have and from microelectronics to biophysics. the particle and wave natures of photons in measured the switching dynamics of flagellar Many of its programmes were established experiments, challenging the complementarity motors, which propel many bacteria. Their as USTC was founded, in 1958, by renowned principle proposed by Bohr. Their achievements results are published in high-profile journals, scientists of the time, such as Yan Jici and also include developing China’s first fibre such as Physical Review Letters and Nature BOUNDARIES n Qian Sanqiang. Today, USTC has integrated quantum key system; entangling eight photons Physics. The University of Science and Technology of China (USTC) has forged an excellent its physical science strengths and established using ultra-bright photon sources; and creating reputation for basic research in physical sciences. Now it is integrating those strengths to advanced research platforms, including Hefei the solid-state quantum memory with the develop exciting cross-disciplinary innovations. -

Cultures of Science ISSN 2096-6083 Cultures of Science CN 10-1524/G Volume 3
ISSN 2096-6083 CN 10-1524/G Cultures of Science ISSN 2096-6083 Cultures of Science CN 10-1524/G Volume 3 . Issue 2 June 2020 Volume 3 . Issue 2 . June Articles 97 Science, society and planning: Joseph Volume 3 . Issue 2 June Needham’s report to Chiang Kai-shek in 2020 77 Chinese astronomy in the time of the 1946 Volume 3 . Issue 2 June 2020 Jesuits: Studies following Science and Banghong Fu Civilisation in China 118 Report to His Excellency President and Yunli Shi Generalissimo Chiang Kai-Shek on the 85 Joseph Needham’s inspiration for Position and Prospects of Science and Volume 3 . Issue 2 June 2020 research on agricultural history in China Technology in China Siming Wang Joseph Needham CUL_3-2_Cover.indd 1 22/07/2020 7:41:12 PM Honorary Director of Editorial Board Members Journal Description Editorial Board Cultures of Science is a peer-reviewed international Open Access journal. The journal aims at building a community of scholars who Martin W Bauer, London School of Economics and Political Science, are expecting to carry out international, inter-disciplinary and cross-cultural communication. The topics include: cultural studies, science Qide Han, Chinese Academy of Sciences, China Association UK communication, the history and philosophy of science and all intersections between culture and science. The journal values the diversity for Science and Technology, China John Besley, Michigan State University, USA of cultures and welcomes manuscripts from around the world and especially those involving interdisciplinary topics. Massimiano Bucchi, University of Trento, Italy Director of Editorial Board Rui Chen, China Association for Science and Technology, China Michel Claessens, European Commission, Belgium Aims and Scope Yanhao Xu, China Association for Science and Technology, John Durant, Massachusetts Institute of Technology, USA Cultures of Science is an international journal that provides a platform for interdisciplinary research on all aspects of the intersections China Zhe Guo, China Association for Science and Technology, China between culture and science. -

PRC Official Activities Since Feb 1985 Guo Has Been Vice- Minister of the State Scientific and Technological Commission
CHINA aktuell/Official Activities - 233/1 - März/March 1990 GuoShuyan Appointed acting governor 01 Hubei Province. (XNA, Mar 2,1990) Since Feb 1985 Guo has been vice- PRC Official Activities minister of the State Scientific and Technological Commission. He was born in 1935 in Henan Province. In 1959 he graduated from the Metallurg- ical Department of Ural Institute of Engineering in USSR. items and meat. Supplies of household radio electronic equipment will also Guo Zhenqian AGREEMENTS WITH occupy a significant position among Appointed vice-governor of the Peo FOREIGN COUNTRIES Chinese exports to the Soviet Union. ple’s Bank of China. (XNA, Apr 3, (XNA, Mar 13. 1990; Tass, Mar 13, 1990) Wolfgang Bartke 1990; cit. SWB, Mar 16,1990) Guo was born in 1932 in Henan Prov ince. In 1954 he graduated from the Australia (Mar 19) Thailand (Mar 28) People’s University of China. Later he Cultural exchange for 1990-91 Agreement on mutual exemption from served in Financial and Trade De (XNA, Mar 19,1990) indirect taxation of revenue derived partments of Hubei Province. In 1986 from international transportation. he became governor and deputy Party Ethiopia (Mar 12) (XNA, Mar 28,1990) secretary of Hubei. The following year Protocol on China to send a new medi he was elected member of the CCP Yemen Arab Republic (Mar 17) cal team. Under it, the new team com- Central Committee. Executive program 1990-94 of Coope posed of 15 doctors from China’s He ration in education. nan Province will work in the hospital (XNA, Mar 17,1990) Hou Zongbin /? of Debre Berhan, 140 kilometres Appointed secretary 01 Henan Prov northeast of Addis Ababa. -
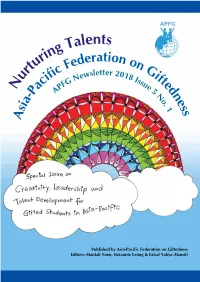
APFG 2018 Issue5 No1.Pdf
Nurturing Talents APFG Newsletter 2018 Issue 5 No. 1 Special Issue on Creativity, Leadership and Talent Development for Gifted Students in Asia-Pacific Published by Asia-Pacific Federation on Giftedness Editors: Mantak Yuen, Suzannie Leung & Faisal Yahya Alamiri CONTENTS APFG President's Address p.1 Kyungbin Park Developing Creativity in Children p.2-4 Usanee Anuruthwong Turkey: EPTS Center Finds its New Gifted and Talented Students p.5 Ugur Sak The Top-notch Program in Mainland China p.6-8 Shao Wang, Chengke Liu, Yan Kong The 15th Asia-Pacific Conference on Giftedness, 20-24 August 2018, Thailand p.9-10 Supaporn Sornampon APCG2018 Youth Camp “A memorable experience in Thailand” p.11-16 Supaporn Sornampon 2019 IRATDE Biennial Conference, 12–16 April, Taipei p.17-21 Ching-Chih Kuo Expanding Gifted Education for the Economically Disadvantaged Students in Korea p.22-23 Jiyoung Ryu Recent Research on Gifted Education in Singapore p.24-26 Liang See Tan Implementation of Acceleration in Schools in New Zealand p.27 Janna Wardman Gifted Awareness Week in Australia p.28 Jae Yup Jared Jung, Melinda Gindy Development of Education and Parent’s Advisory Program for Gifted Student in Indonesia p.29-31 Fitriani Yustikasari Lubis Seminar and Workshop Series on Differentiation: Professional Development Program on p.32-34 Gifted Education for Educators in Hong Kong Lai Kwan Chan Role-models for Gifted students – the Hong Kong Gifted Apprentices Program and the Senior Student Club p.35-37 Tai Kai Ng The 7th Annual Award of the Star Bright Scholarships for -

China's S&T Intellectuals in the Post-Mao
HD28 .M414 AD. ibtH-'o^ WORKING PAPER ALFRED P. SLOAN SCHOOL OF MANAGEMENT China's S&T Intellectuals in the Post-Mao Era; A Retrospective and Prospective Glimp se^ by Denis Fred Simon June 14, 1985 166 4 -85 MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY 50 MEMORIAL DRIVE CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139 (/ DRAFT China's S&T Intellectuals in the Post- Mao Era: A Retrospective and Prospective Glimpse by Denis Fred Simon June 14, 1985 166 4 -85 DRAFT China's S&T Intellectuals in the Post-Mao Era;/ " 7 A Retrospective and Prospective Glimpse Professor Denis Fred Sj. men Sloan School of Management Massachusetts Institute of Technology May 15, 1985 Paper prepared for volune edited by Merle Goldman, Chinese Intellectuals and the State: The Search for a New Relationship (Harvard U Press, forthconung) w "The most pressing problem confronting us is the unified arrangement and proper use of scientific and technical personnel." (Premier Zhao Ziyang, "Speech on the Work of the Government" to the 6th National People's Congress. June 6, 1983.)! The training and effective deployment of high caliber human resources is considered to be essential to the process of economic development. A pool of qualified individuals is needed to staff administrative offices, to provide advice to government officials, to educate the next generation, and to support industrial and agricultural development through efficient management and advances in science and technology. Harbison and Myers, in their seminal study of manpower and education in developing countries, refer to high quality manpower as a strategic resource. 2 They note, however, that most LDCs face severe human resource problems that seriously constrain their prospects for rapid development. -
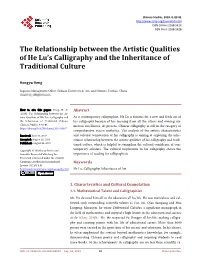
The Relationship Between the Artistic Qualities of He Lu's Calligraphy And
Chinese Studies, 2019, 8, 83-91 http://www.scirp.org/journal/chnstd ISSN Online: 2168-541X ISSN Print: 2168-5428 The Relationship between the Artistic Qualities of He Lu’s Calligraphy and the Inheritance of Traditional Culture Hongyu Deng Logistics Management Office, Sichuan University of Arts and Sciences, Dazhou, China How to cite this paper: Deng, H. Y. Abstract (2019). The Relationship between the Ar- tistic Qualities of He Lu’s Calligraphy and As a contemporary calligraphist, He Lu is famous for a new and fresh air of the Inheritance of Traditional Culture. his calligraphy because of his learning from all the others and owning nu- Chinese Studies, 8, 83-91. merous excellences. At present, Chinese calligraphy is still in the category of https://doi.org/10.4236/chnstd.2019.83007 comprehensive macro aesthetics. The analysis of the artistic characteristics Received: June 20, 2019 and cultural connotation of his calligraphy is aiming at exploring the inhe- Accepted: August 20, 2019 ritance relationship between the artistic qualities of his calligraphy and tradi- Published: August 23, 2019 tional culture, which is helpful to strengthen the cultural confidence of con- Copyright © 2019 by author(s) and temporary scholars. The cultural implication in his calligraphy shows the Scientific Research Publishing Inc. importance of reading for calligraphists. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International Keywords License (CC BY 4.0). http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ He Lu, Calligraphy, Inheritance of Art Open Access 1. Characteristics and Cultural Connotation 1.1. Mathematical Talent and Calligraphist Mr. He devoted himself to the education all his life. -

USTC DAY 2Nov21ustc
InnovativeInnovative TrainingTraining BasedBased onon StudentStudent NeedsNeeds Prof. Chen Chusheng Vice President of University of Science and Technology of China 21 September 2010 Inaugural Symposium of C9+1 Universities in China 中国科学技术大学 @ 2010 Outline 1 Changing social needs 2 Well-organized training 3 Individually-tailored study 4 Systemic innovations 中国科学技术大学 @ 2010 2 1. ChangingChanging socialsocial needsneeds With social and economic development, social needs for higher education have changed “National mid- & long- term education Φ Higher education in the process of being popularizeddevelopment plans” Year 2002 2006 2009 2015 2020 Rate of gross 15% 22% 24.2% 36% 40% college enrollment Φ Diversified needs on the part of students and their families Φ Diversified needs for talents demanded by social changes USTC offers well-organized, individually-tailored training to meet changing social needs 中国科学技术大学 @ 2010 3 2. Well-organized training 1. First-class scientists Φ China’s strategic need for “empowering the nation through science and technology and talent cultivation” Φ Fostering world-class leaders in basic sciences Φ USTC’s tradition of training first-class scientists 29 of USTC graduates are academicians of CAS, and 21 APS fellows “Plans for training top-notch students in basic disciplines” CAS “programs for cultivation of top scientists and engineers” 中国科学技术大学 @ 2010 4 2. Well-organized training Φ Under a partnership framework, USTC and relevant CAS research institutes have jointly set up seven talent classes for fostering -

Download Article (PDF)
Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 341 5th International Conference on Arts, Design and Contemporary Education (ICADCE 2019) A Study of the Institutional History of Doctoral Education in the Period of the Republic of China Zhen Chen Guandong Song School of Humanities and Law School of Humanities and Law Northeastern University Northeastern University Shenyang, China 110169 Shenyang, China 110169 Abstract—Since the last emperor of Qing Dynasty retired in ("National Government" for short) was established in 1911, China had entered the period of the Republic of China. Nanjing; the country gradually became unified; the education And since then, the Government of the Republic of China legislation became more and more perfect; the postgraduate ("National Government" for short) had further strengthened education was further developed; the education system was the contact and communication with European and American completed day by day; the development of postgraduate culture and education. So far, China's doctoral candidate education began to enter the right track; and doctoral education had entered the stage of educational practice from candidate education was naturally put on the agenda. After concept of education system. Although universities interrupted the outbreak of the Anti-Japanese War in 1937, universities and even gave up the exploration on postgraduate education successively immigrated, and interrupted the exploration on due to immigration after the outbreak of the Anti-Japanese postgraduate education, so that the discovery of the doctoral War in 1937, it had positive practical significance for the establishment of postgraduate education system after the candidate education was abandoned at the beginning. founding of the People's Republic of China. -

Looking Back on the Road to Success in Conversation with Bao Xinhe, Ustc President
ADVERTISEMENT FEATURE LOOKING BACK ON THE ROAD TO SUCCESS IN CONVERSATION WITH BAO XINHE, USTC PRESIDENT Under what circumstances was USTC founded? We have been instrumental in establishing the Hefei Comprehensive During the science and technology boom in the late 1950s, the Chinese National Science Centre. Our next endeavours aimed at driving regional government identified the need for a new research university featuring and national development include: the quantum information national science and technology. In 1958, the Chinese Academy of Sciences (CAS) laboratory, which is under construction and a partnership with CAS; the new came up with a proposal for such an institution, and, four months later, Faculty of Life Sciences and Medicine, which integrates science, engineering USTC was founded in Beijing. CAS leveraged its resources to support the and biomedicine; and the development of ‘new engineering’, a field that new university and encouraged the integration of its institutions with USTC focuses on big data, AI and information sciences. departments. Having attracted some of China’s most renowned scientists at the time, such as Yan Jici, Hua Luogeng and Hsue-Shen Tsien, USTC’s How does USTC integrate research and education? founding was a milestone in the history of Chinese science and education. Our advantages are bolstered by our close connection with CAS, with We have quickly built our reputation in academic communities nationally many of our chairpeople also acting as directors of CAS institutes. This and abroad. In the 1990s, we were among the first group of universities allows our students to be deeply involved with CAS research projects. -

Our Great Qing
Chinese history / Buddhism ELVERSKOG (Continued from front fl ap) OUR GREAT QING “Johan Elverskog has rewritten the political and intellectual history of Th e Mongols, Buddhism and the State in Late Imperial China as representing a single community that Mongolia from the bottom up, telling a convincing story that clarifi es Although it is generally believed that the had been rescued by the gracious Manchu for the fi rst time the revolutions which Mongolian concepts of com- Manchus controlled the Mongols through rulers during the civil wars of the early sev- munity, rule, and religion underwent from 1500 to 1900. His account their patronage of Tibetan Buddhism, enteenth century. A key element fostering of Qing rule in Mongolia doesn’t just tell us what images the Qing em- scant attention has been paid to the Mon- this change was the Qing court’s promo- perors wished to project, but also what images the Mongols accepted gol view of the Qing imperial project. In tion of Gelukpa orthodoxy, which not only themselves, and how these changed over the centuries. In the scope contrast to other accounts of Manchu rule, transformed Mongol historical narratives of time it covers, the originality of the views advanced, and the accu- QING OUR GREAT Our Great Qing focuses not only on what and rituals but also displaced the earlier racy of the scholarship upon which it is based, Our Great Qing seems images the metropole wished to project vernacular Mongolian Buddhism. Finally, destined to mark a watershed in Mongolian studies. It will be essential onto Mongolia, but also on what images Elverskog demonstrates how this eigh- reading for specialists in Mongolian studies and will make an impor- the Mongols themselves acknowledged.