Poesiealbum, Eine Bemerkenswerte Lyrikanthologie Aus Der DDR
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

DDR-Literatur Im Tauwetter. Band III. Stellungnahmen
DDR-Literatur im Tauwetter Stellungsnahmen – Ein Gespräch mit dem Interviewer. Anstatt eines Vorworts. – Karl Heinz Schoeps: Aus welchem Grunde wurden diese Interviews mit DDR-Autoren geführt? Richard A. Zipser: Während der Tauwetterphase, die der Berufung Erich Honeckers zum ersten Parteisekretär der SED im Jahre 1971 folgte, wollte ich soviel unmittelbare Informationen wie möglich sammeln über die Bedingungen für das Schreiben in der DDR, über Stellung und Anliegen der Schriftsteller und über die Rolle, die die Literatur in diesem Staate spielt. Dieses ursprüngliche Ziel erhielt jedoch ab Herbst 1976 durch die unerwartete kulturpolitische Kursänderung eine neue, unvorhergesehene, geschichtliche Dimension. Schoeps: Wann wurden die Interviews durchgeführt? Zipser: Vom Herbst 1975 bis zum Sommer 1976, also in einer Zeit der Ruhe und des Optimismus, die der Ausbürgerung Wolf Biermanns im November 1976 vorausging, konnte ich zweiunddreißig DDR-Autoren [Jurek Becker, Uwe Berger, Jurij Brezan, Günter de Bruyn, Adolf Endler, Fritz Rudolf Fries, Franz Fühmann, Günter Görlich, Peter Hacks, Stephan Hermlin, Stefan Heym, Karl-Heinz Jakobs, Bernd Jentzsch, Hermann Kant, Uwe Kant, Rainer Kirsch, Sarah Kirsch, Günter Kunert, Reiner Kunze, Karl Mickel, Irmtraud Morgner, Erik Neutsch, Eberhard Panitz, Siegfried Pitschmann, Ulrich Plenzdorf, Benno Pludra, Klaus Schlesinger, Rolf Schneider, Max Walter Schulz, Helga Schütz, Martin Stade und Paul Wiens.] befragen. Weitere sieben Autoren [Heinz Czechowski, Elke Erb, Wolfgang Kohlhaase, Kito Lorenc, Heiner Müller, Eva Strittmatter und Christa Wolf.] wurden vom Herbst 1977 bis zum Frühjahr 1978 interviewt, in einer Zeit der Unruhe und Unsicherheit, die durch den Weggang von so talentierten Autoren wie Bernd Jentzsch, Thomas Brasch, Reiner Kunze, Sarah Kirsch, Hans Joachim Schädlich und Jurek Becker noch verstärkt wurde. -

Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Kafkas University Journal of the Institute of Social Sciences Bahar Spring 2018, Sayı Number 21, 9-26 DOI:10.9775/kausbed.2018.002 Gönderim Tarihi: 13.11.2017 Kabul Tarihi: 12.02.2018 DAS SANDKORN, WAGENBACH UND CO.: ZUR VORGESCHICHTE VON ADOLF ENDLERS AUSSCHLUSS AUS DEM SCHRIFTSTELLERVERBAND DER DDR The Grain of Sand, Wagenbach and Co.: On the Prehistory of Adolf Endler’s Expulsion from the Author’s Association of the GDR Onur Kemal BAZARKAYA Dr. Öğr. Üyesi, Namık Kemal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü. [email protected] ORCID ID: 0000-0001-6553-4255 Çalışmanın Türü: Araştırma Öz Kum Tanesi, Wagenbach ve Ortaklar: Adolf Endler’in ADC Yazarlar Birliğinden İhraç Edilmesinin Önceki Evreleri Adolf Endler, 7 Haziran 1979 ADC (Alman Demokratik Cumhuriyeti) Yazarlar Birliğinden ihraç edilmiş dokuz yazardan birisidir. Bu ihraç kararı, ADC içindeki kültür politikalarında olduğu kadar ADC’nin dışında da ses getiren bir tedbirdir. Bu çalışmada, Endler’in söz konusu kurumdan ihracının öncesine ışık tutulacaktır. Makalenin merkezinde, Endler’in ihracının birçok nedeni olduğu varsayım olarak yer almaktadır. Şairin Mayıs 1979’da ADC Başkanı Erich Honecker’e yazdığı protesto mektubu bu kapsamda ne kadar etkili olduysa da, makalenin sorunsalını tek bu nedene bağlamak, bu çalışmanın ikinci ağırlık noktasını oluşturan Endler’in eleştirel yazarlığını gözardı etmek anlamına gelir. Provokasyondan çekinmeyen Endler’in ihracına birden çok bakış açısıyla bakmak, konunun arka planını ayrıntılı bir biçimde belirlemeye olanak sağlar. Dolaysıyla bu makalede Endler’in muhalif sanatı ele alınacaktır. Diğer yandan da ADC tarafından sakıncalı görülen kişilerle ilgili yaptığı üç eylem irdelenecektir. -

Der Zerstückte Traum
Inhalt I ÜBER ERICH ARENDT Fritz J. Raddatz - Erich Arendt - Mahner zum Traum 11 Bernd Jentzsch - Das Gedicht hinter dem Gedicht 21 Stefan H. Kaszynski - Strukturen und Erfahrungen im lyrischen Werk Erich Arendts 23 HAP Grieshaber - Holzschnitt 27 Helmut Lethen - Überlegungen zu Gedichten Erich Arendts 40 Gisele Celan-Lestrange - Federzeichnung, braun gehöht 43 Ton Naaijkens - Vom Wunsch, der in den Zeichen spricht 47 Gerhard Wolf - Skizze für ein Porträt Erich Arendts Zu Wieland Försters Zeichnung und Stele 61 Hannelore Teutsch - Federzeichnung 63 Dieter Goltsche - Zeichnung, Filzstift 71 Yolanda Julia Broyles - Erich Arendt und die latein- amerikanische Literatur 72 Carlfriedrich Claus - Subjektive Notizen zum Spätwerk Erich Arendts 76 Christoph Meckel - Für Erich Arendt, Feder, Wachsmalstift 77 II ERINNERUNG UND GESPRÄCH Adolf Endler - Aus dem Tagebuch 1973 81 Elke Erb - Sehnsucht 85 Fritz Rudolf Fries - Gratulation 86 Hans-Jürgen Fröhlich — Inkognito in Italien 88 Heinz Trökes - Zeichnung, Kugelschreiber 89 Stefan Haraszti - Erinnerungen an spanische Tage 91 Hermann Keller - Zwei Elegien nach Trakl, Komposition 93 Tito Medek - »Brot unendlichen Verstehens« 103 Martin Mootj - Erich Arendt bei Poetry International 109 Norbert Randow - Eine Beobachtung 112 Manfred Schlösser - Gespräch mit Erich Arendt 113 Erich Arendt — Spätbegegnung 126 III PROSA UND GEDICHTE Rafael Alberti - Fichtelberg 131 Gerhard Altenbourg - Süchtig nach Stille hock ich im Armstuhl, Handschrift für eine Zeichnung 132 Gilda Bereska - Traum 76 133 Henryk Bereska - Krähen 134 Hannelore Biricz - Scherbe aus Ton 135 Thomas Brasch - Zwölf Reime für Erich Arendt 136 Volker Braun - Richtpiatz bei Mühlhausen 137 Andre du Bouchet - Intonation • Tonangabe (französisch-deutsch) 138 Heinz Czechowski - W. 148 Atanas Daltschew - Einem Freunde 150 Wieland Förster - Zeichnung 151 Christoph Derschau - Über den Tiefen der Seele 152 Erich Fried — Aus deinen Worten. -

Die Forderung, Deutsch Solle Neben Englisch Und Französisch Zur
Wolfgang Bunzel “... dankbar daß ich entkam” Sarah Kirschs Autorexistenz im Spannungsfeld von DDR-Bezug und “Exil”-Erfahrung Seit Sarah Kirsch zu schreiben begonnen hat, stehen die Texte dieser Autorin im Spannungsfeld von Subjekt und Gesellschaft, von eigener Biographie und kollektiver Geschichtserfahrung.1 Und so verwundert es denn auch nicht, wenn sowohl vor wie nach der Übersiedlung in die Bundesrepublik die Auseinander- setzung mit den Lebensbedingungen des Individuums in der DDR einen zent- ralen Gegenstand in ihrem literarischen Schaffen bildet.2 Freilich verändert sich der Stellenwert des Themas im Lauf der Œuvre-Entwicklung auf charakteristi- sche Weise. Parallel dazu wandelt sich auch Kirschs auktoriales Selbstverständ- nis. Ziel des vorliegenden Aufsatzes ist es, die einzelnen Stationen dieses dop- pelten Transformationsprozesses nachzuzeichnen. Die Anfänge von Sarah Kirschs literarischer Produktion – 1965 erschien als Gemeinschaftsarbeit mit ihrem Ehemann Rainer der Band Gespräch mit dem Sau- rier, zwei Jahre später dann kam unter dem Titel Landaufenthalt die erste eigene Lyriksammlung heraus – fallen bezeichnenderweise mit der Neuentdeckung schriftstellerischer Subjektivität in der DDR zusammen. Für diese Entwicklung stehen u.a. Namen wie Christa Wolf im Bereich der Erzählprosa sowie Günter Kunert, Reiner Kunze, Volker Braun und Karl Mickel im Bereich der Lyrik. Das Insistieren auf dem eigenen Ich und die Wendung zur Natur – die Über- schrift Landaufenthalt ist durchaus programmatisch zu verstehen – deuten bereits eine vorsichtige Relativierung der am geschichtsmächtigen Kollektiv orientier- ten sozialistischen Ästhetik an, was jedoch nicht heißt, “daß Sarah Kirsch zu diesem Zeitpunkt ihre schriftstellerische Funktion in der sozialistischen Gesell- schaft in Frage gestellt hätte”3. Am auffälligsten ist diese Distanznahme in den 1 Auf diesen Konnex nachdrücklich aufmerksam gemacht hat vor allem Barbara Mabee in ih- rer Studie: Die Poetik von Sarah Kirsch. -

Abendlicher Reigen Georg Trakl ...306 Abends
Abendlicher Reigen Georg Trakl ....................................... 306 Abends/Auf meinem Schoße sitzet nun Theodor Storni ... 270 Abenteuer Eva Strittmatter................................................. 26 Abschiedsworte an Pellka Joachim Ringelnatz .................. 173 Ach Robert Gemhardt ......................................................... 31 Ach Liebste, laß uns eilen Martin Opitz ............................. 14 Ach, noch in der letzten Stunde Robert Gernhardt .............. 31 Ach, sie strampelt mit den Füßen Frank Wedekind .......... 275 Advent Werner Finck ........................................................ 343 Advent Mascha Kaliko ...................................................... 344 Albumblatt Franz Grillparzer ............................................. 86 Alleine saß das Nashorn da Bernd Pfarr ........................... 226 Alles kann sich umgestalten! Friedrich von Matthisson ... 150 Als ich ihn erwartete Sophie Albrecht................................. 134 Als ich zum ersten Mal die Sanfte sah Robert W alser........268 Als sie einander acht Jahre kannten Erich Kästner ............ 300 Als Zeus Europen lieb gewann Gotthold Ephraim Lessing 132 Am Brunnen Thomas Bernhard ........................................... 35 Amara (Pidgin) Hans Magnus Enzensberger ..................... 98 Amara, bittre, was du thust ist bitterFriedrich Rückert ... 97 Amara, du nix gut Hans Magnus Enzensberger .................. 98 An des Dichters andere Hälfte, den Leser Christian Morgenstern....................................................... -

And German- Language Poetry 1960-1975
Landscape, space and place in English- and German- language poetry 1960-1975 Nicola omas esis submied to the University of Noingham for the Degree of Doctor of Philosophy July 2017 Abstract is thesis examines representations of space, place and landscape in English- and German-language poetry of the period 1960-1975, a key transitional phase between modernity and postmodernity. It proposes that the impact certain transnational spatial revolutions had on contemporary poetry can only be fully grasped with recourse to comparative methodologies which look across national borders. is is demonstrated by a series of paired case studies which examine the work of J. H. Prynne and Paul Celan, Sarah Kirsch and Derek Mahon, and Ernst Jandl and Edwin Morgan. Prynne and Celan’s Sprachskepsis is the starting point for a post-structuralist analysis of meta-textual space in their work, including how poetry’s complex tectonics addresses multifaceted crises of representation. Mahon and Kirsch’s work is read in the context of spatial division, and it is argued that both use representations of landscape, space and place to express political engagement, and to negotiate fraught ideas of home, community and world. Jandl and Morgan’s representations of space and place, which oen depend on experimental lyric subjectivity, are examined: it is argued that poetic subject(s) which speak from multiple perspectives (or none) serve as a means of reconguring poetry’s relationship to space at a time when social, literary and political boundaries were being redened. e thesis thus highlights hitherto underexplored connections between a range of poets working across the two language areas, making clear that space and place is a vital critical category for understanding poetry of this period, including both experimental and non-experimental work. -

Elke Erb's Poetry Since 1989
Studies in 20th Century Literature Volume 21 Issue 1 Special Issue on Contemporary German Article 10 Poetry 1-1-1997 Footprints Revisited or "Life in the Changed Space that I don't Know": Elke Erb's Poetry Since 1989 Barbara Mabee Oakland University (Rochester, Michigan) Follow this and additional works at: https://newprairiepress.org/sttcl Part of the German Literature Commons This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 4.0 License. Recommended Citation Mabee, Barbara (1997) "Footprints Revisited or "Life in the Changed Space that I don't Know": Elke Erb's Poetry Since 1989," Studies in 20th Century Literature: Vol. 21: Iss. 1, Article 10. https://doi.org/10.4148/ 2334-4415.1414 This Article is brought to you for free and open access by New Prairie Press. It has been accepted for inclusion in Studies in 20th Century Literature by an authorized administrator of New Prairie Press. For more information, please contact [email protected]. Footprints Revisited or "Life in the Changed Space that I don't Know": Elke Erb's Poetry Since 1989 Abstract After the fall of the Wall, the lyrical correspondence of the East German writer Elke Erb with the Austrian experimental writer Friederike Mayröcker proved to be of great significance for Erb's process of reexamining perspectives and constituting a new poetic self. In a close reading of Erb's post-Wende texts, the article discusses Erb's reshaping of her poetic craft against the backdrop of her life in the former GDR and literarty discourses in unified Germany. -

Recent Publications Various Authors
GDR Bulletin Volume 7 Issue 1 Winter Article 6 1981 Recent Publications various authors Follow this and additional works at: https://newprairiepress.org/gdr This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 License. Recommended Citation authors, various (1981) "Recent Publications," GDR Bulletin: Vol. 7: Iss. 1. https://doi.org/10.4148/ gdrb.v7i1.554 This Announcement is brought to you for free and open access by New Prairie Press. It has been accepted for inclusion in GDR Bulletin by an authorized administrator of New Prairie Press. For more information, please contact [email protected]. - 4 - authors: Recent Publications LITERATURE IN TRANSLATION E. John. Probleme der marxistisch-leninistischen Ästhetik. Leipzig: VEB Bibliographisches Institut. Bd. 1: 322 S. 42,- M. Bd. 2: 260 S. 38,- M. BIBLIOGRAPHY OF GDR LITERATURE IN ENGLISH TRANSLATION Anita M. Mallinckrodt: Die Selbstdarstellung der beiden (supplement) deutschen Staaten im Ausland. Köln: Verlag Wissen- schaft und Politik, 1980. 350 S. DM 38,- Anthologies Jürgen Radde. Die außenpolitische Führungselite der DDR. (Veränderungen der sozialen Struktur außenpolitischer East German Short Stories: an Introductory Anthology, Führungsgruppen). Köln: Bibliothek Wissenschaft und ed. and trans. Peter E. and Evelyn S. Firchow. Politik Berend von Nottbeck, 19Ö0. 240 S. DM 28,00. Boston: Tvayne Publishers,,1979. (Paperback) 20 works by 20 authors. H. Redecker. Grundzüge einer Literaturästhetik. Leip• FIELD: Contemporary Poetry and-Poetics. Nr. 22 zig: VEB Bibliographisches Institut. 260 S. 12,80 M. (Spring, I960). Contains: Sheep's Wool is Left Hanging, In the Picture by Elke Erb; Reasons for Günther Schraid. Entscheidung in Bonn. (Die Entstehung Taking Care of the Car, Refuge Even Behind Refuge der Ost- und Deutschlandpolitik 1969/1970). -

In Diesem Lande Libraries Associated to Dandelon.Com Network
© 2008 AGI-Information Management Consultants May be used for personal purporses only or by In diesem Lande libraries associated to dandelon.com network. Wir Deutsche Gedichte der Gegenwart • Eine Anthologie in zehn Kapiteln • Herausgegeben von Hans Bender Hanser Inhaltsverz eichnis Ja ich denke mir ein Leben das schön ist 17 Ursula Krechel • Vorspiel zu wärmeren Feierabenden 17 Ludwig Fels • Natur 17 Ludwig Fels • Mein Glück 18 Ursula Flügler • Erstes Lateinbuch 19 Hans Dieter Schäfer • Altes Thema 20 Paul Wühr • Hinter den blauen Bergen 21 Günter Kunert • Mitbürger 21 Christoph Meckel • Der Tag wird kommen 22 Rose Ausländer • Gemeinsam 23 Hilde Domin • Älter werden 24 "Reiner Kunze • Möglichkeit, einen Sinn zu finden 24 Peter Rühmkorf • Komm raus! 25 Karl Mickel • Kindermund 2ö Wolf gang Bächler • Ausbrechen 26 Walter Helmut Fritz • Sie werden sich wehren 26 Nicolas Born • Liebesgedicht 29 Ludwig Fels • Freiheit 30 Günter Bruno Fuchs • Laubsäcke 3 2 Heinz Czedhowski • An Freund und Feind 33 Heinz Czechowski • An meine Freunde, Sommer 1975 3 3 Paul Günter Krohn • Ein Epilog 34 Jürgen Theobaldy • Ich weiß es wird eine andere Zeit kommen 36 Alfred Andersen • Paris, 1. Mai 1977 3 6 Volker Braun • Der Lebenswandel Volker Brauns wir befinden uns mitten in einem Gedicht 41 Günter Kunert • Gedicht 41 Paul Wühr • Beginne ich jetzt hier oben 42 Michael Krüger • Gedicht über einen Spaziergang am Stausee und über Gedichte 43 Michael Krüger • Nachgedicht 44 Roman Ritter • Mona Lisa 46 Peter Salomon • September 1975, am Bodensee 48 Rolf Haufs • Gedicht -

Gertrud Maria Rösch, Heidelberg
Gertrud Maria Rösch EIN ‚GEORGIEN, AUS NICHTS GEMACHT ALS AUS POESIE‘ ADOLF ENDLERS UND CLEMENS EICHS REISEBERICHTE ALS LIEUX DE MÉMOIRE Gertrud Maria Rösch, Heidelberg EINFÜHRUNG Adolf Endler1 hatte 1969 gemeinsam mit seiner damaligen Frau Elke Erb2 und dem Lyriker Rainer Kirsch3 eine Georgienreise unternommen.4 Die drei ver- standen sich als literarische Botschafter im Dienste der kulturpolitischen Ver- ständigung des damals zur SU gehörenden Georgien und der DDR und waren 1 Endler war am 10. September 1930 in Düsseldorf geboren worden und starb im Alter von 78 Jahren am 2. August 2009. Der Autor mit dem Epitheton „Tarzan vom Prenzlauer Berg“ (vgl. Cramer, Sybille: ‚Nie hat er sich Wachs in die Ohren gestopft‘. Adolf Endler (1930– 2009). In: die horen 54, 4. Quartal, 2009, S. 47–51, hier: S. 48). war zu Beginn seiner Lauf- bahn ein überzeugter Sozialist. 1955 zog er freiwillig in die DDR, nachdem er für die Welt- festspiele der Jugend, eine linksgerichtete Organisation, geworben und dank seiner kom- munistischen Gesinnung eine Anklage wegen Staatsgefährdung erhalten hatte (vgl. ebd.). 2 Elke Erb, geb. 1938, stammte wie Endler aus Westdeutschland, siedelte jedoch 1949 in die DDR um, wo sie Ende der 1950er Jahre zunächst als Landarbeiterin tätig war. Nach einem Studium der Germanistik und Geschichte legte sie 1963 das Lehrerexamen ab, arbeitete danach in einem Verlag und ist seit 1966 freie Schriftstellerin. Ihre zahlreichen Lyrik-An- thologien zeigen ihre kritische Haltung zum DDR-Staat und lassen ihr Engagement für Friedensbewegungen spürbar werden. Nachdem sie gegen die Ausbürgerung von Roland Jahn, einem Bürgerrechtler, protestiert hatte, wurde sie durch die Stasi überwacht. -

P.E.N. Werden
Broschüre_u 18_Layout 1 19.08.11 15:58 Seite 1 DIE CHARTA DES INTERNATIONALEN PEN Die PEN-Charta gründet sich auf Resolutionen, die auf internationalen Kongressen angenommen worden sind, und soll wie folgt zusammen gefasst P.E.N. werden. Der PEN-Club vertritt die folgenden Grundsätze: DIE INTERNATIONALE SCHRIFTSTELLERVEREINIGUNG 1 Literatur kennt keine Landesgrenzen und muss auch in Zeiten innen politischer IHRE DEUTSCHE GESCHICHTE oder inter nationaler Erschütterungen eine allen Menschen gemeinsame Währung bleiben. IHRE AUFGABEN 2 Unter allen Umständen, und insbesondere auch im Krieg, sollen Werke der Kunst, der Erbbesitz der gesamten Menschheit, von nationalen und politischen Leidenschaften unangetastet bleiben. 3 Mitglieder des PEN sollen jederzeit ihren ganzen Einfluss für das gute Einver - nehmen und die gegenseitige Achtung der Nationen einsetzen. Sie verpflichten sich, mit äußerster Kraft für die Bekämpfung von Rassen-, Klassen- und V ölkerhass und für das Ideal einer einigen Welt und einer in Frieden lebenden Menschheit zu wirken. 4 Der PEN steht für den Grundsatz eines ungehinderten Gedankenaustauschs innerhalb einer jeden Nation und zwischen allen Nationen, und seine Mitglieder verpflichten sich, jeder Art der Unterdrückung der freien Meinungsäußerung in ihrem Lande, in der Gemeinschaft, in der sie leben, und wo immer möglich auch weltweit entgegenzutreten. Der PEN erklärt sich für die Freiheit der Presse und verwirft jede Form der Zensur. Er steht auf dem Standpunkt, dass der not - wen dige Fortschritt in der Welt hin zu einer höher organisierten politischen und wirtschaftlichen Ordnung eine freie Kritik gegenüber Regierungen, Verwal - tungen und Institutionen zwingend erforderlich macht. Und da die Freiheit auch freiwillig geübte Zurückhaltung einschließt, verpflichten sich die Mitglieder, solchen Auswüchsen einer freien Presse wie wahrheitswidrigen Veröffentlichungen, vorsätzlichen Fälschungen und Entstellungen von Tatsachen für politische und persönliche Ziele entge genzuarbeiten. -
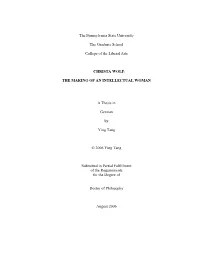
Open Dissertation Ying June06.Pdf
The Pennsylvania State University The Graduate School College of the Liberal Arts CHRISTA WOLF: THE MAKING OF AN INTELLECTUAL WOMAN A Thesis in German by Ying Tang © 2006 Ying Tang Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy August 2006 The thesis of Ying Tang was reviewed and approved* by the following: Cecilia Novero Assistant Professor of German, Comparative Literature and Women’s Studies Thesis Adviser Chair of Committee Daniel Purdy Associate Professor of German Literature Joan B. Landes Ferree Professor of Early Modern History and Women’s Studies Hartmut Heep Associate Professor of German, Comparative Literature Adrian Wanner Professor of Russian and Comparative Literature Head of the Department of Germanic and Slavic Languages and Literatures *Signatures are on file in the Graduate School. ABSTRACT Christa Wolf, a GDR intellectual, was discredited as a writer after German Unification. In 1990, she was at the center of a controversy that started around her publication of a novel titled Was bleibt (What remains). The controversy expanded to consider more generally the role of the Stasi (secret police) in GDR culture and affected in particular the generation of GDR writers born around 1930, who were not dissidents, and had not left the country in the 40 years of its existence. Prior to the demise of the GDR, Wolf’s stories, novels and essays, as well as her political interventions during 1989, were highly considered for their moral and political standing and she was regarded, especially by feminist and progressive intellectuals, as one of the few women intellectuals of the 20th century, among the likes of Simone de Beauvoir and Hannah Arendt.