Pressemappe Erb Kopie
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

DDR-Literatur Im Tauwetter. Band III. Stellungnahmen
DDR-Literatur im Tauwetter Stellungsnahmen – Ein Gespräch mit dem Interviewer. Anstatt eines Vorworts. – Karl Heinz Schoeps: Aus welchem Grunde wurden diese Interviews mit DDR-Autoren geführt? Richard A. Zipser: Während der Tauwetterphase, die der Berufung Erich Honeckers zum ersten Parteisekretär der SED im Jahre 1971 folgte, wollte ich soviel unmittelbare Informationen wie möglich sammeln über die Bedingungen für das Schreiben in der DDR, über Stellung und Anliegen der Schriftsteller und über die Rolle, die die Literatur in diesem Staate spielt. Dieses ursprüngliche Ziel erhielt jedoch ab Herbst 1976 durch die unerwartete kulturpolitische Kursänderung eine neue, unvorhergesehene, geschichtliche Dimension. Schoeps: Wann wurden die Interviews durchgeführt? Zipser: Vom Herbst 1975 bis zum Sommer 1976, also in einer Zeit der Ruhe und des Optimismus, die der Ausbürgerung Wolf Biermanns im November 1976 vorausging, konnte ich zweiunddreißig DDR-Autoren [Jurek Becker, Uwe Berger, Jurij Brezan, Günter de Bruyn, Adolf Endler, Fritz Rudolf Fries, Franz Fühmann, Günter Görlich, Peter Hacks, Stephan Hermlin, Stefan Heym, Karl-Heinz Jakobs, Bernd Jentzsch, Hermann Kant, Uwe Kant, Rainer Kirsch, Sarah Kirsch, Günter Kunert, Reiner Kunze, Karl Mickel, Irmtraud Morgner, Erik Neutsch, Eberhard Panitz, Siegfried Pitschmann, Ulrich Plenzdorf, Benno Pludra, Klaus Schlesinger, Rolf Schneider, Max Walter Schulz, Helga Schütz, Martin Stade und Paul Wiens.] befragen. Weitere sieben Autoren [Heinz Czechowski, Elke Erb, Wolfgang Kohlhaase, Kito Lorenc, Heiner Müller, Eva Strittmatter und Christa Wolf.] wurden vom Herbst 1977 bis zum Frühjahr 1978 interviewt, in einer Zeit der Unruhe und Unsicherheit, die durch den Weggang von so talentierten Autoren wie Bernd Jentzsch, Thomas Brasch, Reiner Kunze, Sarah Kirsch, Hans Joachim Schädlich und Jurek Becker noch verstärkt wurde. -

Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Kafkas University Journal of the Institute of Social Sciences Bahar Spring 2018, Sayı Number 21, 9-26 DOI:10.9775/kausbed.2018.002 Gönderim Tarihi: 13.11.2017 Kabul Tarihi: 12.02.2018 DAS SANDKORN, WAGENBACH UND CO.: ZUR VORGESCHICHTE VON ADOLF ENDLERS AUSSCHLUSS AUS DEM SCHRIFTSTELLERVERBAND DER DDR The Grain of Sand, Wagenbach and Co.: On the Prehistory of Adolf Endler’s Expulsion from the Author’s Association of the GDR Onur Kemal BAZARKAYA Dr. Öğr. Üyesi, Namık Kemal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü. [email protected] ORCID ID: 0000-0001-6553-4255 Çalışmanın Türü: Araştırma Öz Kum Tanesi, Wagenbach ve Ortaklar: Adolf Endler’in ADC Yazarlar Birliğinden İhraç Edilmesinin Önceki Evreleri Adolf Endler, 7 Haziran 1979 ADC (Alman Demokratik Cumhuriyeti) Yazarlar Birliğinden ihraç edilmiş dokuz yazardan birisidir. Bu ihraç kararı, ADC içindeki kültür politikalarında olduğu kadar ADC’nin dışında da ses getiren bir tedbirdir. Bu çalışmada, Endler’in söz konusu kurumdan ihracının öncesine ışık tutulacaktır. Makalenin merkezinde, Endler’in ihracının birçok nedeni olduğu varsayım olarak yer almaktadır. Şairin Mayıs 1979’da ADC Başkanı Erich Honecker’e yazdığı protesto mektubu bu kapsamda ne kadar etkili olduysa da, makalenin sorunsalını tek bu nedene bağlamak, bu çalışmanın ikinci ağırlık noktasını oluşturan Endler’in eleştirel yazarlığını gözardı etmek anlamına gelir. Provokasyondan çekinmeyen Endler’in ihracına birden çok bakış açısıyla bakmak, konunun arka planını ayrıntılı bir biçimde belirlemeye olanak sağlar. Dolaysıyla bu makalede Endler’in muhalif sanatı ele alınacaktır. Diğer yandan da ADC tarafından sakıncalı görülen kişilerle ilgili yaptığı üç eylem irdelenecektir. -

Introduction the Surreal Without Surrealism
INTRODUCTION The Surreal without Surrealism The time will come, if it is not already come, when the surrealist enterprise:': will be studied and evaluated, in the history of literature, as an adventure of hope. —Wallace Fowlie, Age of Surrealism Indubitably, Surrealism and the GDR are closely connected, and are more closely related to each other than one might think. When, for example, one listens to the recollections and reads the memoirs of those who lived in this country, apparently no other conclusion can be drawn. Life in the East German Communist state had a surrealistic disposition, was associated with the grotesque, absurd and irrational. Admittedly, Surrealism did not exist in the GDR. Not only are the insights of Hans Magnus Enzensberger and Peter Bürger on the death of the historical avant-garde convincing and applicable to the GDR;1 it is also significant that no German artist or writer who considered him- or herself a Surrealist prior to 1945 returned from exile to settle in the SBZ or the GDR. Most of the celebrities of German Surrealism during the Weimar Republic were forced to go into exile or did not return to Germany at all. Max Ernst, for example, remained living in the USA, and then in 1953 moved to his wife’s old quarters in Paris; Hans Arp decided to live in Switzerland, and in 1949 chose the USA as his home country. Others who had lived through and survived Hitler’s Germany had to face the harsh demands of National Socialist cultural politics that downgraded the avant-garde to the status of Entartete Kunst, or degenerate art, and sidelined and even terrorized its representatives. -

Und Umtriebe Des Übersetzers Richard Pietraß Der Schriftsteller Un
1 Andreas F. Kelletat Pilgerfahrt ins Land der Poesie Die An- und Umtriebe des Übersetzers Richard Pietraß (Laudatio auf Richard Pietraß aus Anlass der Verleihung des Übersetzerpreises Ginkgo-Biloba für Lyrik im Hilde- Domin-Saal der Stadtbücherei Heidelberg, 30. September 2020) Der Schriftsteller und der Übersetzer, der Dichter und der Nachdichter Richard Pietraß hatte seine ersten weiterhin sichtbaren Veröffentlichungen in drei einander folgenden Ausgaben einer von Bernd Jentzsch herausgegebenen Lyrikreihe namens Poesiealbum. 90 Pfennige kosteten die Hefte und sie wurden in einer Auflage von 10.000 Exemplaren nicht nur in Buchhandlungen, sondern sogar an Zeitungskiosken verkauft. Jeden Monat gab es ein neues, eine neue Stimme im Chor der Lyrik. Im Heft Nr. 81 mit Gedichten Marina Zwetajewas erschien im Juni 1974 Pietraß‘ erste Übersetzung aus dem Russischen, im August 1974 in Heft 83 seine Nachdichtung eines Lappland-Poems des norwegischen Dichters Nordahl Grieg und in Heft 82 wurde Richard Pietraß im Juli 1974 mit eigenen Gedichten vorgestellt. Worum es ihm in seiner Poesie geht, steht auf der Innenklappe des Heftes vom Juli 1974: „Das Leben trifft uns, wie uns wahre Kunst betroffen macht. Daraus entstehen Gedichte. Immer gilt es, den Raum des Sagbaren, letztlich Lebbaren, zu erweitern.“ Ein Mittel, den „Raum des Sagbaren […] zu erweitern“, wurde für ihn neben dem eigenen Schreiben von Gedichten auch das Übersetzen und das Nachdichten. Dabei schärfte er mitunter die Aussage der Originale und ließ so die Aktualität eines Gedichts etwa von Boris Sluzki oder Nikolai Sabolozki aufblitzen. In den Poesiealben vom Juni und August 1974, die von Fritz Mierau (Zwetajewa) und Sieglinde Mierau (Grieg) zusammengestellt wurden, ist Pietraß mit jeweils nur einem Gedicht vertreten; die anderen wurden von anderen Dichtern ins Deutsche gebracht, von Heinz Czechowski, Adolf Endler, Elke Erb, Bernd Jentzsch, Rainer Kirsch, Sarah Kirsch und Reiner Kunze. -

The East German Writers Union and the Role of Literary Intellectuals In
Writing in Red: The East German Writers Union and the Role of Literary Intellectuals in the German Democratic Republic, 1971-90 Thomas William Goldstein A dissertation submitted to the faculty of the University of North Carolina at Chapel Hill in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Department of History. Chapel Hill 2010 Approved by: Konrad H. Jarausch Christopher Browning Chad Bryant Karen Hagemann Lloyd Kramer ©2010 Thomas William Goldstein ALL RIGHTS RESERVED ii Abstract Thomas William Goldstein Writing in Red The East German Writers Union and the Role of Literary Intellectuals in the German Democratic Republic, 1971-90 (Under the direction of Konrad H. Jarausch) Since its creation in 1950 as a subsidiary of the Cultural League, the East German Writers Union embodied a fundamental tension, one that was never resolved during the course of its forty-year existence. The union served two masters – the state and its members – and as such, often found it difficult fulfilling the expectations of both. In this way, the union was an expression of a basic contradiction in the relationship between writers and the state: the ruling Socialist Unity Party (SED) demanded ideological compliance, yet these writers also claimed to be critical, engaged intellectuals. This dissertation examines how literary intellectuals and SED cultural officials contested and debated the differing and sometimes contradictory functions of the Writers Union and how each utilized it to shape relationships and identities within the literary community and beyond it. The union was a crucial site for constructing a group image for writers, both in terms of external characteristics (values and goals for participation in wider society) and internal characteristics (norms and acceptable behavioral patterns guiding interactions with other union members). -

Forwards and Don't Forget Beatrice E. Stammer Feminism Is Neither a Style Nor a Movement, but Rather a Value System, a Revolu
Forwards and Don’t Forget Beatrice E. Stammer Feminism is neither a style nor a movement, but rather a value system, a revolutionary strategy, a standard of living. (1) In 2009, twenty years after the fall of the wall, female artists from the GDR are still mostly unknown. Up until today, few are to be found in museums or at art fairs. Their work also seldom appears in contemporary exhibitions and are only sparingly represented even in large exhibitions surveying art in the GDR – “Where have the female visual artists” (2) gone to? Why were the majority (of female artists) regarded much less than their male colleagues already in their own land and with few exceptions completely ignored since the fall of the wall? When in the 1980s a young generation of artists in Berlin (East), Leipzig and Erfurt or Dresden, confidently and subversively protested against every single monopolization and standardization, it was these artists in particular, who let this “ego perspective” stubbornly and unbridled take its course and who were motivated to leave behind the web of stipulated (female) standards of living. The non-conformist art scene of the GDR is characterized by a vehement questioning, a collective retreat and departure in which – due to the walls – however limited alternatives resulted, where life and art flowed together. And female artists played a considerable part in this development. Despite this often radical departure of both young female and male artists in the GDR however, gender relations remained traditionally inscribed and untouched. “Women therefore never seriously threatened the rules of the male dominated society that were embedded in the deep structures of the culture.” (3) Even in so-called avant- garde circles neither the women nor the men questioned the division of gender roles. -

Idyll Ich Lag Und Sann, Da Kamen Kram-Gedanken. Natürlich Ist Es Recht
Unterrichtsmaterialien Januar 2016, „Kram-Gedanken“ Idyll Ich lag und sann, da kamen Kram-Gedanken. Natürlich ist es recht, den Kram im Kopf zu haben. So hältst die Sterne du in ihren Bahnen. Statt aus der Welt heraus zu existieren und fremd zu sein wie dir mehr als den Tieren. Lass deinen Kram wie Himmelskörper strahlen und denke dir zum Abschluss Brombeerranken. aus: Elke Erb, Meins, roughbooks 2011 Unterrichtsmaterialien Januar 2016, „Kram-Gedanken“ „Ich schreibe überhaupt dauernd von Dingen, die ich erlebt habe, die richtig leibhaft bei mir sind“, sagt Elke Erb. Richtig leibhaft bei ihr sind auch „Kram-Gedanken“. Die Muße haben, sich seinen Gedanken hinzugeben, sie schweifen lassen, wie ‚Himmelskörper‘ zum Strahlen zu bringen, sie und sich, einem Luftschiff gleich, einfach einmal, fast ziellos, treiben zu lassen…Kram-Gedanken eben! Hintergrund „Einen solchen Ton habe ich in der deutschen Lyrik lange nicht gehört.“ [Tom Pohlmann über Erb] Die Schriftstellerin Elke Erb wurde 1938 in Scherbach/Voreifel geboren und siedelte 1949 mit ihrer Familie nach Halle/Saale [DDR] über. Dort studierte sie Pädagogik, Geschichte, Germanistik und Slawistik an der Martin-Luther-Universität. In diese Zeit fielen auch ihre ersten Schreibversuche. Zunächst verdiente Erb ihren Lebensunterhalt als Gutachterin über russische Gegenwartsliteratur, dann durch Rezensionen. Ihre ersten Gedichte wurden 1968 publiziert, es folgten Kurzprosa sowie Arbeiten für Kindertheater und Puppenspiel. Im Jahr 1974 erschien Erbs erste größere Übersetzung mit Texten von Marina -

Der Zerstückte Traum
Inhalt I ÜBER ERICH ARENDT Fritz J. Raddatz - Erich Arendt - Mahner zum Traum 11 Bernd Jentzsch - Das Gedicht hinter dem Gedicht 21 Stefan H. Kaszynski - Strukturen und Erfahrungen im lyrischen Werk Erich Arendts 23 HAP Grieshaber - Holzschnitt 27 Helmut Lethen - Überlegungen zu Gedichten Erich Arendts 40 Gisele Celan-Lestrange - Federzeichnung, braun gehöht 43 Ton Naaijkens - Vom Wunsch, der in den Zeichen spricht 47 Gerhard Wolf - Skizze für ein Porträt Erich Arendts Zu Wieland Försters Zeichnung und Stele 61 Hannelore Teutsch - Federzeichnung 63 Dieter Goltsche - Zeichnung, Filzstift 71 Yolanda Julia Broyles - Erich Arendt und die latein- amerikanische Literatur 72 Carlfriedrich Claus - Subjektive Notizen zum Spätwerk Erich Arendts 76 Christoph Meckel - Für Erich Arendt, Feder, Wachsmalstift 77 II ERINNERUNG UND GESPRÄCH Adolf Endler - Aus dem Tagebuch 1973 81 Elke Erb - Sehnsucht 85 Fritz Rudolf Fries - Gratulation 86 Hans-Jürgen Fröhlich — Inkognito in Italien 88 Heinz Trökes - Zeichnung, Kugelschreiber 89 Stefan Haraszti - Erinnerungen an spanische Tage 91 Hermann Keller - Zwei Elegien nach Trakl, Komposition 93 Tito Medek - »Brot unendlichen Verstehens« 103 Martin Mootj - Erich Arendt bei Poetry International 109 Norbert Randow - Eine Beobachtung 112 Manfred Schlösser - Gespräch mit Erich Arendt 113 Erich Arendt — Spätbegegnung 126 III PROSA UND GEDICHTE Rafael Alberti - Fichtelberg 131 Gerhard Altenbourg - Süchtig nach Stille hock ich im Armstuhl, Handschrift für eine Zeichnung 132 Gilda Bereska - Traum 76 133 Henryk Bereska - Krähen 134 Hannelore Biricz - Scherbe aus Ton 135 Thomas Brasch - Zwölf Reime für Erich Arendt 136 Volker Braun - Richtpiatz bei Mühlhausen 137 Andre du Bouchet - Intonation • Tonangabe (französisch-deutsch) 138 Heinz Czechowski - W. 148 Atanas Daltschew - Einem Freunde 150 Wieland Förster - Zeichnung 151 Christoph Derschau - Über den Tiefen der Seele 152 Erich Fried — Aus deinen Worten. -

Die Forderung, Deutsch Solle Neben Englisch Und Französisch Zur
Wolfgang Bunzel “... dankbar daß ich entkam” Sarah Kirschs Autorexistenz im Spannungsfeld von DDR-Bezug und “Exil”-Erfahrung Seit Sarah Kirsch zu schreiben begonnen hat, stehen die Texte dieser Autorin im Spannungsfeld von Subjekt und Gesellschaft, von eigener Biographie und kollektiver Geschichtserfahrung.1 Und so verwundert es denn auch nicht, wenn sowohl vor wie nach der Übersiedlung in die Bundesrepublik die Auseinander- setzung mit den Lebensbedingungen des Individuums in der DDR einen zent- ralen Gegenstand in ihrem literarischen Schaffen bildet.2 Freilich verändert sich der Stellenwert des Themas im Lauf der Œuvre-Entwicklung auf charakteristi- sche Weise. Parallel dazu wandelt sich auch Kirschs auktoriales Selbstverständ- nis. Ziel des vorliegenden Aufsatzes ist es, die einzelnen Stationen dieses dop- pelten Transformationsprozesses nachzuzeichnen. Die Anfänge von Sarah Kirschs literarischer Produktion – 1965 erschien als Gemeinschaftsarbeit mit ihrem Ehemann Rainer der Band Gespräch mit dem Sau- rier, zwei Jahre später dann kam unter dem Titel Landaufenthalt die erste eigene Lyriksammlung heraus – fallen bezeichnenderweise mit der Neuentdeckung schriftstellerischer Subjektivität in der DDR zusammen. Für diese Entwicklung stehen u.a. Namen wie Christa Wolf im Bereich der Erzählprosa sowie Günter Kunert, Reiner Kunze, Volker Braun und Karl Mickel im Bereich der Lyrik. Das Insistieren auf dem eigenen Ich und die Wendung zur Natur – die Über- schrift Landaufenthalt ist durchaus programmatisch zu verstehen – deuten bereits eine vorsichtige Relativierung der am geschichtsmächtigen Kollektiv orientier- ten sozialistischen Ästhetik an, was jedoch nicht heißt, “daß Sarah Kirsch zu diesem Zeitpunkt ihre schriftstellerische Funktion in der sozialistischen Gesell- schaft in Frage gestellt hätte”3. Am auffälligsten ist diese Distanznahme in den 1 Auf diesen Konnex nachdrücklich aufmerksam gemacht hat vor allem Barbara Mabee in ih- rer Studie: Die Poetik von Sarah Kirsch. -
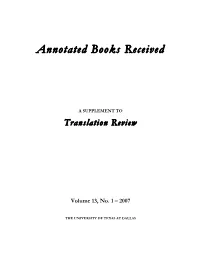
Annotated Books Received
Annotated Books Received A SUPPLEMENT TO Translation Review Volume 13, No. 1 – 2007 THE UNIVERSITY OF TEXAS AT DALLAS CONTRIBUTORS Rainer Schulte Christopher Speck DESIGNER Michelle Long All correspondence and inquiries should be directed to: Translation Review The University of Texas at Dallas Box 830688 (JO 51) Richardson TX 75083-0688 Telephone: 972-883-2092 or 2093 Fax: 972-883-6303 E-mail: [email protected] Annotated Books Received, published twice a year, is a supplement of Translation Review, a joint publication of the American Literary Translators Association and The Center for Translation Studies at The University of Texas at Dallas. ISSN 0737-4836 Copyright © 2007 by American Literary Translators Association and The University of Texas at Dallas The University of Texas at Dallas is an equal opportunity/affirmative action employer. ANNOTATED BOOKS RECEIVED 13.1 TABLE OF CONTENTS Arabic .................................................................................................................... 1 Bulgarian................................................................................................................ 5 Chinese .................................................................................................................. 5 Czech ..................................................................................................................... 8 Danish.................................................................................................................... 9 Dutch .................................................................................................................... -

Uva-DARE (Digital Academic Repository)
UvA-DARE (Digital Academic Repository) Schwarze Orchideen und andere blaue Blumen. Reformsozialismus und literatur in der DDR Delhey-Dauterstedt, Y. Publication date 2002 Link to publication Citation for published version (APA): Delhey-Dauterstedt, Y. (2002). Schwarze Orchideen und andere blaue Blumen. Reformsozialismus und literatur in der DDR. in eigen beheer. General rights It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open content license (like Creative Commons). Disclaimer/Complaints regulations If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You will be contacted as soon as possible. UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl) Download date:24 Sep 2021 15 5 11 Politik und Literatur: Literator politisch lesen - Politik literarisieren 1.11 1989: Die Schriftsteller und ihre Vision vom humanen Sozialismus Wennn es urn die politischen Ereignisse im Herbst 1989 geht, reden ostdeutsche Intellektuelle oftt von der Hofthung, die sie damals beseelte und die sich fur sie aus dem gesellschaftlichen Aufbruchh ergab, der damals möglich schien. -

Ernst Jandl Und Die Internationale Avantgarde
The Pennsylvania State University The Graduate School College of the Liberal Arts “EIN BEITRAG ZUR MODERNEN WELTDICHTUNG“ ERNST JANDL UND DIE INTERNATIONALE AVANTGARDE A Dissertation in German by Katja Stuckatz © 2014 Katja Stuckatz Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy May 2014 ii The dissertation of Katja Stuckatz was reviewed and approved* by the following: Martina Kolb Assistant Professor of German and Comparative Literature Dissertation Adviser Chair of Committee Thomas O. Beebee Edwin Erle Sparks Professor of Comparative Literature and German Stefan Matuschek Professor of German and Comparative Literature Friedrich-Schiller-University Jena (Germany) Special Signatory Daniel L. Purdy Professor of German Adrian J. Wanner Professor of Russian and Comparative Literature B. Richard Page Associate Professor of German and Linguistics Head of the Department of Germanic and Slavic Languages and Literatures *Signatures are on file in the Graduate School. iii ABSTRACT (ENGLISH) “A Contribution to Modern World Poetry” Ernst Jandl and the International Avant-Garde My dissertation uses close textual analysis and unpublished archival material to explore the poetic internationalism of the Austrian experimental poet Ernst Jandl (1925-2000). When Jandl died thirteen years ago, four of the world’s biggest newspapers (The Independent, The Times, The Daily Telegraph, and The New York Times) published obituaries to honor a poet whose œuvre marks one of the most influential contributions to German speaking poetry since World War II. This fact testifies not only to the international significance of Jandl’s lyric œuvre, but also to the relations of mutual aesthetic influence between the German and English speaking worlds after the catastrophe of World War II.