Bibliotheken: Innovation Aus Tradition
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Kleine Anfrage
Deutscher Bundestag Drucksache 12/4569 12. Wahlperiode 11.03.93 Kleine Anfrage der Abgeordneten Günter Klein (Bremen), Helmut Sauer (Salzgitter), Claus Jäger, Ulrich Adam, Anneliese Augustin, Richard Bayha, Hans-Dirk Bierling, Wolfgang Börnsen (Bönstrup), Peter Harry Carstensen (Nordstrand), Albert Deß, Anke Eymer, Ilse Falk, Dr. Kurt Faltlhauser, Dr. Karl H. Fell, Leni Fischer (Unna), Herbert Frankenhauser, Erich G. Fritz, Hans-Joachim Fuchtel, Elisabeth Grochtmann, Claus Peter Grotz, Carl-Detlev Freiherr von Hammerstein, Rainer Haungs, Klaus-Jürgen Hedrich, Manfred Heise, Dr. Renate Hellwig, Dr. h. c. Adolf Herkenrath, Ernst Hinsken, Siegfried Hornung, Dr.-Ing. Rainer Jork, Dr. Egon Jüttner, Michael Jung (Limburg), Dr.-Ing. Dietmar Kansy, Peter Kittelmann, Hartmut Koschyk, Thomas Kossendey, Dr. Rudolf Karl Krause (Bonese), Dr.-Ing. Paul Krüger, Dr. Ursula Lehr, Christian Lenzer, Editha Limbach, Theo Magin, Dr. Dietrich Mahlo, Claire Marienfeld, Erwin Marschewski, Dr. Günther Müller, Alfons Müller (Wesseling), Engelbert Nelle, Johannes Nitsch, Friedhelm Ost, Dr. Peter Paziorek, Rolf Rau, Klaus Riegert, Kurt J. (Fürth), Rossmanith, Dr. Christian Ruck, Heribert- Scharrenbroich, Christian Schmidt Dr. Rupert Scholz, Dr. Hermann Schwörer, Michael Stübgen, Dr. Klaus-Dieter Uelhoff, Alois Graf von Waldburg-Zeil, Dr. Roswitha Wisniewski, Simon Wittmann (Tännesberg), Michael Wonneberger, Benno Zierer und der Fraktion der CDU/CSU sowie der Abgeordneten Ulrich Irmer, Dr. Michaela Blunk (Lübeck), Jörg van Essen, Horst Friedrich, Jörg Ganschow, Dr. Sigrid Hoth, Jürgen Koppelin, Dr.-Ing. Karl Hans Laermann, Arno Schmidt (Dresden), Ingrid Walz, Burkhard Zurheide, und der Fraktion der F.D.P. Deutsches Personal bei inter- und supranationalen Organisationen Die Bundesrepublik Deutschland gehört mehr als 200 internatio- nalen Organisationen an und trägt einen erheblichen Teil der Kosten dieser Organisationen. -

Beschlußempfehlung Und Bericht Des Verteidigungsausschusses (12
Deutscher Bundestag Drucksache 12/3693 12. Wahlperiode 11.11.92 Sachgebiet 53 Beschlußempfehlung und Bericht des Verteidigungsausschusses (12. Ausschuß) zu dem Antrag der Abgeordneten Ulrich Adam, Dr. Walter Franz Altherr, Hans-Dirk Bierling, Paul Breuer, Georg Brunnhuber, Wolfgang Dehnel, Albert Deß, Dr. Kurt Faltlhauser, Hans-Joachim Fuchtel, Johannes Gerster (Mainz), Otto Hauser (Esslingen), Ernst Hinsken, Claus Jäger, Dr. Egon Jüttner, Christian Lenzer, Theo Magin, Dr. Dietrich Mahlo, Claire Marienfeld, Maria Michalk, Dr. Gerhard Päselt, Dr. Friedbert Pflüger, Dr. Bernd Protzner, Heinz Schemken, Graf Joachim von Schönburg-Glauchau, Stefan Schwarz, Heinrich Seesing, Bärbel Sothmann, Karl-Heinz Spilker, Karl Stockhausen, Dr. Klaus-Dieter Uelhoff, Bernd Wilz, Peter Kurt Würzbach, Benno Zierer und der Fraktion der CDU/CSU sowie der Abgeordneten Günther Friedrich Nolting, Dr. Werner Hoyer, Dr. Sigrid Semper, Jürgen Koppelin, Günther Bredehorn, Jörg van Essen, Dr. Cornelia von Teichman, Arno Schmidt (Dresden), Dr. Olaf Feldmann, Carl-Ludwig Thiele, Dr. Wolfgang Weng (Gerlingen) und der Fraktion der F.D.P. — Drucksache 12/1292 — Privatisierung der Heimbetriebsgesellschaft mbH der Bundeswehr A. Problem Die Bundesregierung wird aufgefordert, Maßnahmen zur völligen Privatisierung der Heimbetriebsgesellschaft mbH der Bundeswehr einzuleiten. B. Lösung Annahme des von den Fraktionen der CDU/CSU und F.D.P. aktualisierten Antrages, mit dem die Bundesregierung aufgefor- dert, mit der Privatisierung der Heimbetriebsgesellschaft mbH (HBG) zum 1. Januar 1993 zu beginnen, dabei die Versorgung der Soldaten in entlegenen und kleineren Standorten weiter zu Drucksache 12/3693 Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode gewährleisten und weiterhin ein preisgünstiges Angebot für wehr- dienstleistende Wehrpflichtige sicherzustellen. Mehrheitsentscheidung im Ausschuß C. Alternativen Keine D. Kosten wurden nicht erörtert. Deutscher Bundestag — 12. -

DER SPIEGEL Jahrgang 2002 Heft 13
Werbeseite Werbeseite DAS DEUTSCHE NACHRICHTEN-MAGAZIN Hausmitteilung 25. März 2002 Betr.: Titel, New Economy, Rushdie m 28. Februar 1945 war die Kindheit von Hans-Joachim Noack, 6, zu Ende. Sein AOpa nahm ihn an die Hand und sagte: „Jetzt gehen wir flüchten.“ Von Bär- walde in Pommern sollte es nach Kolberg aufs Schiff Richtung Swinemünde gehen. Endlich an Bord, kamen sowjetische Kampfflugzeuge und warfen Phosphorbomben. In Panik wurde das Schiff geräumt. Wochenlang irrte Noack mit seiner Familie im Niemandsland zwischen heranrückender Roter Armee und abziehender Wehrmacht umher. Die Erlebnisse verfolgten Noack, heute Ressortleiter Politik beim SPIEGEL, jahrelang. Wie ihm ging es Millionen anderer Deutscher, die ihre Heimat verloren, nachdem Hitler Europa mit Terror und Völkermord überzogen hatte. Das Leid der Flüchtlinge und Fortgejagten fand vor allem in den Vertriebenenverbänden Gehör. Die Generation der Nazi-Täter verrechnete es gern mit der eigenen Schuld, die Jüngeren (wie Noack) kümmerten sich vornehmlich um die Verantwortung ihrer Eltern für die Verbrechen Hitlers. „Erst jetzt scheint ein Blick auf die Deutschen auch als Opfer mög- lich zu sein“, sagt Noack, der gemeinsam mit den SPIEGEL-Redakteuren Thomas Darnstädt, 52, und Klaus Wiegrefe, 36, die Titelgeschichte schrieb – Auftakt einer vier- teiligen Serie zum Drama von Flucht und Vertreibung (Seite 36). mlagert von den Gewinnern der Internet-Ära war USPIEGEL-Korrespondentin Michaela Schießl, 40, als sie vor einem Jahr ihr Büro in San Franciscos Hancock Street bezog. Die hatten sich Luxusapartments bauen lassen, fuhren teure Autos, trugen edle Kleidung und gingen zum Essen ins Nobelrestaurant „Bacar“. „Wer in dieser Straße zur Miete wohnte, galt schon als Under- dog“, sagt Schießl. -

Jahresbericht 2006 Des Wirtschaftsrates Der CDU Ev
Jahresbericht 2006 Jahresbericht 2006 des Wirtschaftsrates der CDU e.V. im Mai 2007 vorgelegt Jahresbericht 2006 des Wirtschaftsrates der CDU e.V. Geleitwort Berlin, im April 2007 Der wirtschaftliche Aufschwung in Deutsch- land hat im Jahr 2006 alle Erwartungen übertroffen. Motor des Aufschwungs waren vor allem Deutschlands Exportwirtschaft und die Unternehmer, die seit Jahren erfolg- reich umfassende Restrukturierungsmaß- nahmen durchgeführt haben. In ihrem ers- ten Regierungsjahr hat die Große Koalition wichtige Erfolge erzielen können – insbesondere in der Europa- und Außenpolitik,bei der Föderalismusreform Stufe I und durch den Einstieg in die abschlagsfreie Rente mit 67 Jahren. Die Bundesregierung sollte den konjunkturellen Schwung nutzen, weitergehende Strukturreformen um- zusetzen – insbesondere auf dem Arbeitsmarkt, bei den Sozialversicherungen, bei den Unternehmensteuern und bei den Bund-Länder-Finanzbeziehungen. Nur so kann Deutschland das von der Bundesregierung gesteckte Ziel erreichen, bis 2015 in die Gruppe der drei führenden Nationen Europas bei Beschäftigung, Innovation und Wachstum vorzustoßen. Im Berichtsjahr 2006/2007 konnte sich der Wirtschaftsrat zu wichtigen wirtschaftspolitischen Themen erfolgreich mit eigenen Vorschlägen einbringen: Auf dem Wirtschaftstag „Deutschland erneuern – Wettbewerbsfähigkeit für Europa gewinnen“ am 1. Juni 2006 hat der Wirtschaftsrat seine Mittlerrolle zwischen Wirtschaft und Politik besonders kraftvoll wahr- genommen:Belege hierfür sind der persönliche Dialog mit der Bundeskanzlerin und -

New German Critique, No. 78, Special Issue on German
NEW GERMAN CRITIQUE NUMBER 78 * FALL 1999 G ERMANRMEDAN SRTUIDUES GEISLER AND MATTSON * AFTER THE BARDIC ERA HUMPHREYS * GERMANY'S "DUAL" BROADCASTING SYSTEM HICKETHIER * A CULTURAL BREAK: TELEVISION IN GERMANY GEISLER * WEST GERMAN MEDIA THEORY BOLZ * FAREWELL TO THE GUTENBERG GALAXY ZIELINSKI * FISSURES - DISSONANCES - QUESTIONS - VISIONS SCHUMACHER * GERMAN "B-TELEVISION" PROGRAMS MATTSON * THE GENERATION OF PUBLIC IDENTITY HUHN * LUKACS AND THE ESSAY FORM o 473 > 744., 80557 1 PRICE: U.S. 12.00 /CANADA $15.00 This content downloaded on Fri, 18 Jan 2013 06:22:27 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions NEW GERMANCRITIQUE An Interdisciplinary Journal of German Studies Special Editorsfor ThisIssue: MichelleMattson, Michael Geisler Editors:David Bathrick (Ithaca), Miriam Hansen (Chicago), Peter U. Hohendahl (Ithaca),Andreas Huyssen (New York), Biddy Martin (Ithaca), Anson Rabinbach (Princeton),Jack Zipes (Minneapolis). ContributingEditors: Leslie Adelson (Ithaca), Susan Buck-Morss (Ithaca), Geoff Eley(Ann Arbor), Gerd Gemiinden (Hanover), Agnes Heller (New York), Douglas Kellner(Austin), Eberhard Kni6dler-Bunte (Berlin), Sara Lennox (Amherst), Andrei Markovits(Ann Arbor), Eric Rentschler (Cambridge), James Steakley (Madison). ManagingEditor: Michael Richardson (Ithaca). AssistantEditors: Jill Gillespie (Ithaca), Andrew Homan (New York),Franz PeterHugdahl (Ithaca), Kizer Walker (Ithaca). GraphicsEditor: Brendan K. Bathrick(New York). Publishedthree times a yearby TELOS PRESS,431 E. 12thSt., New York,NY 10009.New German Critique -

Annual Report 2010 | Annual Report 2010 2010
600 000 1942 ANNUAL REPORT Annual Report 2010 | Annual Report 2010 2010 KfW Bankengruppe Palmengartenstrasse 5–9 The sustainability of our enterprise, globalisation, climate 60325 Frankfurt am Main change and demographic change - we are currently facing great challenges. Global challenges require consistent action. Phone +49 69 7431 0 KFW IS AWARE OF THIS RESPONSIBILITY. Fax +49 69 7431 2944 99 per cent of all German enterprises are SMEs. They form the [email protected] backbone of the German economy. The sustainability of this growth and job engine is decisive for economic development. www.kfw.de Globalisation has fundamentally changed the economic framework conditions. Increasingly countries are becoming involved in cross-border trade. Melting glaciers, rising sea levels and threatening heat waves: in order to counteract global warming, CO2 emissions must be reduced. Societies in industrialised countries continue to age, while those in the developing and transition countries are getting younger. This demo- graphic change impacts the social system, education and the economy. KEY FIGURES OF KFW BANKENGRUPPE Total commitments of KfW Bankengruppe 2008 2009 2010 Key income statement fi gures for the KfW Group 2010 2009 EUR in billions EUR in billions EUR in billions EUR in millions EUR in millions KfW Group core business (consolidated)1) 67.8 63.9 81.4 Net interest income 2,752 2,654 KfW Mittelstandsbank2) 17.0 23.8 28.5 Interest rate reductions – 558 – 571 KfW Privatkundenbank 14.9 16.1 20.0 Net commission income 273 286 KfW Kommunalbank -

Collectors & Sporting Sale
Collectors & Sporting Sale Friday 11 May 2012 11:00 Lawrences Auctioneers (Crewkerne) South Street Crewkerne Somerset TA18 8AB Lawrences Auctioneers (Crewkerne) (Collectors & Sporting Sale ) Catalogue - Downloaded from UKAuctioneers.com Lot: 750 TWO 19thC POFTMARKEN ALBUMS. The first album has POSTCARD ALBUM including Comic cards, GB content, imperf and perf examples from Baden, Bayern, Frankreich, Shipping etc. Luxembourg 25 centimes brown, Netherlands 15c orange, both Estimate: £50.00 - £70.00 used. Portugal 120 reis blue (used), Prussia, Helvetia, British Empire and Nord-Amerika including 10c green x 2, 24c etc. The second with similar but sparser content. Lot: 751 Estimate: £100.00 - £200.00 POSTCARD ALBUM a large album including GB content, Reigate, Eastbourne, Sidmouth, Weston-Super-Mare, Worcester, Bideford and many more including Scottish and Irish Lot: 760A scenes. Also with White Star line postcards etc. LARGE QTY OF CIGARETTE CARDS. various cigarette cards Estimate: £150.00 - £250.00 in albums and loose, including John Player, Churchman, Wills etc. Estimate: £60.00 - £100.00 Lot: 752 POSTCARD ALBUM including seaside resorts, Weymouth, Poole, Bournemouth etc, and some postcards of people Lot: 761 including a large postcard of the King and Queen of Spain. FIRST DAY COVERS AND STAMP PACKS. Well laid out Estimate: £50.00 - £70.00 Albums of First Day covers and the corresponding Stamp Packs. Dates of issue range from the early 1970's until 2007. (16) Albums in total. Lot: 753 Estimate: £600.00 - £800.00 POSTCARD ALBUM an album including Mabel Lucie Attwell, dogs, and various other cards. -

BLK Jahresbericht 2001 3., Durchgesehene Auflage
BLK Jahresbericht 2001 3., durchgesehene Auflage Bonn : BLK 2002, 84 S. Quellenangabe/ Citation: BLK Jahresbericht 2001. Bonn : BLK 2002, 84 S. - URN: urn:nbn:de:0111-opus-3009 - DOI: 10.25656/01:300 http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0111-opus-3009 http://dx.doi.org/10.25656/01:300 Nutzungsbedingungen Terms of use Gewährt wird ein nicht exklusives, nicht übertragbares, We grant a non-exclusive, non-transferable, individual and limited persönliches und beschränktes Recht auf Nutzung dieses right to using this document. Dokuments. Dieses Dokument ist ausschließlich für den This document is solely intended for your personal, non-commercial persönlichen, nicht-kommerziellen Gebrauch bestimmt. Die use. Use of this document does not include any transfer of property Nutzung stellt keine Übertragung des Eigentumsrechts an diesem rights and it is conditional to the following limitations: All of the Dokument dar und gilt vorbehaltlich der folgenden copies of this documents must retain all copyright information and Einschränkungen: Auf sämtlichen Kopien dieses Dokuments other information regarding legal protection. You are not allowed to müssen alle Urheberrechtshinweise und sonstigen Hinweise auf alter this document in any way, to copy it for public or commercial gesetzlichen Schutz beibehalten werden. Sie dürfen dieses purposes, to exhibit the document in public, to perform, distribute or Dokument nicht in irgendeiner Weise abändern, noch dürfen Sie otherwise use the document in public. dieses Dokument für öffentliche oder kommerzielle Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, aufführen, vertreiben oder anderweitig nutzen. Mit der Verwendung dieses Dokuments erkennen Sie die By using this particular document, you accept the above-stated Nutzungsbedingungen an. -

Noch Immer Eine Bank?
COPYRIGHT: COPYRIGHT DiesesDieses Manuskript Manuskript ist urheberrechtlich ist urheberrechtlich geschützt. geschützt. Es darf E ohnes darf Genehmigung ohne Genehmigung nicht verwertet nicht werden.verwertet Insbesondere werden. darf Insbesondere es nicht ganz darf oder es teilwe nicht iseganz oder oder in Auszügen teilweise oderabgeschrieben in Auszügen oder in sonstigerabgeschrieben Weise vervielfältigt oder in sonstiger werden. Weise Für vervielfältigRundfunkzwecket werden. darf dasFür Manuskript Rundfunkzwecke nur mit Genehmigungdarf das Manuskript von DeutschlandRadio nur mit Genehmigung / Funkhaus Berlin von Deutsch benutzt landradiowerden. Kultur benutzt werden. Deutschlandradio Kultur Länderreport vom 18.02.2010 Noch immer eine Bank? - Die Landesbanken in BW, BY, NRW und SH sowie der letzte Stand der Dinge - Autor Uschi Götz Barbara Roth Christoph Gehring Mathias Günther Red. Claus Stephan Rehfeld Sdg. 18.02.2010 - 13.07 Uhr Länge 21.48 Minuten Moderation Das schöne Geld. Die Landesbanken und der Stand der Dinge. Diverse Staatsanwaltschaften ermitteln bei diversen Landesbanken wegen möglicher Vergehen, der Steuerzahler hat seine Ermittlungen, wo sein liebes Geld geblieben ist, aufgegeben. Ihn bewegt vielleicht noch die Frage, ob die Politiker in den Kontrollgremien nichts gewusst haben oder „nur“ überfordert waren? Die Landesbanken, die Pleiten und die Politik – das ist das Thema dieser Sendung. 1 -folgt Script Sendung- Script Sendung- REGIE kurzer Effekt MOD Erst übernahm die Landesbank Baden-Württemberg die SachsenLB, der die Insolvenz drohte, dann hatte sie sich „massiv verspekuliert“ (dpa). Die größte Landesbank der Republik, die LBBW, ist in schweres Fahrwasser geraten. Vor fast 200 Jahren wurde sie gegründet „zum Wohle der ärmeren Bevölkerungsschichten“ – die Württembergische Sparkasse, aus der viele Jahre später die Landesbank Baden-Württemberg hervorging. -

Du Bist Deutschland” Bis Zur „Stiftung Marktwirtschaft” Arbeitspapier 127
AP 127 Umschlag neu 13.07.2006 14:59 Uhr Seite 1 Arbeitspapier 127 Rudolf Speth Die zweite Welle der Wirtschaftskampagnen Von „Du bist Deutschland” bis zur „Stiftung Marktwirtschaft” Arbeitspapier 127 Die zweite Welle der Wirtschaftskampagnen Von „Du bist Deutschland” bis zur „Stiftung Marktwirtschaft” Rudolf Speth 1 Dr. Rudolf Speth, Privatdozent am Fachbereich Politik- und Sozialwissenschaften der Freien Universität Berlin. Publikationen: Die stille Macht. Lobbyismus in Deutschland, Wiesbaden 2003; Die fünfte Gewalt. Lobbyismus in Deutschland, Wiesbaden 2006; Advokatorische Think Tanks, Berlin 2006. Impressum Herausgeber: Hans-Böckler-Stiftung Mitbestimmungs-, Forschungs- und Studienförderungswerk des DGB Hans-Böckler-Straße 39 40476 Düsseldorf Telefon: (02 11) 77 78-108 Fax: (02 11) 77 78-283 E-Mail: [email protected] Redaktion: Dr. Erika Mezger, Leiterin der Abteilung Forschungsförderung Best.-Nr.: 11127 Gestaltung: Horst F. Neumann Kommunikationsdesign, Wuppertal Produktion: Setzkasten GmbH, Düsseldorf Düsseldorf, Juli 2006 e 10,00 2 Arbeitspapier 127 · Die zweite Welle der Wirtschaftskampagnen Juli 2006 Inhalt I. Zusammenfassende Thesen 5 II. Bilanz der Initiativen und Kampagnen 7 III. Lobbying und PR: Neue Soziale Marktwirtschaft – strategische Neuausrichtung 11 Die Gründungshypothek 11 Keine Mehrheit für das Programm der INSM 12 Die netzwerkartige Arbeitsweise 13 Die INSM und die Medien: Partnerschaften 15 Die Lehrer als Zielgruppe und Multiplikatoren 19 IV. Die Stimmungsmacher 21 1. Die Kampagne „Du bist Deutschland” 21 Partner für Innovation 21 Das Kernziel: Stimmungsaufhellung 23 Unbeschwerter Patriotismus als neue frohe Botschaft 24 Ein Psalm 26 Klassische Mittel der Werbung: Anzeigen und TV-Spots 27 Medienunternehmen und Agenturen als politische Akteure 29 Anlage und Ablauf der Kampagne 30 Gegenattacken und der beinahe-GAU 31 2. -
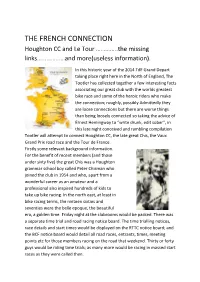
THE FRENCH CONNECTION Houghton CC and Le Tour …………..The Missing Links………………And More(Useless Information)
THE FRENCH CONNECTION Houghton CC and Le Tour …………..the missing links………………and more(useless information). In this historic year of the 2014 TdF Grand Depart taking place right here in the North of England, The Tootler has collected together a few interesting facts associating our great club with the worlds greatest bike race and some of the heroic riders who make the connection; roughly, possibly.Admittedly they are loose connections but there are worse things than being loosely connected so taking the advice of Ernest Hemingway to “write drunk, edit sober”, in this late night conceived and rambling compilation Tootler will attempt to connect Houghton CC, the late great Chis, the Vaux Grand Prix road race and the Tour de France. Firstly some relevant background information. For the benefit of recent members (and those under sixty five) the great Chis was a Houghton grammar school boy called Peter Chisman who joined the club in 1954 and who, apart from a wonderful career as an amateur and a professional also inspired hundreds of kids to take up bike racing. In the north east, at least in bike racing terms, the ninteen sixties and seventies were the belle epoque, the beautiful era, a golden time. Friday night at the clubrooms would be packed. There was a separate time trial and road racing notice board. The time trialling notices, race details and start times would be displayed on the RTTC notice board; and the BCF notice board would detail all road races, entrants, times, meeting points etc for those members racing on the road that weekend. -

Joachim Hörster CDU/CSU � 6031 D (Drucksachen 13/2627, 13/2630)
Plenarprotokoll 13/69 - eutscher Bundesta g D Stenographischer Bericht 69. Sitzung Bonn, Freitag, den 10. November 1995 Inhalt: Erklärung zu den Menschenrechtsverlet- Elisabeth Altmann (Pommelsbrunn) BÜND zungen der nigerianischen Militärregie- NIS 90/DIE GRÜNEN 6042 D rung 6031 A Jürgen Koppelin F.D.P 6045 A Absetzung des Punktes IV d von der Tages Dr. Ludwig Elm PDS 6047 C ordnung 6031 C Erich Maaß (Wilhelmshaven) CDU/CSU 6049A Erweiterung und Abwicklung der Tages Dr. Ludwig Elm PDS (Erklärung nach § 30 ordnung 6031 D GO) 6050D Dr. Peter Glotz SPD 6051 A Begrüßung des Außenministers der Schweiz 6095 D Dr. Jürgen Rüttgers, Bundesminister BMBF 6053 A Zur Geschäftsordnung Haushaltsgesetz 1996 Joachim Hörster CDU/CSU 6031 D (Drucksachen 13/2627, 13/2630) . 6057 B Ottmar Schreiner SPD 6032 B Annelie Buntenbach BÜNDNIS 90/DIE Tagesordnungspunkt II: GRÜNEN 6033 B a) Dritte Beratung des von der Bundesre- Ina Albowitz F.D.P.B 6034 B gierung eingebrachten Entwurfs eines Dr. Dagmar Enkelmann PDS 6034 D Gesetzes über die Feststellung des Bundeshaushaltsplans für das Haus- Tagesordnungspunkt I: haltsjahr 1996 (Haushaltsgesetz 1996) (Drucksachen 13/2000, 13/2593, 13/ Fortsetzung der zweiten Beratung des 2601 bis 13/2626, 13/2627, 13/2630) . 6057 C von der Bundesregierung eingebrach- ten Entwurfs eines Gesetzes über die b) Beschlußempfehlung und Bericht des Feststellung des Bundeshaushaltsplans Haushaltsausschusses zu der Unterrich- für das Haushaltsjahr 1996 (Haushalts- tung durch die Bundesregierung: Der gesetz 1996) (Drucksachen 13/2000, Finanzplan des Bundes 1995 bis 1999 13/2593) 6035 B (Drucksachen 13/2001, 13/2593, 13/2631) 6057 D Helmut Wieczorek (Duisburg) SPD . 6058 A Einzelplan 30 Hans-Peter Repnik CDU/CSU 6062 A Bundesministerium für Bildung, Wis- senschaft, Forschung und Technologie Oswald Metzger BÜNDNIS 90/DIE GRÜ (Drucksachen 13/2622, 13/2626) NEN 6067 B Dieter Schanz SPD 6035 C Dr.