Konzert I Peter Lang
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
Elaine Fitz Gibbon
Elaine Fitz Gibbon »Beethoven und Goethe blieben die Embleme des kunstliebenden Deutschlands, für jede politische Richtung unantastbar und ebenso als Chiffren manipulierbar« (Klüppelholz 2001, 25-26). “Beethoven and Goethe remained the emblems of art-loving Germany: untouchable for every political persuasion, and likewise, as ciphers, just as easily manipulated.”1 The year 2020 brought with it much more than collective attempts to process what we thought were the uniquely tumultuous 2010s. In addition to causing the deaths of over two million people worldwide, the Covid-19 pandemic has further exposed the extraordinary inequities of U.S.-American society, forcing a long- overdue reckoning with the entrenched racism that suffuses every aspect of American life. Within the realm of classical music, institutions have begun conversations about the ways in which BIPOC, and in particular Black Americans, have been systematically excluded as performers, audience members, administrators and composers: a stark contrast with the manner in which 2020 was anticipated by those same institutions before the pandemic began. Prior to the outbreak of the novel coronavirus, they looked to 2020 with eager anticipation, provoking a flurry of activity around a singular individual: Ludwig van Beethoven. For on December 16th of that year, Beethoven turned 250. The banners went up early. In 2019 on Instagram, Beethoven accounts like @bthvn_2020, the “official account of the Beethoven Anniversary Year,” sprang up. The Twitter hashtags #beethoven2020 and #beethoven250 were (more or less) trending. Prior to the spread of the virus, passengers flying in and out of Chicago’s O’Hare airport found themselves confronted with a huge banner that featured an iconic image of Beethoven’s brooding face, an advertisement for the Chicago Symphony Orchestra’s upcoming complete cycle Current Musicology 107 (Fall 2020) ©2020 Fitz Gibbon. -

Beethoven's 250 Anniversary
PIANO MAGAZINE WINTER 2020–2021 | VOL 12 | NO 5 CELEBRATING TH BEETHOVEN’S 250 ANNIVERSARY AND MUSICAL INNOVATORS WINTER 2020–2021 Anne-Marie Commissioning Stories McDermott: Composition & Celebrating | VOL 12 | NO 5 $12.99 VOL of Pianists’ Creativity Artist, Leader, Innovator Underrepresented Composers CLAVIERCOMPANION.COM / a magazine for people who are passionate about the piano PIANO MAGAZINE PUBLISHER The Frances Clark Center for Keyboard Pedagogy EDITOR-IN-CHIEF / CHIEF CONTENT DIRECTOR WHAT YOU’LL Pamela D. Pike FIND INSIDE SENIOR EDITOR / DIRECTOR OF DIGITAL CONTENT Andrea McAlister • SENIOR EDITORS Steve Betts RESOURCES TO SUPPORT Craig Sale OUR COMMUNITY IN COLUMN EDITORS MUSICAL ENGAGEMENT Linda Christensen, Technology & ADVOCACY Vanessa Cornett, Healthy Playing, Healthy Teaching Barbara Kreader Skalinder, Teaching • Artina McCain, Diversity, Equity, and Inclusion Nicholas Phillips, Recordings COVERAGE OF THE Suzanne Schons, Books, Materials, and Music NEWEST TRENDS & IDEAS Helen Smith Tarchalski, Keyboard Kids IN PERFORMANCE Jerry Wong, International Richard Zimdars, Poetry Corner AND PEDAGOGY EXECUTIVE DIRECTOR & CEO • Jennifer Snow PRACTICAL SOLUTIONS DESIGN & PRODUCTION FOR PIANO TEACHING studio Chartreuse & LEARNING PROFILES COPY EDITORS Rebecca Bellelo • Kristen Holland Shear THOUGHT-PROVOKING DIGITAL OPERATIONS Shana Kirk IDEAS FROM A RANGE OF CONTRIBUTORS ADVERTISING COORDINATOR Anna Beth Rucker • CUSTOMER SUPPORT Morgan Kline REVIEWS OF THE LATEST MUSIC, RECORDINGS, CIRCULATION The Frances Clark Center for Keyboard Pedagogy BOOKS, TECHNOLOGY, & EDUCATIONAL EDITORIAL BOARD Nancy Bachus PRODUCTS Alejandro Cremashi Barbara Fast Rebecca Grooms Johnson Scott McBride Smith Winter Issue 2020-2021 Vol 12 No 5 / 1 CONTENTS Anne-Marie McDermott: ARTIST, LEADER, INNOVATOR by Andrea McAlister 12 Photo: Group lesson at NSMS (1960s) EXPLORE LEARN TEACH 9 EDITOR’S LETTER 32 THE GIFT OF NEW 36 BECOMING WEAVERS: Pamela D. -
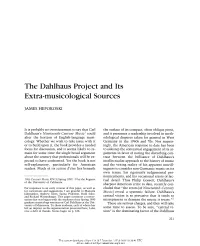
The Dahlhaus Project and Its Extra-Musicological Sources
The Dahlhaus Project and Its Extra-musicological Sources JAMES HEPOKOSKI It is probably no overstatement to say that Carl the surface of its compact, often oblique prose, Dahlhaus's Nineteenth-Century Music' could and it presumes a readership involved in meth- alter the horizon of English-language musi- odological disputes taken for granted in West cology. Whether we wish to take issue with it Germany in the 1960s and 70s. Not surpris- or to build upon it, the book provides a needed ingly, the American response to date has been focus for discussion, and it seems likely to re- to sidestep the contextual engagement of its ar- main for some time the single broad argument guments in favor of noting the disturbing con- about the century that professionals will be ex- trast between the brilliance of Dahlhaus's pected to have confronted. Yet the book is not intellectualist approach to the history of music self-explanatory, particularly for American and the vexing reality of his apparent unwill- readers. Much of its raison d'etre lies beneath ingness to consider non-Germanic music on its own terms, his rigorously judgemental pro- nouncements, and his occasional errors of fac- 19th-Century Music XIV/3 (Spring 1991). ? by the Regents tual detail. Thus Philip Gossett, Dahlhaus's of the University of California. sharpest American critic to date, recently con- For responses to an early version of this paper, as wellcluded as that "the errors [of Nineteenth-Century for corrections and suggestions, I am grateful to Manuela Music] reveal a systemic failure. Dahlhaus's Jahrmirker, Andrew Jones, Sanna Pederson, Ruth Solie, and Richard Wattenbarger. -

Die Relationen Der Musik Hören. Zu Wilhelm Furtwänglers Interpretationskunst Henrik Holm
IZPP. Ausgabe 1/2016. Themenschwerpunkt „Demenz und Ethik“. Henrik Holm: „Die Relationen der Musik hören.“ Herausgeber: Wolfgang Eirund und Joachim Heil ISSN: 1869-6880 IZPP | Ausgabe 1/2016 | Themenschwerpunkt „Demenz und Ethik“ | Arbeiten zu anderen Themen Die Relationen der Musik hören. Zu Wilhelm Furtwänglers Interpretationskunst Henrik Holm Zusammenfassung Die Aufnahmen mit Furtwängler am Dirigentenpult rufen monumentale und faszinierende Hörerfahrungen hervor, besonders die aus den Kriegsjahren. Warum erfährt Furtwängler immer noch eine bewundernde Wert- schätzung? In diesem Aufsatz möchte ich Furtwänglers Interpretation von Beethovens neunter Symphonie vor dem Hintergrund seines interpretationsästhetischen Denkens thematisieren. Das Ziel ist es, Furtwänglers Interpretationskunst als eine Sache der ästhetischen Erfahrung zu verorten. Schlüsselwörter Musikphilosophie, Ästhetik, musikalische Interpretation Abstract Still today, the German conductor Wilhelm Furtwängler fascinates and causes monumental listening-experi- ences, especially through the recordings of his wartime-concerts. Why do we appreciate them to such a degree? What kind of listening-experience is this? In this article, I will discuss Furtwänglers interpretation of the beginning of Beethoven’s ninth symphony on the background of his thinking about musical interpretation and performance. My aim is to understand Furtwänglers interpretation as a genuine case of aesthetic experience. Keywords Philosophy of music, aesthetics, musical interpretation Einleitung Wilhelm Furtwängler -

September 2008 Ausstellungen Menschen Im Strom Der Stadt – Fotografien Von Bis 27.9
mberSeptemberSept Der Gasteig im September 2008 Ausstellungen Menschen im Strom der Stadt – Fotografien von bis 27.9. Martin Schellenberger Bibl / Ebene 2.1 + 2.2 Martin Schellenberger fotografiert Menschen in München: Eintritt frei Der Künstler sucht mit seiner exzellenten Beobachtungs- gabe nach alltäglichen Geschehnissen und Situationen in der Großstadt München und bildet die Menschen auf der Straße auf Porträts ab, die zum Nachdenken anregen. Er sieht seine Aufgabe darin, den Wandel der Zeit und das Thema der Vergänglichkeit – mithilfe von Momentaufnahmen von Menschen – fotografisch umzusetzen. (Bibl) 70. Jahrestag – Entzug der Approbation jüdischer 25.9.–16.10. Ärztinnen und Ärzte im Nationalsozialismus Glashalle, 1. OG Unter der Schirmherrschaft von Charlotte Knobloch, Präsidentin Eintritt frei der Israelitischen Kultusgemeinde München Am 30. September 2008 jährt sich zum 70sten Mal, dass Eröffnung: jüdischen Ärztinnen und Ärzten per Gesetz vom 25. Juli 1938 Mi, 24.9., 19.00 Uhr verboten wurde, ihren Beruf weiter auszuüben. Was darunter zu verstehen war, wie sich das Berufsverbot in Gesetzen, Verordnungen und praktisch-politischer Umsetzung niederschlug, wie Lebensgeschichten banal bürokratisch zer- stört wurden, dokumentiert diese Ausstellung. Im Gedenken an alle diese Menschen und ihre Familien werden Einzel- schicksale exemplarisch porträtiert, indem sie selbst zu Wort kommen in Dokumenten, Briefen und Erinnerungen. (Dr. Hansjörg Ebell, München, in Zusammenarbeit mit ÄKBV, KVB, KZVB, ZBV, KR) Die Kinderbuchbrücke – 26.9.–30.10. Über die Anfänge der Internationalen Jugend- Glashalle, 1. OG bibliothek in der Münchner Nachkriegszeit Eintritt frei Die 1949 in der Kaulbachstraße eröffnete Internationale Jugendbibliothek war in der Münchner Nachkriegszeit eine Eröffnung: demokratische, weltoffene Insel für Kinder und Jugendliche. Hier wurde Do, 25.9., 19.00 Uhr lange Verbotenes gelesen und über Literatur und Politik diskutiert. -

THE ART of CARLOS KLEIBER Carolyn Watson Thesis Submitted In
GESTURE AS COMMUNICATION: THE ART OF CARLOS KLEIBER Carolyn Watson Thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Conservatorium of Music University of Sydney May 2012 Statement of Originality I declare that the research presented here is my own original work and has not been submitted to any other institution for the award of a degree. Signed: Carolyn Watson Date: ii Abstract This thesis focuses on the art of orchestral conducting and in particular, the gestural language used by conductors. Aspects such as body posture and movement, eye contact, facial expressions and manual conducting gestures will be considered. These nonverbal forms of expression are the means a conductor uses to communicate with players. Manual conducting gestures are used to show fundamental technical information relating to tempo, dynamics and cues, as well as demonstrating to a degree, musical expression and conveying an interpretation of the musical work. Body posture can communicate authority, leadership, confidence and inspiration. Furthermore, physical gestures such as facial expressions can express a conductor’s mood and demeanour, as well as the emotional content of the music. Orchestral conducting is thus a complex and multifarious art, at the core of which is gesture. These physical facets of conducting will be examined by way of a case study. The conductor chosen as the centrepiece of this study is Austrian conductor, Carlos Kleiber (1930-2004). Hailed by many as the greatest conductor of all time1, Kleiber was a perfectionist with unscrupulously high standards who enjoyed a career with some of the world’s finest orchestras and opera companies including the Vienna Philharmonic, La Scala, Covent Garden, the Met and the Chicago Symphony. -

Ludwig Van Beethoven Eine Sendereihe Von Eleonore Büning
Sonntag, 25. Oktober 2020 15.04 – 17.00 Uhr Ludwig van Beethoven Eine Sendereihe von Eleonore Büning 43. Folge: „Versuch über die wahre Art, Beethovens Klaviersonaten zu spielen“ Willkommen zur Beethovenreihe, ich grüße Sie! Diese Folge heute beginnt in Des- Dur. Fünf Vorzeichen hat das Klavierstück, das Sie gleich hören werden, jede Menge schwarze Tasten. Aber davon werden Sie nicht viel merken. Es ist eines der kürzes- ten, sonnigsten Stücke, die Ludwig van Beethoven je geschrieben hat. So kurz ist es, dass es auf nur eine Din-A-4-Seite passt. Und so stillvergnügt, dass es, trotz sei- ner Berühmtheit, schon öfters übersehen wurde: Sony 19075 Musik 1): Ludwig van Beethoven: Sonate cis-moll, op. 8431826 27 Nr.2 („Mondschein“). Daraus: 2.Satz, Alle- 2:05 gretto/Trio LC 06868 CD 4 Igor Levit (Klavier) (2017/2019) Track <10> „Allegretto“ heißt dieser Satz aus der Klaviersonate op. 27 Nr. 2 von Ludwig van Beethoven. Igor Levit spielte. Dieses Musikstück steht in der seltenen Tonart Des-Dur und es gehört zu den be- kanntesten Unbekannten der Beethovenliteratur – als Mittelsatz der überaus popu- lären sogenannten „Mondschein“-Sonate, die in der ebenfalls überaus seltenen Tonart cis-Moll steht. Wie kann das zusammengehen: 5 b-Vorzeichen und 4 Kreuz- Vorzeichen? Ganz einfach: Das Ohr ruckelt sich das zurecht. Es deutet den An- fangston des zweiten Satzes, das „Des“, enharmonisch um in ein „Cis“. Möglich ist das natürlich nur dank des wohltemperierten Klaviers. Beethoven liebte solche Scherze! Dieses Allegretto in Des ist freilich nicht selbst berühmt, es verbindet nur die bei- den eigentlichen Berühmtheiten. Davor steht das pedaltrunkene Traum-Adagio, mit der bestgeliebten, meistmissbrauchten Mondscheinmelodie. -

Der Gasteig Im März 2009 Ausstellungen »Daheim in Der Fremde«
MärzMärzMär Der Gasteig im März 2009 Ausstellungen »Daheim in der Fremde«. Eine Fotoausstellung von bis 2.3. Ralf Gerard Glashalle, 1. OG In München leben Menschen aus 186 verschiedenen Eintritt frei Nationen. Ihnen verdankt die Stadt ihre kulturelle Viel- falt, die aber auch Fragen zum Umgang mit Menschen anderer Kulturen aufwirft. Der Fotograf Ralf Gerard hat anonyme Handportraits auslän- discher Mitbürger/innen angefertigt und ihnen persönliche Schlüssel- bunde zugeordnet. Die Fotos schlagen Brücken zwischen dem Individu- ellen der Hände und der gesellschaftlichen Dimension der Schlüssel und ermöglichen so dem Betrachter, sich mit dem »Fremden« auseinander zu setzen. (Friedrich-Ebert-Stiftung, München) Die Stille des sich im Verfall Begriffenen. 2.3.–30.5. Fotografien von Martin Schellenberger Mo–Fr 10.00–19.00 Uhr Martin Schellenberger lässt die Betrachter seiner Foto- Sa 10.00–16.00 Uhr grafien teilhaben am Gefühl von Ordnung und Chaos, MSB / Ebene 2.1 und 2.2 von Stille und Vergänglichkeit der »urbanen Natur«: Eintritt frei »Blanke Ziegelwände, Beton, verrottender Stahl, zerborstenes Glas, abgebrochener Putz, zersplitternde Holzbalken – von Eröffnung: ihnen geht eine unglaubliche Faszination aus und sie erwecken in mir ein Di 3.3., 17.00 Uhr Gefühl von Stille.« (MSB) Antisemitismus? Antizionismus? Israelkritik? 6.–31.3. Die Ausstellung zeigt anhand aktueller Formen des Glashalle, 1. OG Antisemitismus in Deutschland und Europa, wie sich Eintritt frei judenfeindliche Stereotype in allen gesellschaftlichen Gruppen bis heute gehalten haben und wie sie immer Eröffnung: wieder virulent werden. Do. 5.3., 19.00 Uhr Juden werden heute kaum noch als »Rasse« oder wegen ihrer Religion diskriminiert. Es wird ihnen vielmehr – an antisemitische Verschwörungs- (siehe auch 12.–14., theorien und Allmachtsphantasien anknüpfend – unterstellt, Einfluss 16., 21. -

Programm Der 2.CLFT 2004
2. Carl-Loewe-Festtage 26. November – 28. November 2004 in Löbejün Programmschrift Veranstalter: Stadt Löbejün Internationale Carl-Loewe-Gesellschaft e.V. Carl-Loewe-Denkmal in Löbejün IMPRESSUM Herausgeber: Internationale Carl-Loewe-Gesellschaft e.V. (ICLG) Carl-Loewe-Forschungs- und Gedenkstätte im Carl-Loewe-Haus Am Kirchhof 2 D-06193 Löbejün Tel.: 034603-7 11 88 Fax: 034603-7 11 89 E-Mail: www.carl-loewe-gesellschaft.de Internet: [email protected] Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 10.00 Uhr – 16.00 Uhr (und nach Vereinbarung) Redaktion und Gestaltung: Christian G. Ebert Andreas Porsche Dr. Wolfgang Rathgen Fotonachweis: Carl-Loewe-Archiv der Carl-Loewe-Forschungs- und Gedenkstätte Konzert- und Künstleragenturen Dr. Wolfgang Rathgen Druck und Verarbeitung: Schäfer Druck & Verlag GmbH Gewerbegebiet Am Dachsberg Kochstedter Weg 3 06179 Langenbogen Titelbild: Carl Loewe nach einem Gemälde von Most 2 ZUM GELEIT „Ja das ist ein ernster, mit Bedeutung, die schöne Musik und Sprache behandelnder, nicht hoch genug zu ehrender Meister echt und wahr …!“ Richard Wagner über Carl Loewe Nach der erfolgreichen Premiere im Jahre 2002 werden zu den von der Internationalen Carl-Loewe-Gesellschaft e.V. (ICLG) und der Stadt Löbejün gemeinsam veranstalteten 2. Carl-Loewe-Festtagen erneut namhafte Künstler und Orchester in der Geburtsstadt des bedeutenden Komponisten der Romantik Carl Loewe (1796-1869) erwartet. Als Ehrengast der Festtage erhält Kammersänger Prof. Dr. Dietrich Fischer-Dieskau in Würdigung für sein Lebenswerk und als herausragender Loewe-Interpret die Ehrenmitgliedschaft der Internationalen Carl-Loewe-Gesellschaft e.V. Carl Loewe gehörte in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts zweifellos zu den herausragendsten und geachtetsten Komponistenpersönlichkeiten seiner Zeit. -

Download Booklet
1 Bewahrung des Unwiederholbaren Festspiele auch in Gegenwart und Zukunft 1920 wurden die Salzburger Festspiele ge- unvollständig wäre. gründet. Seither treffen einander alljährlich an einem der Schnittpunkte europäischer Preserving the Unrepeatable SALZBURGER FESTSPIELE 1978 Kultur Künstler und Publikum aus aller Welt. The Salzburg Festival was founded in 1920. Viel geliebt und oft gescholten waren die Ever since then artists and music lovers from Salzburger Festspiele in diesem Jahrhundert around the world have been meeting annual- den unterschiedlichsten Veränderungen ly at this crossroads of European culture. 23. August Kleines Festspielhaus ausgesetzt – und doch: Was die Väter des Much loved and often chided, the Salz- Festspielgedankens als Vision entwickelt burg Festival was exposed to many and va- 5. Liederabend hatten – einen Ort, an dem Kunst unter außer- ried changes during the 20th century. Yet the ordentlichen Bedingungen ‚Ereignis‘ wird –, original idea as envisioned by its founders – a das hat sich auf wunderbare Weise immer place where art could flourish under extraor- wieder neu bestätigt. dinarily favourable conditions, where it could In beinahe jedem Festspielsommer hat es become a truly great event – has been con- FRANZ SCHUBERT (1797–1828) in Salzburg Aufführungen gegeben, die von firmed time and again in wonderful ways. den Mitwirkenden, aber auch vom Publikum Almost every summer there have been per- Winterreise – Liederzyklus nach Gedichten xx’xx als ‚unwiederholbar‘ empfunden wurden. formances in Salzburg that the participants von Wilhelm Müller Solche Eindrücke zu bewahren, vermag – au- as well as the public have felt to be un- ßer der lebendigen Erinnerung – einzig das repeatable. Apart from people’s memories, 1 Gute Nacht xx’xx akustische Dokument. -

Prof. Dr. Joachim Kaiser Musik-, Literatur- Und Theaterkritiker Im Gespräch Mit Dr
BR-ONLINE | Das Online-Angebot des Bayerischen Rundfunks Sendung vom 26.04.2004, 20.15 Uhr Prof. Dr. Joachim Kaiser Musik-, Literatur- und Theaterkritiker im Gespräch mit Dr. Ernst Emrich Emrich: Grüß Gott, verehrte Zuschauer, ich begrüße Sie zum Alpha-Forum. Gast im Studio ist heute Professor Joachim Kaiser. Wer Professor Joachim Kaiser ist, wissen diejenigen, die ihn kennen; diejenigen, die ihn nicht kennen, werden es sofort erfahren. Professor Kaiser, Sie erlauben mir, dieses Gespräch nicht mit einer Frage zu beginnen, sondern mit einem Zitat. Es stammt von einem Kollegen von Ihnen, von Marcel Reich-Ranicki. Er hat vor gut zehn Jahren bereits Folgendes über Sie geschrieben. Er hat Sie bezeichnet als den "einzigen deutschsprachigen Kritiker von Rang und Format, der gleichermaßen unterhaltsam und belehrend, geistreich und urteilssicher über Musik, Literatur und Theater zu schreiben vermag." Er hat vergessen zu sagen, dass Sie auch darüber zu sprechen vermögen. In der Tat ist das etwas Besonderes; oder gab es das früher schon einmal jemanden, der als Kritiker eine solche Bandbreite bediente, nämlich Musik, Literatur und Theater? Kaiser: Na ja, das ist doch ein bisschen ungewöhnlich. Und es ist ja auch ein bisschen unseriös, denke ich manchmal. Schauen Sie, als Sie das soeben vorlasen, dachte ich, "Mein Gott, diese Vielseitigkeit!". Und ich erlebe es auch gelegentlich, dass die Theaterleute sagen: "Was er über Musik schreibt, ist ja ganz interessant!" Während die Musiker sagen: "Seine literarischen Dinge lese ich ganz gerne." Aber eigentlich steckt in dieser Fülle so ein bisschen auch der Vorwurf, er sei offenbar ein musischer Dilettant und kennt sich nicht so genau aus wie jemand, der ein absoluter Spezialist ist. -

„Er Redet Leicht, Schreibt Schwer“ Theodor W. Adorno Am Mikrophon
„Er redet leicht, schreibt schwer“ Theodor W. Adorno am Mikrophon Michael Schwarz Theodor W. Adorno, ca. Mitte der 1960er-Jahre (Foto: Peter Zollna) Adorno als Redner und Sprecher – das ist ein zeitgeschichtlich brachliegendes Feld. Noch gibt es keine Monographie, die sein mündliches Wirken in der Öffentlichkeit genauer erkundet.1 Die folgenden Überlegungen stehen im Zu- sammenhang mit einem Publikationsprojekt, das diesem Desiderat begeg- nen soll – auf der Basis der schriftlichen und akustischen Quellen im Theodor W. Adorno Archiv. 2 Das Rundfunkstudio und der Vortragssaal gehörten zu Adornos wichtigsten Wirkungsstätten. Er hatte mehr Hörer als Leser, und 1 Vgl. aber zu Adornos Rundfunktätigkeit: Clemens Albrecht, Die Massenmedien und die Frank- furter Schule, in: ders. u.a., Die intellektuelle Gründung der Bundesrepublik. Eine Wirkungsge- schichte der Frankfurter Schule, Frankfurt a.M. 1999, S. 203-246; Monika Boll, Nachtprogramm. Intellektuelle Gründungsdebatten in der frühen Bundesrepublik, Münster 2004; Klaus Reichert, Adorno und das Radio, in: Sinn und Form 62 (2010), S. 454-465. Zeithistorische Forschungen/Studies in Contemporary History 8 (2011), S. 286-294 © Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen 2011 ISSN 1612–6033 Theodor W. Adorno am Mikrophon 287 seine Auditorien waren umfassender als sein Lesepublikum. Durch das Radio konnte er seinen Wirkungskreis vervielfachen, also Zehntausende, mitunter wohl auch Hunderttausende erreichen.3 Adorno war sich dieser Verhältnisse durchaus bewusst, zeigte aber die Neigung, seine mündlichen Aktivitäten als Nebensachen darzustellen. Sie hing mit seinem schriftstellerischen Selbstver- ständnis zusammen. Dagegen verlangt eine zeithistorische Einschätzung seines Wirkens, in Adorno nicht nur den Autor zu sehen, sondern zugleich den öf- fentlichen Redner und Sprecher – seine intellektuelle Praxis also nicht auf das Schreiben zu verengen.