Ein Dorf Sieht Schwarz“ © 2017 2
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
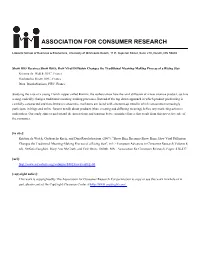
Show Bizz Becomes Show Buzz; How Viral Diffusion Changes The
ASSOCIATION FOR CONSUMER RESEARCH Labovitz School of Business & Economics, University of Minnesota Duluth, 11 E. Superior Street, Suite 210, Duluth, MN 55802 Show Bizz Becomes Show Buzz; How Viral Diffusion Changes the Traditional Meaning-Making Process of a Rising Star Kristine de Walck, HEC, France Gachoucha Kretz, HEC, France Dina Rasolofoarison, HEC, France Studying the case of a young French rapper called Kamini, the authors show how the viral diffusion of a new creative product, such as a song, radically changes traditional meaning-making processes. Instead of the top-down approach in which product positioning is carefully constructed and transferred to consumers, marketers are faced with a bottom-up trend in which consumers increasingly participate in blogs and online forums to talk about products (thus, creating and diffusing meaning) before any marketing action is undertaken. Our study aims to understand the interactions and tensions between market forces that result from this pro-active role of the consumer. [to cite]: Kristine de Walck, Gachoucha Kretz, and Dina Rasolofoarison (2007) ,"Show Bizz Becomes Show Buzz; How Viral Diffusion Changes the Traditional Meaning-Making Process of a Rising Star", in E - European Advances in Consumer Research Volume 8, eds. Stefania Borghini, Mary Ann McGrath, and Cele Otnes, Duluth, MN : Association for Consumer Research, Pages: 434-437. [url]: http://www.acrwebsite.org/volumes/14013/eacr/vol8/E-08 [copyright notice]: This work is copyrighted by The Association for Consumer Research. For permission to copy or use this work in whole or in part, please contact the Copyright Clearance Center at http://www.copyright.com/. -

Course Number (When Applicable) Course Title French 2 Name of Assignment (Title of Book(S), Author, Edition, and ISBN (When Appl
Course Number (when applicable) Course Title French 2 Name of Assignment (title of book(s), Author, Edition, and ISBN (when applicable) See assignment sheet. Expectations/Instructions for Student When Completing Assignment Watch, interpret, and comment on the film Bienvenue à Marly-Gomont One Essential Question for Assignment How has modern French society been enriched by immigration from former French colonies? One Enduring Understanding for Assignment Films reflect the morals and values of a society. Parent Role and Expectations Students work independently. Estimated Time Requirement 3-4 hours Stone Ridge Département des langues Français 2 2018-2019 Travail d’été Dr. Leslie Harlin Activité 1: un paragraphe What did you do this summer? Write a paragraph of 5 sentences in the past tense. Pay attention to the usage of the passé composé versus the imparfait. For the passé composé, pay attention to the choice of auxiliary verb and agreement of the past participle. Activité 2: un film “Bienvenue à Marly-Gomont” This film is available on Netflix under the title “The African Doctor”, or may be purchased. Introduction au film: Durée : 94m Date de sortie en France : 8 juin 2016 Distributeur: Mars Films Réalisation : Julien Rambaldi Synopsis Ce film est inspiré d’une histoire vraie. In 1975, Seyolo Zantoko, a young doctor from Kinshasa in the Democratic Republic of Congo, receives the opportunity to become a country doctor in a rural village in France, what the French call “la France profonde”. In 1975, outside of Paris, France was not as multicultural as it is today and the inhabitants were afraid of him. -

Les Matinées FLE Présentent
Les matinées FLE présentent à partir du film : Bienvenue à Marly-Gomont Cahier de l’apprenant 1 Table des matières Préambule ..................................................................... 3 Activités pédagogiques ................................................. 4 Tout public Sensibilisation ................................................................................4 Niveau débutant Analyser l’affiche du film ...............................................................6 Décrire les personnages ................................................................7 Exprimer une émotion ...................................................................9 Niveau intermédiaire Découverte de la bande annonce .................................................. 11 Parler de ses expériences ...............................................................13 Niveau avancé Analyse du clip : « Marly-Gomont ». ............................................. 15 Les préjugés en atelier .................................................. 19 2 Préambule À l’occasion de sa 11e édition du Cinéma des Cultures, Carrefour des Cultures propose « Lumières sur la citoyenneté » et, dans cette lignée, consacre ce carnet à la citoyenneté en classe de FLE, pour analyser notre rapport avec l’Altérité. Tant il est vrai que le cinéma peut constituer un élément moteur de l’apprentissage, soit en tant que support, soit comme projet. Dans ce carnet, vous trouverez tout à la fois des activités et des éclairages méthodologiques pour se former à la citoyenneté sans jamais -

Bienvenue À Marly-Gomont
Nom:_______________________________________________Date:____________Bloque:_______ Bienvenue à Marly-Gomont avant de regarder Voici la famille ZANTOKO. Ils viennent de Zaïre (qui est maintenant la République Démocratique du Congo), en Afrique, où ils vivaient à la capitale, Kinshasa. La famille démenage à Marly-Gomont, un village qui se trouve au nord de Paris, en France. Kinshasa Marly-Gomont Écrivez au moins 5 phrases qui comparent Kinshasa et Marly Gomont. 1. ________________________________________________________________ 2. ________________________________________________________________ 3. ________________________________________________________________ 4. ________________________________________________________________ 5. ________________________________________________________________ en regardant Quelles sont les premières impressions des ZANTOKO quand ils arrivent à Marly-Gomont pour la première fois ? ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Quelles sont les premières impressions des gens de Marly-Gomont la première fois qu’ils ont vu les ZANTOKO ? ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Pourquoi est-ce que les gens de Marly n’acceptent pas leur nouveau médecin, Dr. Zantoko ? ___________________________________________________________________ Nommez deux fois où Seyolo était embarrassé par sa famille. ___________________________________________________________________ -

Ein Dorf Sieht Schwarz – Filmbegleitmaterial
Stab u d Besetzu g Origi altitel: Bienven e à Marly-Gomont. Regie: J lien Rambaldi. Drehbuch: J lien Rambaldi, Benoît Graffin & Kamini Zantoko. Kamera: Yannick Ressigeac. Sch itt: Stephane Pereira. Sze e bild: Alain Veissier. Kostümbild: Emman elle Yo chnovski. Maske bild: Françoise Q ilichini (Maq illage), Antonella Prestigiacomo (Coiff re). Musik: Emman el Rambaldi. Darsteller: Marc Zinga (Seyolo), Aïssa Maïga (Anne), Bayron Lebli (Kamini als Kind), Médina Diarra (Sivi als Kind), Jean-Benoît Uge x (Der Bürgermeister), R f s (Jean), Jonathan Lambert (Lavigne) [in der Reihenfolge der Titelseq enz], Kamini Zantoko (Stimme von Kamini als Er- wachsener) .a. Ki ostart: 20.04.2017 (DE). Verleih: Prokino Filmverleih (DE). Lä ge: 93:47 Min. (24 fps). FSK: ohne Altersbeschränk ng. Auszeich u ge : P blik mspreis St ttgart bei den 33. Französischen Filmtagen Tübingen/St ttgart. IKF-Empfehlu g: Klassen: Sek I (ab Klasse 9) Sek II Fächer: Französisch, Sozialk nde/Politik, Sozialwesen Pädagogik, Psychologie, Ethik, Religion Themen: Migration, Integration, Stereotype, Vor rteile, Fremdenfeindlichkeit, Rassism s, M ltik lt relle Gesellschaft, C lt re-Clash-Komödien Kurzi halt Frankreich 1975: Seyolo Zantoko ist Arzt nd stammt a s dem Kongo. Als er einen Job in einem kleinen Kaff nördlich von Paris angeboten bekommt, beschließt er, mit seiner Familie mz ziehen. Sie erwarten Pariser Stadtleben, treffen aber a f Dorfbewohner, die z m ersten Mal in ihrem Leben einem afrikanischen Arzt begegnen nd alles t n, m den „Exoten“ das Leben schwer z machen. Aber wer m tig seine Heimat verlassen hat nd einen Ne anfang in einem fremden Land wagt, lässt sich so leicht nicht nterkriegen.. -

The Good Doctor La Nouvelle Série Médicale Événement
N°638 PROGRAMMES DU 8 AU 14 SEPTEMBRE 2018 RÉGIONS Série policière M6 | SAMEDI 21.00 NCIS Los Angeles Saison 9 inédite La vie secrètes des chats TF1 | DIMANCHE 16.05 Chats des villes, chats des champs INÉDIT . Il était une fois MARDI 11 SEPT. FRANCE 4 | VENDREDI 20.55 21H00 Qu’avez-vous fait de vos 12 ans ? The Good Doctor La nouvelle série médicale événement www.tvregions.com ACTUS TÉLÉ Le meilleur de Twitter Duel au soleil Les téléspecta teurs ont re dé couvert cette série qui date de 2014. AOscar@loptismiste Sympa cette série policière sur @France2tv #DuelAuSoleil Yann Gael, dans le rôle de l’enquêteur, est très... convaincant. ArcadeAvocat@ArcadeAvocats Très envie de faire un tour de la Corse. Je suis allée voir d’autres photos hier soir. Celle d’hier m’a tellement marquée. Série policière #Duelausoleil sur F2 sur l’île Beauté met actuellement en valeur ces beaux paysages mer et montagne. E salute MARDI, MERCREDI ET JEUDI À 20H50 Marie-Anne@MissMorse8 Hier soir j’ai regardé pour la pre- mière fois #DuelAuSoleil, j’ai beaucoup aimé ! Vivement la suite! #GerardDar- Renaissance de la violence mon @MrYannGael bernycraze@bernycraze Il a suffi de vingt ans pour que l’Europe meurtrie sur les champs de hashtag pour #DuelAuSoleil @ bataille bascule à nouveau dans la fureur et le sang. Une période twitter ? Attention, on tient un talent de qu’Arte ressuscite dans un passionnant docu-fi ction 1918-1939, les dingue avec @MrYannGael sur @Fran- rêves brisés de l’entre-deux-guerres. ce2tv dans #Duelausoleil our toute la jeunesse qui avait de 1929 aux États-Unis fi rent au contraire échappé à l’hécatombe de la Der le lit des totalitarismes, du nazisme au fas- TOP TWEET des ders, durant laquelle près de cisme en passant par la dictature du Petit dix millions de soldats perdirent père des peuples Joseph Staline et condui- Merula’s dead@invadiny P la vie, la fin des combats devait sonner sirent à la guerre 1939-1945. -

Kamini : Marly-Gomont Paroles Et Musique : Kamini © RCA / Sony BMG
Kamini : Marly-Gomont Paroles et musique : Kamini © RCA / Sony BMG Thèmes La vie à la campagne, les souvenirs d’enfance, le racisme. Objectifs Objectifs communicatifs : • comprendre un refrain, • faire des hypothèses à partir d’images, • repérer et comprendre les mots-clés d’une chanson, • rechercher des arguments, • rédiger une lettre, un discours, • comprendre une interview, • argumenter, justifier ses choix. Objectif (socio-) linguistique : • enrichir son vocabulaire avec des mots familiers. Objectifs (socio-) culturels : • découvrir l’association SOS Racisme, • donner son avis sur le phénomène des blogs et pages personnelles sur Internet. Vocabulaire Un patelin (familier) : un village. Paumé (familier) : perdu. Rapper : chanter du rap (style musical caractérisé par un rythme répétitif). Un flow ou flo (français québécois) : un enfant, un adolescent. La té-ci (familier/verlan) : la cité. Come on (anglais) : viens ! Le beat (anglais) : le rythme. Chouette (familier) : super. Putain (vulgaire) : exclamation qui marque l’agacement, l’énervement. Chialer (familier) : pleurer. La cité : ensemble d’immeubles, généralement des HLM (Habitation à Loyer Modéré), des zones urbaines. Une ordure (familier) : une personne méprisable. Paname (familier) : Paris. Fiche réalisée par Murielle Bidault, CAVILAM, Vichy Marly-Gomont 1/5 Le bitume : mélange d’hydrocarbures utilisé comme revêtement imperméable des routes et des trottoirs. Une pâture : un champ utilisé pour nourrir les animaux. Le verlan : argot qui consiste à inverser les syllabes des mots (l’envers). Que dalle (expression familière) : rien. Un Black (familier/anglais) : une personne de race noire. Une claque : une gifle. Le fiston (familier) : le fils. Cramer (familier) : brûler. En catimini : en cachette. Notes Jean-Pierre Pernaut est le présentateur de l’édition de 13h00 du journal télévisé de TF1 qui se caractérise par des reportages sur les régions de France. -

Roots & Routes, April, 2021
Roots & Routes Vol 10, No. 4, April, 2021 Photo credits : https://www. Photo credit: FandimeFilmu imdb.com/title/tt1630027/ www.grfdt.com Roots and Routes, Vol 8, No. 13-14, July- December, 2019 1 Editor’s Note Dear Readers, Greetings! The adverse impact of the pandemic is on the rise, and migrants all over the world are largely getting affected. Although good initiatives are being taken by some governments and civil society organisations, many states are still Contents not prioritising welfare policies for the migrants who have been hard-hit be- Movie Reviews cause of the mobility restrictions. There is a need for global solidarity as it is Book Review the only hope for the entire humanity to come out of the narrow nationalistic Blog vision that has constantly neglected the importance of migrants. Therefore, bringing the voice of the migrants to the world community through all pos- Editorial Information ©GRFDT. Roots and Routes is printed, itive means is essential. On this note, Global Research Forum on Diaspora designed & circulated by and Transnationalism (GRFDT) is constantly striving to bridge the gap be- GRFDT tween the policy and implementation through its various activities. Depicting its monthly works, GRFDT brings to you its organisational newsletter “Roots Editor and Routes” for April 2021. Abhishek Yadav The newsletter contains movie reviews, book review and one interview. Lina Editorial Committee Mansour has reviewed the movie titled “Almanya: Willkommen in Deutsch- Abhishek Yadav land”, providing the telling account of Turkish immigrants living in Germany. Ani Yeremyan Fabrizio Parrilli has reviewed the movie titled “Bienvenue a Marly-Gomont” Arsala Nizami Feroz Khan (The African Doctor), describing the integration challenges of an African Gurram Srinivas family in France. -

Un Espace Rural En Déprise. L'exemple De Marly-Gomont
UN ESPACE RU RAL EN D ÉPRISE. L'E XE MPLE DE MARLY-GOM ONT I. Etude de la chanson de Kamini. Au cours de l’année 2006, Kamini propose une chanson qui devient vite un tube. Elle porte le nom d’une commune de l’Aisne : Marly-Gomont. https://www.youtube.com/watch?v=nl-Db3_qsSM (voir les paroles de la chanson en annexe) Question 1 : En vous aidant de la chanson et de google earth, expliquez où se situe la commune évoquée ? ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… Question 2 : Remplir le tableau qui suit en vous aidant des paroles et du clip Caractéristiques Eléments justificatifs (paroles ou images) Localisation Paysage Situation démographique et économique Répartition de la population active Niveau d’équipement en infrastructures de base Orientation politique Bilan ; Listez les particularités de l’espace de Marly-Gomont d’après cette chanson. ……………………………………………………………………………………………………………… … ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… II. Les particular ités relev ées sont-e lles conforme s à la réa lité ? Question 1 : A partir de recherches sur internet, dites s’il -

®LA NUIT DE LA DECONFINE SAMEDI 28 Aout 2021
®LA NUIT DE LA DECONFINE ERE (1 VAGUE ARTISTIQUE) Soirée autour de l’humour & musique SAMEDI 28 Aout 2021 Soirée de clôture de la saison estivale d’AuxerrExpo INFORMATIONS RELATIVE A L’EVENEMENT LIEU : AUXERREXPO DATE : le 28 AOUT 2021 à 20h (ouverture des portes à 19h) ARTISTES Parrain : KAMINI Tête d’affiche : GIL ALMA & BENOIT JOUBERT Invités : ALEXANDRE PESLE – HERVE DIPARI Musicien : ADRIEN MARCO TRIO -LES DIVAS SWINGS Soirée Présentée par : MIGUEL MARQUEZ & CLEM PARTENAIRE OFFICIEL : CentreFrance ParcExpo TRIODARTS PARTENAIRES autres au 08/02/2021(listes non exhaustive) La tv de l’Yonne Centre Leclerc espace culturel Auxerre Production 20h40 L’ORIGINE DU PROJET : 2020 : Pour le monde de la scène cela a été une année blanche. Tous les spectacles ayant été annulés, les techniciens et les intermittents ont été dans une impasse et se sont définis comme les oubliés de la Culture. Toute la profession du spectacle vivant est à l’arrêt et dans les coulisses de la culture, on s’impatiente ! Triodarts et Auxerrexpo sensibles à l’appel de ces intermittents et à l’écoute des demandes du public, souhaitaient, au même titre que «Festival 2021, on y croit » être présents en voulant rendre possible la rencontre des artistes avec le public. Un projet fédérateur avec comme fonction première, divertir le public icaunais. En décembre est né : LA NUIT DE LA DECONFINE® – 1ère Vague Artistique. Soirée 100% Humour et Musique « talent de bourgogne ». Le titre : « La nuit de la déconfine, 1ère vague artistique » a été choisie pour être une réponse à l’espoir de retrouver les artistes et leur public et réciproquement. -

La Création Audiovisuelle Sur Internet : Palliatif, Tremplin Ou Système Alternatif Au Circuit Classique ? » - Nicéphore LANORD Master 2 Production
Université Toulouse Jean Jaurès ENSAV « La création audiovisuelle sur internet : palliatif, tremplin ou système alternatif au circuit classique ? » - Nicéphore LANORD Master 2 production 2019/2020 Sous la direction de Madame H. Laurichesse 1 Remerciements : Je remercie l’ensemble des personnes qui ont accepté de donner de leur temps pour faire ce mémoire. Merci à ceux qui se sont entretenus avec moi, ceux qui m’ont conseillé : Tabatha, Henri, Maxime, Augustin, Copain, Mathieu, Noa, merci à vous. Merci à ma directrice de mémoire, Madame Laurichesse, pour ses conseils sur la concrétisation de ce travail. Je remercie l’ENSAV pour les deux années d’enseignement de Master. Merci aussi à ceux qui m’ont soutenu et m’ont aidé dans la méthodologie, la rédaction et la correction de ce qui est vraisemblablement le dernier projet de mon parcours étudiant. 2 Sommaire Présentation de la problématique 4 Présentation du plan du mémoire 9 Introduction 11 1. Circuit classique et nouveaux médias. 13 1.1. Qu’est ce qu’est le circuit classique ? 16 1.2. Pourquoi Internet est-il un nouveau média ? 20 2. Les spécificités de la création sur Internet 23 2.1. Une mutation économique et juridique 24 2.2. De la création de flux ou de stock ? 29 3. L’audiovisuel sur internet vu par ses acteurs. 34 3.1. Carrière et vision du « nouveau média » 38 Liberté sur internet 44 Culture Web ou culture d’ailleurs 47 Rapport au public 49 Place du réalisateur 55 Avenir de la personne 60 3.2. Le bilan contrasté de la création 64 Conclusion 69 Bibliographie 72 Sitographie 74 Annexes 75 3 Présentation de la problématique Il semble judicieux de comprendre d’un point de vue sociologique ce qu’a apporté Internet à la création audiovisuelle. -

Le Versant Comique Du Rap Français : Entre Transgression Et Humour?
https://lib.uliege.be https://matheo.uliege.be Le versant comique du rap français : entre transgression et humour? Auteur : Horth, Mathieu Promoteur(s) : Pirenne, Christophe Faculté : Faculté de Philosophie et Lettres Diplôme : Master en communication, à finalité spécialisée en médiation culturelle et relation aux publics Année académique : 2020-2021 URI/URL : http://hdl.handle.net/2268.2/12413 Avertissement à l'attention des usagers : Tous les documents placés en accès ouvert sur le site le site MatheO sont protégés par le droit d'auteur. Conformément aux principes énoncés par la "Budapest Open Access Initiative"(BOAI, 2002), l'utilisateur du site peut lire, télécharger, copier, transmettre, imprimer, chercher ou faire un lien vers le texte intégral de ces documents, les disséquer pour les indexer, s'en servir de données pour un logiciel, ou s'en servir à toute autre fin légale (ou prévue par la réglementation relative au droit d'auteur). Toute utilisation du document à des fins commerciales est strictement interdite. Par ailleurs, l'utilisateur s'engage à respecter les droits moraux de l'auteur, principalement le droit à l'intégrité de l'oeuvre et le droit de paternité et ce dans toute utilisation que l'utilisateur entreprend. Ainsi, à titre d'exemple, lorsqu'il reproduira un document par extrait ou dans son intégralité, l'utilisateur citera de manière complète les sources telles que mentionnées ci-dessus. Toute utilisation non explicitement autorisée ci-avant (telle que par exemple, la modification du document ou son résumé) nécessite