Rundfunk Und Geschichte 31(2005)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
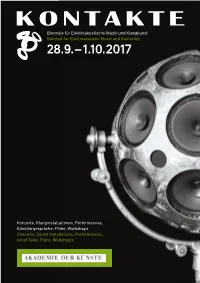
Konzerte, Klanginstallationen, Performances, Künstlergespräche, Filme, Workshops Concerts, Sound Installations, Performances, Artist Talks, Films, Workshops
Biennale für Elektroakustische Musik und Klangkunst Biennial for Electroacoustic Music and Sound Art 28.9. – 1.10.2017 Konzerte, Klanginstallationen, Performances, Künstlergespräche, Filme, Workshops Concerts, Sound Installations, Performances, Artist Talks, Films, Workshops 1 KONTAKTE’17 28.9.–1.10.2017 Biennale für Elektroakustische Musik und Klangkunst Biennial for Electroacoustic Music and Sound Art Konzerte, Klanginstallationen, Performances, Künstlergespräche, Filme, Workshops Concerts, Sound Installations, Performances, Artist Talks, Films, Workshops KONTAKTE '17 INHALT 28. September bis 1. Oktober 2017 Akademie der Künste, Berlin Programmübersicht 9 Ein Festival des Studios für Elektroakustische Musik der Akademie der Künste A festival presented by the Studio for Electro acoustic Music of the Akademie der Künste Konzerte 10 Im Zusammenarbeit mit In collaboration with Installationen 48 Deutsche Gesellschaft für Elektroakustische Musik Berliner Künstlerprogramm des DAAD Forum 58 Universität der Künste Berlin Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin Technische Universität Berlin Ausstellung 62 Klangzeitort Helmholtz Zentrum Berlin Workshop 64 Ensemble ascolta Musik der Jahrhunderte, Stuttgart Institut für Elektronische Musik und Akustik der Kunstuniversität Graz Laboratorio Nacional de Música Electroacústica Biografien 66 de Cuba singuhr – projekte Partner 88 Heroines of Sound Lebenshilfe Berlin Deutschlandfunk Kultur Lageplan 92 France Culture Karten, Information 94 Studio für Elektroakustische Musik der Akademie der Künste Hanseatenweg 10, 10557 Berlin Fon: +49 (0) 30 200572236 www.adk.de/sem EMail: [email protected] KONTAKTE ’17 www.adk.de/kontakte17 #kontakte17 KONTAKTE’17 Die zwei Jahre, die seit der ersten Ausgabe von KONTAKTE im Jahr 2015 vergangen sind, waren für das Studio für Elektroakustische Musik eine ereignisreiche Zeit. Mitte 2015 erhielt das Studio eine großzügige Sachspende ausgesonderter Studiotechnik der Deut schen Telekom, die nach entsprechenden Planungs und Wartungsarbeiten seit 2016 neue Produktionsmöglichkeiten eröffnet. -
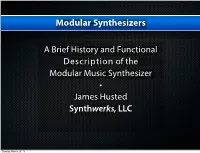
Modular Synthesizers
Modular Synthesizers A Brief History and Functional Description of the Modular Music Synthesizer • James Husted Synthwerks, LLC Sunday, March 24, 13 Mod•u•lar - adjective French modulaire or directly from Modern Latin modularis, from Latin modulus "a small measure" 1 : of, relating to, or based on a module or a modulus 2 : constructed with standardized units or dimensions for flexibility and variety in use, as in modular furniture 3 : composed of interchangeable units (!rst recorded 1936) Sunday, March 24, 13 Syn•the•sis - noun Etymology: Greek, from syntithenai to put together 1 : the composition or combination of parts or elements so as to form a whole 2 : the combining of often diverse conceptions into a coherent whole; also : the complex so formed Sunday, March 24, 13 Who’s on first? • 1837 - C.G. Page (Salem. Mass) - !rst to produce electronically generated sound (not necessarily associated with a musical instrument). • 1885 - Person and Ernst Lorenz -'Elektrisches Musikinstrument' - the !rst musical instrument designed to produce electrically generated sound. • 1897 - Taddaeus Cahills - Telharmonium - electromechanical instrument. • 1936 - Oskar Sala - Mixturtrautonium - !rst synth using Subharmonic synthesis • 1939 - Homer Dudley invents the Parallel Bandpass Vocoder (VODER) - A key operated speech synthesizer • 1940 - Homer Dudley invents the The Voder speech synthesizer as a way to transmit speech over telephone lines • 1948 - Hugh LeCaine - Electronic Sackbut - First voltage-controlled synthesizer • 1948 - Dr. Raymond Scott - Wall of Sound - First polyphonic Sequencing Workstation (electromechanical) and the Electronum - !rst sequencer. • 1950 - CSIR - Mk 1 - The !rst known use of a digital computer for the purpose playing music • 1956 - Louie and Bebe Barron - Produced the !rst all-electronic musical score for a major motion picture - MGM's 'Forbidden Planet' • 1957 - Max V. -

Susan Philipsz: You Are Not Alone, Edited by James Lingwood and Brigitte Franzen, Cologne: Koenig Books, 2014: 82-84
Maeve Connolly, 'Reverberations in Time and Space: You Are Not Alone' Susan Philipsz: You Are Not Alone, edited by James Lingwood and Brigitte Franzen, Cologne: Koenig Books, 2014: 82-84. ISBN 9783863354053 Standing in the light-filled atrium of Haus des Rundfunks in Berlin, the site of Susan Philipsz’s work You Are Not Alone, I found myself speculating upon the material and acoustic properties of this distinctive space, with its walls clad in small shiny ceramic tiles, and also remembering earlier encounters with Philipsz’s work. I recalled moving through the everyday confusion of a bus station in Belfast, drawn by an unaccompanied female voice rising above the crowd and, some years later, hearing music as I climbed the stairs to the upper floor of a white-walled New York gallery, catching fragments of a 16th century lament emanating from tall trees in the parkland of Kilkenny castle and, most recently, discerning a composition for strings as I approached the end of a platform in what was once the main train station of Kassel. As these disparate memories of Philipsz’s work cohered, I was struck by the complex interplay between loss, longing and evocation – and between memory and history – in her practice. In an article that reflects upon the relationship between history and memory in contemporary art, Peter Osborne proposes that concepts of ‘trauma’, ‘melancholy’ and ‘mourning’ have become prevalent in art discourse, reinstating a ‘metaphorically expanded conception of memory as the medium of historical experience’.1 Osborne also suggests that, by comparison with history, memory is ‘temporally restricted’2 because it only enlivens the past in relation to the present. -

Reinhard Appel Journalist Im Gespräch Mit Werner Reuß
BR-ONLINE | Das Online-Angebot des Bayerischen Rundfunks http://www.br-online.de/ alpha/forum/vor0410/20041019.shtml Sendung vom 19.10.2004, 20.15 Uhr Reinhard Appel Journalist im Gespräch mit Werner Reuß Reuß: Verehrte Zuschauer, ganz herzlich willkommen zum Alpha-Forum. Unser heutiger Gast gilt als einer der publizistischen Gründerväter dieser Republik, obwohl er sich gern als deren Kind bezeichnet. Er stand und steht für eine politische Kultur des Umgangs miteinander, die auch heute noch so mancher politischen Diskussionsrunde im Fernsehen gut anstünde. Es gibt wohl kaum einen politisch interessierten Zuschauer, der ihn nicht kennt: Unser heutiger Gast ist Reinhard Appel, ehemals Intendant des Deutschlandfunks und später dann von 1976 bis 1988 Chefredakteur des Zweiten Deutschen Fernsehens in Mainz. Ich freue mich, dass er hier ist, ganz herzlich willkommen, Herr Appel. Appel: Vielen Dank für die Einladung. Reuß: "Ich bin kein Revolutionär, sondern ein Evolutionär", haben Sie einmal gesagt. Was genau haben Sie damit gemeint? Appel: Dass ich zur kontinuierlichen Entwicklung Deutschlands in der Nachkriegszeit beitragen wollte, auch aufgrund meiner Erfahrung des Krieges. Denn dieser Krieg war für mich ein prägendes Erlebnis: Ich bin ja in der Weimarer Zeit geboren, dann in der Hitlerzeit aufgewachsen und später noch Soldat geworden. Obwohl ich aus einem katholischen Elternhaus komme, also in Distanz zum Hitlerregime erzogen wurde, wollte ich doch auch für das Vaterland ein guter Hitlerjunge sein. Und dann diese Enttäuschung, in und nach der Gefangenschaft zu erleben, was dieser Staat eigentlich alles angerichtet hatte! Da wollte ich unbedingt dazu beitragen, dass sich das in den nachfolgenden Generationen – ursprünglich wollte ich ja Lehrer werden: das Vermitteln und Übersetzen lag mir also von vornherein – nicht mehr wiederholen kann. -

Transformation Und Entwicklungsprozess Des Mediensystems in Polen Von 1989 Bis 2001
Transformation und Entwicklungsprozess des Mediensystems in Polen von 1989 bis 2001 Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades des Doktors der Philosophie (Dr. phil.) im Fach Journalistik der Fakultät 15 Kulturwissenschaften an der Universität Dortmund vorgelegt von Dipl.-Journ. Katharina Hadamik Juli 2003 Gutachter: Prof. Dr. Gerd G. Kopper (Universität Dortmund) Prof. Dr. Hans Bohrmann (Universität Dortmund) Inhaltsverzeichnis VORBEMERKUNG 5 ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 6 KURZZUSAMMENFASSUNG 8 EINFÜHRUNG 9 KAPITEL I: TRANSFORMATIONSFORSCHUNG 14 1. Theoretische Fragestellungen und Erklärungsansätze zur allgemeinen Transformation in postkommunistischen Ländern 14 1. 1. Begriffsklärung ................................................................................................................................... 14 1. 2. Orientierungsbestimmung: Eine Transformation – Wohin? ............................................................... 16 1. 3. Erklärungsansätze zur Transformation in postkommunistischen Ländern ......................................... 22 1. 4. Die retrospektive Betrachtung: Transformationspfade in postkommunistischen Ländern ................. 31 2. Theoretische Fragestellungen und Untersuchungsansätze zur Medientransformation in postkommunistischen Ländern 40 2. 1. Was Transformation in den Medien bedeutet ..................................................................................... 40 2. 2. Entwicklungsoptionen für Medien..................................................................................................... -

W Inn Brand Stands Convention Site ■ University’S Top Administrator Addresses Student Consumerism, J.M
Republicans sure Indy will be 2000 W inn Brand stands convention site ■ University’s top administrator addresses student consumerism, J.M. wellness, first-year experience. B r o w s : Bi I M Brows. Kim Morgan T he AMD SlZASSI M 111 ft11 C ity Editor in C u m . Ni*t Editor and Viiwroinm Editor Beat IUPUI is leading the way in revitalizing In his annual state of the university ad Editor's note: J.M. Bnmn.editor in chief, wilt periods- dress. presented Sept 8 at IUPUI, IU Presi colly write a column called ’ The City Beat” an article dent Myles Brand commended the India about happenings in Indianapolis. napolis campus for forging the path to Indianapolis is known for its races — hosting them hut ties model through iu implementation of rarely competing in them. University College. The city is in a race with a short list of other metropoli The president challenged tan centers including New Orleans. New York. Philadel- IU campuses, including IU-1 ' first-year experience —- by the end of "M M * this mat waoM have tht sfe*te **11 is notoriously difficult to change the curriculum” Brand said. ‘There are always tarftttiMcttattN interests that prefer the status quo to the risks M suryatthtCttya of something new. However. it is time now Mrptvn CoUimuh “Often universities have a ‘silo effect/ “ Mour of likiuiupoln rand told The Sagamore during a Sept. 9 quirements but no commonality of experi ence” phia and San Antonio to host the Republican National The president believes certain Convention in 2000. should he expected of students — a j A decision by the GOP site selection committee is ex understanding of American histc pected in November Local and state Republican leaden believe Indianapolis has a more than good shot at hosting the rally. -

Tolono Library CD List
Tolono Library CD List CD# Title of CD Artist Category 1 MUCH AFRAID JARS OF CLAY CG CHRISTIAN/GOSPEL 2 FRESH HORSES GARTH BROOOKS CO COUNTRY 3 MI REFLEJO CHRISTINA AGUILERA PO POP 4 CONGRATULATIONS I'M SORRY GIN BLOSSOMS RO ROCK 5 PRIMARY COLORS SOUNDTRACK SO SOUNDTRACK 6 CHILDREN'S FAVORITES 3 DISNEY RECORDS CH CHILDREN 7 AUTOMATIC FOR THE PEOPLE R.E.M. AL ALTERNATIVE 8 LIVE AT THE ACROPOLIS YANNI IN INSTRUMENTAL 9 ROOTS AND WINGS JAMES BONAMY CO 10 NOTORIOUS CONFEDERATE RAILROAD CO 11 IV DIAMOND RIO CO 12 ALONE IN HIS PRESENCE CECE WINANS CG 13 BROWN SUGAR D'ANGELO RA RAP 14 WILD ANGELS MARTINA MCBRIDE CO 15 CMT PRESENTS MOST WANTED VOLUME 1 VARIOUS CO 16 LOUIS ARMSTRONG LOUIS ARMSTRONG JB JAZZ/BIG BAND 17 LOUIS ARMSTRONG & HIS HOT 5 & HOT 7 LOUIS ARMSTRONG JB 18 MARTINA MARTINA MCBRIDE CO 19 FREE AT LAST DC TALK CG 20 PLACIDO DOMINGO PLACIDO DOMINGO CL CLASSICAL 21 1979 SMASHING PUMPKINS RO ROCK 22 STEADY ON POINT OF GRACE CG 23 NEON BALLROOM SILVERCHAIR RO 24 LOVE LESSONS TRACY BYRD CO 26 YOU GOTTA LOVE THAT NEAL MCCOY CO 27 SHELTER GARY CHAPMAN CG 28 HAVE YOU FORGOTTEN WORLEY, DARRYL CO 29 A THOUSAND MEMORIES RHETT AKINS CO 30 HUNTER JENNIFER WARNES PO 31 UPFRONT DAVID SANBORN IN 32 TWO ROOMS ELTON JOHN & BERNIE TAUPIN RO 33 SEAL SEAL PO 34 FULL MOON FEVER TOM PETTY RO 35 JARS OF CLAY JARS OF CLAY CG 36 FAIRWEATHER JOHNSON HOOTIE AND THE BLOWFISH RO 37 A DAY IN THE LIFE ERIC BENET PO 38 IN THE MOOD FOR X-MAS MULTIPLE MUSICIANS HO HOLIDAY 39 GRUMPIER OLD MEN SOUNDTRACK SO 40 TO THE FAITHFUL DEPARTED CRANBERRIES PO 41 OLIVER AND COMPANY SOUNDTRACK SO 42 DOWN ON THE UPSIDE SOUND GARDEN RO 43 SONGS FOR THE ARISTOCATS DISNEY RECORDS CH 44 WHATCHA LOOKIN 4 KIRK FRANKLIN & THE FAMILY CG 45 PURE ATTRACTION KATHY TROCCOLI CG 46 Tolono Library CD List 47 BOBBY BOBBY BROWN RO 48 UNFORGETTABLE NATALIE COLE PO 49 HOMEBASE D.J. -

UCLA Electronic Theses and Dissertations
UCLA UCLA Electronic Theses and Dissertations Title Performing Percussion in an Electronic World: An Exploration of Electroacoustic Music with a Focus on Stockhausen's Mikrophonie I and Saariaho's Six Japanese Gardens Permalink https://escholarship.org/uc/item/9b10838z Author Keelaghan, Nikolaus Adrian Publication Date 2016 Peer reviewed|Thesis/dissertation eScholarship.org Powered by the California Digital Library University of California UNIVERSITY OF CALIFORNIA Los Angeles Performing Percussion in an Electronic World: An Exploration of Electroacoustic Music with a Focus on Stockhausen‘s Mikrophonie I and Saariaho‘s Six Japanese Gardens A dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree of Doctor of Musical Arts by Nikolaus Adrian Keelaghan 2016 © Copyright by Nikolaus Adrian Keelaghan 2016 ABSTRACT OF THE DISSERTATION Performing Percussion in an Electronic World: An Exploration of Electroacoustic Music with a Focus on Stockhausen‘s Mikrophonie I and Saariaho‘s Six Japanese Gardens by Nikolaus Adrian Keelaghan Doctor of Musical Arts University of California, Los Angeles, 2016 Professor Robert Winter, Chair The origins of electroacoustic music are rooted in a long-standing tradition of non-human music making, dating back centuries to the inventions of automaton creators. The technological boom during and following the Second World War provided composers with a new wave of electronic devices that put a wealth of new, truly twentieth-century sounds at their disposal. Percussionists, by virtue of their longstanding relationship to new sounds and their ability to decipher complex parts for a bewildering variety of instruments, have been a favored recipient of what has become known as electroacoustic music. -

War: How Britain, Germany and the USA Used Jazz As Propaganda in World War II
Kent Academic Repository Full text document (pdf) Citation for published version Studdert, Will (2014) Music Goes to War: How Britain, Germany and the USA used Jazz as Propaganda in World War II. Doctor of Philosophy (PhD) thesis, University of Kent. DOI Link to record in KAR http://kar.kent.ac.uk/44008/ Document Version Publisher pdf Copyright & reuse Content in the Kent Academic Repository is made available for research purposes. Unless otherwise stated all content is protected by copyright and in the absence of an open licence (eg Creative Commons), permissions for further reuse of content should be sought from the publisher, author or other copyright holder. Versions of research The version in the Kent Academic Repository may differ from the final published version. Users are advised to check http://kar.kent.ac.uk for the status of the paper. Users should always cite the published version of record. Enquiries For any further enquiries regarding the licence status of this document, please contact: [email protected] If you believe this document infringes copyright then please contact the KAR admin team with the take-down information provided at http://kar.kent.ac.uk/contact.html Music Goes to War How Britain, Germany and the USA used Jazz as Propaganda in World War II Will Studdert Thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy in History University of Kent 2014 Word count (including footnotes): 96,707 255 pages Abstract The thesis will demonstrate that the various uses of jazz music as propaganda in World War II were determined by an evolving relationship between Axis and Allied policies and projects. -

Grolier, Europe 1 Launch
FEBRUARY 12, 2000 Music Volume 17, Issue 7 £3.95 Gabrielleis on theRise, with her Go! Beat single bursting into the Eurochart Hot 100 this week as the Media® highest new entry. we tallerd M'ail.41:721_1_4C10 M&M chart toppers this week Grolier, Europe 1 launch 'Net venture Eurochart Hot 100 Singles by Emmanuel Legrand music -related offers and is presented Brunet, who has had a long career EIFFEL65 as "a free full -service portal for French in radio, and a stint in the music Move Your Body PARIS - Europe 1 Communication, one and European music" and a window forindustry as MD of BMG France in the (Bliss Co.) of Europe's leading radio groups, andnew talent and new musical trends. mid -'80s, says one of his goals with the European Top 100 Albums multimedia company Grolier Interac- MCity.fr managing Internet is to go back to the basics of tive-both part of Lagardere Group-director Claude Brunet radio, when the medium was a plat- SANTANA have established a major presence onsays the portal will be form for new talent. Supernatural theInternet with the February 2 open to all musical gen- Users will be able to (Arista) launch of MCity.fr, the first Frenchres with the aim of F.-access information on European Radio Top 50 music -only Internet portal, alongside "favouring creative, music and artists, use various services such as a directory of CHRISTINA AGUILERA 12 new on-line radio stations. quality music in partner- Designed by a team of 30 program-ship with all participants in the music 10,000 music sites, download music What A Girl Wants mers, DJs, producers and journalists,world-musicians, writers, producers,and also streamline the different 'Net (RCA) MCity.fr will provide a wide range oflabels, distributors and the media." continued on page 21 European Dance Traxx EIFFEL65 Move Your Body RAJARs reveal BBC boom (Bliss Co.) by Jon Heasman share of listening, compared to com- mercial radio's 46.7%, giving the BBC Inside M&M this week LONDON - The UK's commercial radio a 4.6% lead. -

Downloaded from Brill.Com09/30/2021 03:47:12PM Via Free Access of That Period Was Dominated by Magazine-Type Formats
Gesnerus 76/2 (2019) 172–191, DOI: 10.24894/Gesn-en.2019.76009 “Because every recipient is also a potential patient” – TV Health Programmes in the FRG and the GDR, from the 1960s to the 1980s Susanne Vollberg Abstract In the television programme of West Germany from the 1960s to the 1980s, health magazines like Gesundheitsmagazin Praxis [Practice Health Maga- zine] (produced by ZDF)1 or ARD-Ratgeber: Gesundheit [ARD Health Ad- visor] played an important role in addressing health and disease as topics of public awareness. With their health magazine Visite [Doctor’s rounds], East German television, too relied on continuous coverage and reporting in the fi eld. On the example of above magazines, this paper will examine the his- tory, design and function of health communication in magazine-type for- mats. Before the background of the changes in media policy experienced over three decades and the different media systems in the then two Germanys, it will discuss the question of whether television was able to move health rele- vant topics and issues into public consciousness. health magazine, GDR television, FRG television, Gesundheitsmagazin Praxis Health-related programmes were, right from the early days of television, part of the common TV repertoire in both German countries but it was in the health, disease and medicine, which was well-received by the audience. The- coverage of medicine and health issues in East and West German television 1 Abbreviation for Zweites Deutsches Fernsehen – Second German Television; public-service broadcaster. Apl. Prof. Dr. Susanne Vollberg, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Institut für Musik, Medien- und Sprechwissenschaften, Abt. -

Don't Smoke, Take Drink in Moderation, Do Walk a Lot
volume 9 issue 18/2020 DON’T SMOKE, TAKE DRINK IN MODERATION, DO WALK A LOT AND DO NOT GORGE YOURSELF BEYOND YOUR SATIATION1 HEALTH EDUCATION BY TELEVISION IN WEST GERMANY FROM THE 1960S TO THE 1980S Susanne Vollberg Martin-Luther-University Halle-Wittenberg [email protected] Abstract: This article discusses health education through television in West Germany, with a focus on nutrition and physical activity. Public health initiatives on television contributed to the fitness boom of the late 1960s and 1970s that aimed to counterbalance post-war lifestyle changes within the West German population. The article uses individual TV programme formats and campaigns as examples to show that the 1970s marked the beginning of behaviour-oriented health education in West Germany. The ZDF health telemagazine Gesundheitsmagazin Praxis gave advice, for example on proper food and conveyed how the audience was increasingly requested to actively participate, in order to encourage health-conscious behaviour. Keywords: health education, health communication, health telemagazine, West German television, fitness boom 1 Introduction In the 1960s, more and more medical practitioners and physicians in West Germany warned against a new range of chronic diseases, such as cardiovascular diseases. Increased cholesterol and high blood pressure, brought on by an unhealthy diet and harmful behaviours like smoking, a lack of physical activity, and excess weight, were seen as important contributors. By looking at the topics of nutrition and physical activity2 my paper gives some insight into how television addressed changes in the state-run health system in West Germany, as well as new problems and preventative policies.3 I will open with a brief description of the reasons that led to a sharp increase in obesity and cardiovascular diseases in West Germany.