Funde Und Ausgrabungen Im Bezirk Trier 23, 1991
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Language(S) of the Callaeci Eugenio R
e-Keltoi: Journal of Interdisciplinary Celtic Studies Volume 6 The Celts in the Iberian Peninsula Article 16 5-3-2006 The Language(s) of the Callaeci Eugenio R. Luján Martinez Dept. Filología Griega y Lingüística Indoeuropea, Universidad Complutense de Madrid Follow this and additional works at: https://dc.uwm.edu/ekeltoi Recommended Citation Luján Martinez, Eugenio R. (2006) "The Language(s) of the Callaeci," e-Keltoi: Journal of Interdisciplinary Celtic Studies: Vol. 6 , Article 16. Available at: https://dc.uwm.edu/ekeltoi/vol6/iss1/16 This Article is brought to you for free and open access by UWM Digital Commons. It has been accepted for inclusion in e-Keltoi: Journal of Interdisciplinary Celtic Studies by an authorized administrator of UWM Digital Commons. For more information, please contact open- [email protected]. The Language(s) of the Callaeci Eugenio R. Luján Martínez, Dept. Filología Griega y Lingüística Indoeuropea, Universidad Complutense de Madrid Abstract Although there is no direct extant record of the language spoken by any of the peoples of ancient Callaecia, some linguistic information can be recovered through the analysis of the names (personal names, names of deities, ethnonyms, and place-names) that occur in Latin inscriptions and in ancient Greek and Latin sources. These names prove the presence of speakers of a Celtic language in this area, but there are also names of other origins. Keywords Onomastics, place-names, Palaeohispanic languages, epigraphy, historical linguistics 1. Introduction1 In this paper I will try to provide a general overview of the linguistic situation in ancient Callaecia by analyzing the linguistic evidence provided both by the literary and the epigraphic sources available in this westernmost area of continental Europe. -

I. General Index
I. GENERAL INDEX Achilles, 121, 124, 126, 127, 128, 129, Apollo Cunomaglus, 144 n.12, 169, 130 216, cat. #600 actarius, cat. #24, 231 Apollo Grannus, cat. #439 Adonis, 128 Aponius Rogatianus, 89, cat. #425 Aelius (nomen), cat. #27, 116, 145, Apulum, 66 313, 453, 584 aquila, 38, 44 n.166 Aelius Caesar, L., 34 n.124, 35, 215 aquilifer, 9 Aelius Secundus, 158 n.3 architectus, 173 Aelius Seius, L., 15 Arciaco, 30, 213, cat. #538 Aeneas, 18, 122, 130 Arecurius, 211, cat. #539 Aeon, 95 Ares, 152 Aesculapius (Asclepius), 142 n.2, 143, Armilustrium, 37, 38, cat. #2, 3 144, 150, 166, 169, 170, 208, 214, Arnomecta, cat. #540 cat. #90, 285-289 Arrius (nomen), cat. #222, 300, 368 Agamemnon, 55, 124, 127 Artemis, 62, 128, 144 n.5, 170 n.66 Agricola, 212 Aspuanis, 210, cat. #653 Agrippina II, 25 n.61, 43 n.164 Astarte, cat. #384 Ahriman, 76, 77, 87, 211, cat. #418 Athena, 152 Ahura, 72, 76, 95 Attis, 87, 116 n.63, 174-176 Ajax, 125 n.93 Attonius Quintianus, 143, cat. #607 Alaisiagae, 30, 153, 214, Audagus, 210, cat. #544 cat. #695-697 Augustine of Canterbury, 9, 197, 198 Alaric, 185 n.72, 200 Alban, 197, 198, 200 Augustine of Hippo, 189 Albiorix, 124 Augustus, 14 n.5, 15, 16, 18, 19, 23, 24, Alemanni, 187 28 n.87, 32 n.113, 35, 39, 40 n.148, Alexander, 55, 75, 176 41 n.150, 48, 62, 128, 168 n.56, 177 Alexandria, 25 Augustus/a (epithet), 20, 35, 49, 50, Allectus, 3, 52 n.206, 183 51-53, 54, 165 n.38, 207, 208, 214, Ambrosius Aurelianus, 188 cat. -

CELTIC HEALER and WARRIOR MAIDEN Celtic Gods Served The
CHAPTER FOUR CELTIC HEALER AND WARRIOR MAIDEN Celtic gods served the tribe in matters of war and peace, justice and fertility, salvation and healing. As fully-fledged tribal deities, they did not entirely engage the interests of the soldier on the Roman fron tier, but some divine aspects were relevant and desirable. \Ve have already seen the Celtic god as horned warrior. It remains to con sider native gods and goddesses as healers. The ill relied as much on the supernatural as on empirical medicine, inextricably linked with religion. 1 Consequently, physicians and priests were on staff together at most healing shrines, Graeco-Roman as well as Celtic (i.e., 614). 2 Most healer gods are associated with water and curative springs; as will be seen, some have connections with curses and ret ribution (Sulis at Bath, Mercury at Uley). Warrior God and Healer Under numerous epithets, Mars was thoroughly assimilated into Celtic cults known both on the continent and in Britain alone: Camulus (467), Lenus (468, 469), Loucetius (470), Toutates (474). Celtic gods equated with Mars in Britain emphasize the god's regal and mili tary character: 1 Alator, the huntsman (603-604), Belatucadrus (Fair Shining One: 554, 55 7, 558, 562, 567),4 Rigisamus (most kingly: 472), Segomo (Victor),5 Toutates (Ruler of the people: 473, 474), Barrex (Supreme). 6 Occasionally his role as healer surfaces, especially 1 Allason-Jones, Women, 156. 2 For example, Asclepius' incubation shrines at Cos and Epidaurus. For Celtic examples, priests and physicians attended the sick at the Fontes Sequana, where the water spirit who personified the river Seine dwelled (Deyts, Sanctuaire) and at Bath where Sulis Minerva presided over a healing sanctuary (Cunlifle, Sacred Spring, 359 62). -

Moritix Londiniensium: a Recent Epigaphic Find In
From The British Epigraphy Society, Newsletter n.s. 8 (Autumn 2002), pp. 10-13: MORITIX LONDINIENSIUM: A RECENT EPIGRAPHIC FIND IN LONDON On 11 October 2002 various news agencies (A3/A24/A29), linking London to Chichester reported that archaeologists excavating a site and the ports of the south coast. From here the in Southwark had unearthed a marble plaque road then crossed over the river to the walled inscribed with what may be the earliest known city of Londinium proper on the north bank. epigraphic attestation of London’s Latin name This situation at such a nodal point naturally from the environs of the capital itself. ‘This is suggests the commercial significance of the hugely important,’ Francis Grew, curator of location. One of the archaeologists, Gary archaeology at the Museum of London, told Brown, said in an interview with Peter reporters. ‘It is the first real monumental Macdiarmid, ‘We have had a remarkable post- inscription with the word Londinium on it.’ medieval phase and could be uncovering a The stone bears a religious dedication by an significant prehistoric landscape also. … I can't individual who describes himself by the stress how important this site is. We have mysterious title of moritix Londiniensium. already gone back to the pre-historic occupation of the site and we have found vast quantities of artefacts.’ He added, ‘We have so far only dug 15 percent of the site and we have already found this plaque, so the potential for more staggering finds is there. Who knows what more we will find?’ The new inscription (Photograph: BBC) This exciting find turned up just six The Tabard Street excavation (Photograph: BBC) weeks into a 40-week dig by rescue archaeology specialists, Pre-Construct The plaque, measuring approximately Archaeology, on a one-hectare site at the 12 inches by 16 inches and of a sandy-coloured junction of Tabard Street and Long Lane, SE1, imported Italian marble, was recovered on 3 which is destined to be covered by the Tabard October from the fill of a pit near the remains Square development by Berkeley Homes. -
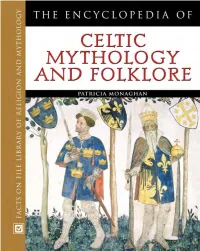
Encyclopedia of CELTIC MYTHOLOGY and FOLKLORE
the encyclopedia of CELTIC MYTHOLOGY AND FOLKLORE Patricia Monaghan The Encyclopedia of Celtic Mythology and Folklore Copyright © 2004 by Patricia Monaghan All rights reserved. No part of this book may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage or retrieval systems, without permission in writing from the publisher. For information contact: Facts On File, Inc. 132 West 31st Street New York NY 10001 Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Monaghan, Patricia. The encyclopedia of Celtic mythology and folklore / Patricia Monaghan. p. cm. Includes bibliographical references and index. ISBN 0-8160-4524-0 (alk. paper) 1. Mythology, Celtic—Encyclopedias. 2. Celts—Folklore—Encyclopedias. 3. Legends—Europe—Encyclopedias. I. Title. BL900.M66 2003 299'.16—dc21 2003044944 Facts On File books are available at special discounts when purchased in bulk quantities for businesses, associations, institutions, or sales promotions. Please call our Special Sales Department in New York at (212) 967-8800 or (800) 322-8755. You can find Facts On File on the World Wide Web at http://www.factsonfile.com Text design by Erika K. Arroyo Cover design by Cathy Rincon Printed in the United States of America VB Hermitage 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 This book is printed on acid-free paper. CONTENTS 6 INTRODUCTION iv A TO Z ENTRIES 1 BIBLIOGRAPHY 479 INDEX 486 INTRODUCTION 6 Who Were the Celts? tribal names, used by other Europeans as a The terms Celt and Celtic seem familiar today— generic term for the whole people. -

Test Abonnement
L E X I C O N O F T H E W O R L D O F T H E C E L T I C G O D S Composed by: Dewaele Sunniva Translation: Dewaele Sunniva and Van den Broecke Nadine A Abandinus: British water god, but locally till Godmanchester in Cambridgeshire. Abarta: Irish god, member of the de Tuatha De Danann (‘people of Danu’). Abelio, Abelionni, Abellio, Abello: Gallic god of the Garonne valley in South-western France, perhaps a god of the apple trees. Also known as the sun god on the Greek island Crete and the Pyrenees between France and Spain, associated with fertility of the apple trees. Abgatiacus: ‘he who owns the water’, There is only a statue of him in Neumagen in Germany. He must accompany the souls to the Underworld, perhaps a heeling god as well. Abhean: Irish god, harpist of the Tuatha De Danann (‘people of Danu’). Abianius: Gallic river god, probably of navigation and/or trade on the river. Abilus: Gallic god in France, worshiped at Ar-nay-de-luc in Côte d’Or (France) Abinius: Gallic river god or ‘the defence of god’. Abna, Abnoba, Avnova: goddess of the wood and river of the Black Wood and the surrounding territories in Germany, also a goddess of hunt. Abondia, Abunciada, Habonde, Habondia: British goddess of plenty and prosperity. Originally she is a Germanic earth goddess. Accasbel: a member of the first Irish invasion, the Partholans. Probably an early god of wine. Achall: Irish goddess of diligence and family love. -

Sources and Transmission of the Celtic Culture Trough the Shakespearean Repertory Celine Savatier-Lahondès
Transtextuality, (Re)sources and Transmission of the Celtic Culture Trough the Shakespearean Repertory Celine Savatier-Lahondès To cite this version: Celine Savatier-Lahondès. Transtextuality, (Re)sources and Transmission of the Celtic Culture Trough the Shakespearean Repertory. Linguistics. University of Stirling, 2019. English. NNT : 2019CLFAL012. tel-02439401 HAL Id: tel-02439401 https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02439401 Submitted on 14 Jan 2020 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. University of Stirling – Université Clermont Auvergne Transtextuality, (Re)sources and Transmission of the Celtic Culture Through the Shakespearean Repertory THESIS SUBMITTED IN FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY (PH.D) AND DOCTEUR DES UNIVERSITÉS (DOCTORAT) BY CÉLINE SAVATIER LAHONDÈS Co-supervised by: Professor Emeritus John Drakakis Professor Emeritus Danièle Berton-Charrière Department of Arts and Humanities IHRIM Clermont UMR 5317 University of Stirling Faculté de Lettres et Sciences Humaines Members of the Jury: -

Names on Gallo-Roman Terra Sigillata (1St – 3Rd C
NAMES ON GALLO-ROMAN TERRA SIGILLATA (1ST – 3RD C. A.D.) Andreas Gavrielatos Submitted in accordance with the requirements for the degree of Doctor of Philosophy. The University of Leeds School of Classics October 2012 !!" " !!!" " The candidate confirms that the work submitted is his own and that appropriate credit has been given where reference has been made to the work of others. This copy has been supplied on the understanding that it is copyright material and that no quotation from the thesis may be published without proper acknowledgement. @ 2012 The University of Leeds and Andreas Gavrielatos !#" " #" " Acknowledgements All good things are prodigies of small dreams. And small dreams only come to reality when big minds believe in them. I have been very lucky in my life, for big minds have been my teachers, they have believed in me and they have supported my dreams. I would never be able to reach this stage if I were not the student of Prof. Maria Voutsinou-Kikilia and Prof. Andreas Voskos, among many others of course. And I would not have started this course, without the guidance and the encouragement of Prof. Eleni Karamalengou and Prof. Stratis Kyriakidis. It was finally, just before I left the University of Athens when I received all the help I needed from my MA supervisors Andreas Michalopoulos and especially Dionysios Benetos, who has been a very good friend since then. I will always feel gratitude when I recall the first time I met my PhD supervisor Prof. Robert Maltby, on the very first day I visited the University of Leeds. -

The Impact of the Roman Empire on the Cult of Asclepius by Ghislaine
A Thesis Submitted for the Degree of PhD at the University of Warwick Permanent WRAP URL: http://wrap.warwick.ac.uk/79956 Copyright and reuse: This thesis is made available online and is protected by original copyright. Please scroll down to view the document itself. Please refer to the repository record for this item for information to help you to cite it. Our policy information is available from the repository home page. For more information, please contact the WRAP Team at: [email protected] warwick.ac.uk/lib-publications The Impact of the Roman Empire on the Cult of Asclepius By Ghislaine Elisabeth van der Ploeg A thesis submitted for the fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Classics and Ancient History University of Warwick, Department of Classics and Ancient History April 2016 Table of Contents Table of Contents 1 Abstract 4 List of Abbreviations 5 List of Figures and Tables 11 Chapter One: Introduction: Mobility and Connectivity in the Cult of Asclepius 17 1.0 Introduction 17 1.1 Asclepius as Paradigm 19 1.1.1 Globalism and Regionalism in Antiquity 21 1.1.2 Identity and Regionalism 27 1.1.3 Competition and Connectivity 29 1.1.4 Conquest and Regionalism 31 1.1.5 Connectivity and the Mediterranean 33 1.1.6 Impact of Empire 36 1.1.7 Dissemination 38 1.1.8 Religious Change in the Provinces 39 1.1.9 Asclepieian Scholarship 44 1.2 The Impact of Rome on Asclepius 47 Chapter Two: Asclepius Before the Imperial Period 50 2.0 Introduction: The Pre-Imperial Cult 50 2.1 Homeric Origins 52 2.2 Dissemination -

The Cult of Sabazios.The Cult of a Gallo-Roman God on a Relief From
Anistoriton, vol. 12 (2010), Essays no 2 1 The Cult of Sabazios The Cult of a Gallo-Roman God on a Relief from Arlon/Aarlen (Belgium)? The Luxembourg Museum in Arlon (in Belgium) gathers the unique Gallo-Roman sculptured monuments which were discovered in some tombstones and civilian buildings of the ancient vicus in Orolaunum (today Arlon, Aarlen). One of these sculptured stones represents a very interesting scene of a man with his hands raised up while a huge horned snake is twisting around his hands and his body. The scene was shortly described by L. Lefébvre in the official Catalogue of the Luxembourg Museum in Arlon. He mentioned some different opinions on this representation which was once explained as a snake charmer, another time as an allusion to the cult of a Celtic god and finally as a symbol of the cult of Sabazios. Lefébvre supposes that M.E. Marien came with the most valuable interpretation of this scene. He associated a horned snake on this scene with the cult of the Phrygian-Thracian god of vegetation - Sabazios. Lefébvre´s positive standpoint to the idea of Marien was based on a supposition that Sabazios could be worshipped in Orolaunum because the cults of the Oriental mysteries were formally established in Orolaunum in the period of the Roman emperor Claudius (41-54 AD). A scene of a man encircled by a horned snake, relief, Luxembourg Museum Arlon Firstly, I also excepted that Sabazios´cult could be symbolized on this relief scene from Arlon. But I changed my opinion after some period of making the iconographical comparisons on this theme. -

Whole Thesis.Pdf
Open Research Online The Open University’s repository of research publications and other research outputs The Social Significance of Curse Tablets in the North-Western Provinces of the Roman Empire Thesis How to cite: Mckie, Stuart (2017). The Social Significance of Curse Tablets in the North-Western Provinces of the Roman Empire. PhD thesis The Open University. For guidance on citations see FAQs. c 2016 The Author Version: Version of Record Link(s) to article on publisher’s website: http://dx.doi.org/doi:10.21954/ou.ro.0000c11b Copyright and Moral Rights for the articles on this site are retained by the individual authors and/or other copyright owners. For more information on Open Research Online’s data policy on reuse of materials please consult the policies page. oro.open.ac.uk Stuart McKie M.A. B.A. (Hons.) The Social Significance of Curse Tablets in the North-Western Provinces of the Roman Empire Thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy Department of Classical Studies, The Open University Submitted in September 2016 Table of Contents Acknowledgements ............................................................................................................ 1 Abbreviations ..................................................................................................................... 3 Table of Figures ................................................................................................................. 5 Table of Tables ................................................................................................................. -
(STORIA ANTICA) Ciclo XIX Settore Scientifico
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna DOTTORATO DI RICERCA in STORIA (STORIA ANTICA) Ciclo XIX Settore scientifico disciplinare di afferenza: L–ANT/03 TITOLO della TESI ASPETTI DI VITA QUOTIDIANA, RELIGIOSA, MILITARE E CIVILE IN BRITANNIA E LUNGO IL VALLO DI ADRIANO. Presentata da: Annachiara Iliceto Coordinatore Dottorato Relatore Chiar.ma Prof.ssa Angela Donati Chiar.ma Prof.ssa Angela Donati Esame finale anno 2009 INDICE INTRODUZIONE pag. 1 ELENCO DELLE PRINCIPALI SIGLE E ABBREVIAZIONI PRESENTI NEL TESTO. pag. 5 CAPITOLO I: LA BRITANNIA DALLE ORIGINI ALLA COSTRUZIONE DELLA FRONTIERA. pag. 7 CAPITOLO II: FORME DI RELIGIOSITA’ E PRATICHE CULTUALI NELLA BRITANNIA ROMANA E NELLA ZONA DEL VALLUM HADRIANI . pag. 41 CAPITOLO III: MILITARI E CIVILI LUNGO IL VALLUM HADRIANI. RACCONTI DI VITA QUOTIDIANA DAL SITO DI VINDOLANDA. pag . 116 CONCLUSIONI pag. 151 APPENDICI pag. 153 BIBLIOGRAFIA pag. 263 INTRODUZIONE L’arrivo delle insegne di Roma in Britannia, e dunque sul territorio della provincia soprattutto idealmente più remota dell’Impero, determinò, anche in questo settore del mondo antico, l’inizio di un profondo e significativo processo culturale, economico e sociale, orientato verso il cambiamento e la progressiva riduzione delle distanze (fisiche, appunto, e ideali), tra il centro politico e storico di quel mondo, e le sue periferie. Conquistare nuovi orizzonti, significava attuare logiche umane, e rendere operative dinamiche sociali che avevano esiti e tempi di maturazione diversi, a seconda della realtà con la quale Roma si confrontava volta per volta. La Britannia fu un banco di prova difficile e particolare, per il suo essere terra di frontiera sotto ogni aspetto, e dal momento che proprio in Britannia sembrò fatalmente avverarsi quel consilium coercendi intra terminos imperii che già suonava nel testamento spirituale di Augusto al suo successore Tiberio, quando Roma non aveva ancora conosciuto il suo momento di massima espansione, e ancora forse appariva reale il sogno antico che voleva il confine dell’Urbe uguale a quello dell’orbe.