Die Zisterzienserabtei Bebenhausen
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Landeszentrale Für Politische Bildung Baden-Württemberg, Director: Lothar Frick 6Th Fully Revised Edition, Stuttgart 2008
BADEN-WÜRTTEMBERG A Portrait of the German Southwest 6th fully revised edition 2008 Publishing details Reinhold Weber and Iris Häuser (editors): Baden-Württemberg – A Portrait of the German Southwest, published by the Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg, Director: Lothar Frick 6th fully revised edition, Stuttgart 2008. Stafflenbergstraße 38 Co-authors: 70184 Stuttgart Hans-Georg Wehling www.lpb-bw.de Dorothea Urban Please send orders to: Konrad Pflug Fax: +49 (0)711 / 164099-77 Oliver Turecek [email protected] Editorial deadline: 1 July, 2008 Design: Studio für Mediendesign, Rottenburg am Neckar, Many thanks to: www.8421medien.de Printed by: PFITZER Druck und Medien e. K., Renningen, www.pfitzer.de Landesvermessungsamt Title photo: Manfred Grohe, Kirchentellinsfurt Baden-Württemberg Translation: proverb oHG, Stuttgart, www.proverb.de EDITORIAL Baden-Württemberg is an international state – The publication is intended for a broad pub- in many respects: it has mutual political, lic: schoolchildren, trainees and students, em- economic and cultural ties to various regions ployed persons, people involved in society and around the world. Millions of guests visit our politics, visitors and guests to our state – in state every year – schoolchildren, students, short, for anyone interested in Baden-Würt- businessmen, scientists, journalists and numer- temberg looking for concise, reliable informa- ous tourists. A key job of the State Agency for tion on the southwest of Germany. Civic Education (Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg, LpB) is to inform Our thanks go out to everyone who has made people about the history of as well as the poli- a special contribution to ensuring that this tics and society in Baden-Württemberg. -

Christine Jakobi- Mirwald
CHRISTINE JAKOBI-MIRWALD Initials and other Elements of Minor Decoration C H R I S T I N E J AKOBI -M IRWALD A paper on the subject of minor manuscript decoration can well turn out somewhat less than exciting. However, it depends on the point of view, and if the manuscripts of the Liber Extra are a somewhat alien field of investigation to this author, 1 this may well present a chance for a fresh approach. For once, the subject of terminologies in different languages has recently proved to be rather fascinating. 2 In the third edition of my Terminology * I would like to thank Martin Bertram for trusting me with this paper and for acce pting it at the conference, even when I was unable to participate in person, and Susanne Wittekind, who was so kind as to read the text in my place. 1 My primary fields of research have concentrated on rather earlier manuscripts: Die illuminierten Han dschr iften der Hessischen Landesbibliothek Fulda. 1. Handschriften des 6. – 13. Jahrhunderts. Textband bea rbeitet von Ch. J AKOBI - M IRWALD auf Grund der Vorarbeiten von Herbert Köllner, Denkmäler der Buchkunst 10, Stuttgart 1993; C. J AKOBI - M IRWALD , Die Initiale zu r Causa 28 in den Münchener Gratianhandschriften 17161 und 23551, in: E. E ISENLOHR , P. W O R M (Hg.), Arbeiten aus dem Marbu rger hilfswissenschaftlichen Institut, Elementa diplomatica 8, Marburg 2000, p. 217 -228; E AD. Die Schäftlarner Gratian - Handschrift Clm 17161 in der Bayerischen Staatsbibliothek, Münchner Jahrbuch der bildende n Kunst, 3. F. 58 (2007), p. -

Das Neckartal - Ein Tal Der Brunnen
Schriftenreihe Heft 23 Siedlungswasserwirtschaft und Umwelt DANA MACK und HANS-JÜRGEN VOIGT Das Neckartal - ein Tal der Brunnen Cottbus 2018 Herausgeber: Lehrstuhl Wassertechnik und Siedlungswasserbau der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus- Senftenberg Dr.-Ing. Konrad Thürmer ISBN 3-934294-30-8 Herausgeber: Dr.-Ing. Konrad Thürmer Lehrstuhl Wassertechnik und Siedlungswasserbau der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus - Senftenberg Bearbeiter: Dana Mack und Hans-Jürgen Voigt Dana Mack ist Behördenangestellte in Stuttgart und hat an der BTU Cottbus-Senftenberg den Abschluss als Master of Art im Studiengang World Heritage Studies gemacht. Hans-Jürgen Voigt ist Professor im Ruhestand und vormals Leiter des Lehrstuhl Umweltgeologie der BTU, sein Hobby als promovierter Hydrogeologe ist die Historische Wasserversorgung. Vertrieb: Eigenverlag des Lehrstuhls Wassertechnik und Siedlungswasserbau der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus - Senftenberg Siemens-Halske-Ring 8 03046 Cottbus Tel.: 0049-355-69-4302 Fax: 0049-355-69-3025 e-mail: [email protected] Alle Rechte vorbehalten. Wiedergabe nur mit Genehmigung des Lehrstuhls Wassertechnik und Siedlungswasserbau der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus- Senftenberg, Siemens-Halske-Ring 8, 03046 Cottbus - Senftenberg Cottbus 2018 ISBN 3-934294-30-8 Das Neckartal - ein Tal der Brunnen Von Dana Mack und Hans-Jürgen Voigt 1 Inhaltsverzeichnis Seite 1. Der Neckar 2 2. Die Kulturlandschaft am Neckar 3 3. Die hydrogeologischen Verhältnisse im Neckartal 4 4. Zur Geschichte der Wasserversorgung im Neckartal 6 5. Städtebauliche Einordnung der Brunnen im Mittelalter 10 6. Zusammenfassung 37 1. Der Neckar Der Name Neckar leitet sich aus dem Keltischen ab und bedeutet „wildes Wasser". Er verweist auf den historischen Kurs des Flusses, da der heutige Neckar wegen der zahlreichen wasserbaulichen Maßnahmen ein eher ruhiger Fluss ist. -

Download Als
www.bayerisch-schwaben.de Genau das Richtige Dillinger Land Landkreis Donau-Ries für Dich! Zentrum des Schwäbischen Ferienland mit Jena / Leipzig / Donautals K ratergeschichte Saalfeld Herzlich willkommen in Bayerisch-Schwaben! Mit dieser Faltkarte nehmen wir Sie mit auf eine Entdeckungreise Plauen / durch unsere bodenständige Destination, die Bayern und Für Naturliebhaber ist das Dillinger Land eine wahre Einmalige Landschaften,Fladungen Städte vollerMeiningen Geschichte, / präch- Neuhaus Ludwigsstadt Gera / Dresden Erfurt Schwaben perfekt vereint. Schatztruhe. Auf einer Distanz von knapp 20 Kilometern tige Schlösser, Kirchen und Klöster, spannende Geologie,Meiningen Bayerisch-Schwaben – das sind die UNESCO-Welterbe- treffen hier verschiedenste Landschaften aufeinander, kulturelle VielfaltMellrichstadt und kulinarische Bf Genüsse: Das alles Sonneberg Nordhalben Feilitzsch Stadt Augsburg & sechs spannende Regionen. Hier liegen die von den Ausläufern der Schwäbischen Alb über das weite lässt sich im Ferienland Donau-Ries erlebnisreich zu Fuß, (Thür) Hbf Bad Steben Wurzeln der Wittelsbacher genauso wie weite Wälder und fruchtbare Donautal bis zum voralpinen Hügelland. Ob per Rad oder mit dem Auto entdecken. Neustadt (b. Coburg) Flussauen mit herrlichen Rad- & Wanderwegen. Großarti- gemütlicher Genussradler, Mountainbiker oder Wanderer, Fulda / Hof Hbf Schlüchtern Bad Neustadt ge Kulturschätze in Kirchen, Klöstern, Schlössern und Mu- hier kommen alle auf ihre Kosten. Unberührte Auwälder Als besonderes Highlight lohnt(Saale) die EntdeckungBad -
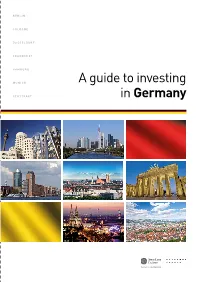
A Guide to Investing in Germany Introduction | 3
BERLIN COLOGNE DUSSELDORF FRANKFURT HAMBURG MUNICH A guide to investing STUTTGART in Germany ísafördur Saudharkrokur Akureyri Borgarnes Keflavik Reykjavik Selfoss ICELAND Egilsstadir A guide to investing in Germany Introduction | 3 BERLIN FINLAND ME TI HT NORWAY IG HELSINKI FL COLOGNE R 2H SWEDEN TALLINN OSLO INTRODUCTION ESTONIA STOCKHOLM IME T T GH LI DUSSELDORF F IN 0M 3 RIGA INVESTING IN GERMANY R 1H LATVIA E FRANKFURT EDINBURGH IM T T LITHUANIA GH DENMARK LI F R COPENHAGEN VILNIUS BELFAST 1H MINSK IRELAND HAMBURG DUBLIN BELARUS IME HT T LIG F IN HAMBURG M 0 UNITED KINGDOM 3 WARSAW Germany is one of the largest Investment Markets in Europe, with an average commercial AMSTERDAM BERLIN KIEV MUNICH NETHERLANDS POLAND transaction volume of more than €25 bn (2007-2012). It is a safe haven for global capital and LONDON BRUSSELS DÜSSELDORF COLOGNE UKRAINE offers investors a stable financial, political and legal environment that is highly attractive to both BELGIUM PRAGUE STUTTGART FRANKFURT CZECH REPUBLIC domestic and international groups. LUXEMBOURG PARIS SLOVAKIA STUTTGART BRATISLAVA VIENNA MUNICH BUDAPEST This brochure provides an introduction to investing in German real estate. Jones Lang LaSalle FRANCE AUSTRIA HUNGARY BERN ROMANIA has 40 years experience in Germany and today has ten offices covering all of the major German SWITZERLAND SLOVENIA markets. Our full-service real estate offering is unrivalled in Germany and we look forward to LJUBLJANA CROATIA BUCHAREST ZAGREB BELGRADE sharing our in-depth market knowledge with you. BOSNIA & HERZEGOVINA SERBIA SARAJEVO BULGARIA ITALY SOFIA PRESTINA KOSOVO Timo Tschammler MSc FRICS SKOPJE HAMBURG MACEDONIA International Director ROME TIRANA MADRID ALBANIA Management Board Germany PORTUGAL Lisboa (Lisbon) SPAIN GREECE Office and Industrial, Jones Lang LaSalle Setúbal ATHENS BERLIN Germany enjoys a thriving, robust and mature real estate market which is one of the DÜSSELDORF cornerstones of the German economy. -

Carl Barckhoff and the Barckhoff Church Organ Company
Volume 39, Number 4, 1995 Founded in 1956 CARL BARCKHOFF AND THE BARCKHOFF CHURCH ORGAN COMPANY Carl Barckhoff - about 1880 by Vernon Brown Reprinted from The Tracker, 22:4 (Summer, 1978) Carl Barckhoff, one of the foremost Midwest late 19th 1880, "the church filled with a fashionable and cultured and early 20th century organ builders, was born in audience," 2 Carl himself played. Cora Hawley, the Wiedenbruck, Westphalia, Germany, in 1849. His father, daughter of an influencial man in Salem, was the soprano organ builder Felix Barckhoff, brought the family to the soloist, and this marked the beginning of a romance United States in 1865, and in that same year the first between Barckhoff and Miss Hawley. Barckhoff organ was built in this country. The firm In 1881 Carl married Miss Hawley, and in 1882, having established at 1240 Hope Street, Philadelphia, was for a time obtained financial backing locally, he relocated the during the 1870's known as Felix Barckhoff & Sons, the sons Barckhoff Church Organ Company in Salem. The new being Carl and Lorenz. factory at 31 Vine Street "had an organ hall 35 feet high, Felix Barckhoff died in 1878, 1 and at about this same time which made it possible to construct the largest organs built Carl relocated the firm in Allegheny County, Pennsylvania, at that time. According to records, most of the men in an area which is today North Side Pittsburgh. An organ employed by Mr. Barckhoff had learned their trade in for the Presbyterian Church of Salem, Ohio was built in this Germany. -

Provenienzen Von Inkunabeln Der BSB
Provenienzen von Inkunabeln der BSB Nähere historisch-biographische Informationen zu den einzelnen Vorbesitzern sind enthalten in: Bayerische Staatsbibliothek: Inkunabelkatalog (BSB-Ink). Bd. 7: Register der Beiträger, Provenienzen, Buchbinder. [Redaktion: Bettina Wagner u.a.]. Wiesbaden: Reichert, 2009. ISBN 978-3-89500-350-9 In der Online-Version von BSB-Ink (http://inkunabeln.digitale-sammlungen.de/sucheEin.html) können die in der Bayerischen Staatsbibliothek vorhandenen Inkunabeln aus dem Besitz der jeweiligen Institution oder Person durch Eingabe des Namens im Suchfeld "Provenienz" aufgefunden werden. Mehrteilige Namen sind dabei in Anführungszeichen zu setzen; die einzelnen Bestandteile müssen durch Komma getrennt werden (z.B. "Abensberg, Karmelitenkloster" oder "Abenperger, Hans"). 1. Institutionen Ort Institution Patrozinium Abensberg Karmelitenkloster St. Maria (U. L. Frau) Aichach Stadtpfarrkirche Beatae Mariae Virginis Aldersbach Zisterzienserabtei St. Maria, vor 1147 St. Petrus Altdorf Pfarrkirche Altenhohenau Dominikanerinnenkloster Altomünster Birgittenkloster St. Peter und Paul Altötting Franziskanerkloster Altötting Kollegiatstift St. Maria, St. Philipp, St. Jakob Altzelle Zisterzienserabtei Amberg Franziskanerkloster St. Bernhard Amberg Jesuitenkolleg Amberg Paulanerkloster St. Joseph Amberg Provinzialbibliothek Amberg Stadtpfarrkirche St. Martin Andechs Benediktinerabtei St. Nikolaus, St. Elisabeth Angoulême Dominikanerkloster Ansbach Bibliothek des Gymnasium Carolinum Ansbach Hochfürstliches Archiv Aquila Benediktinerabtei -

Stuttgarter Stadtteile
w Stadtteile 642 Mühlhausen Stammheim 441 891 641 461 863 864 451 871 865 Zuffenhausen 471 862 881 481 866 861 241 867 802 868 Münster 501 201 342 221 Weilimdorf Feuer- 231 831 341 214 345 bach 202 203 801 343 215 213 344 212 Bad Cannstatt 204 346 821 125 205 841 211 210 811 348 124 126 206 207 129 128 Nord 209 347 123 144 130 131 127 143 122 208 671 192 105 662 Ost 121 Unter- 681 292 107 661 146 türkheim Botnang 106 145 104 142 664 295 182 663 Ober- 293 183 101 108 665 103 Mitte türkheim 294 186 141 Wangen 666 181 184 102 147 531 185 110 109 761 191 West 187 521 164 165 162 161 Süd 151 Hedel- 362 163 166 fingen 381 314 371 361 721 719 718 Degerloch 601 311 312 421 611 171 Sillenbuch 717 313 712 621 321 271 716 401 711 713 Ost Stadtbezirk mit Name 402 Vaihingen 261 714 571 715 405 406 403 Möhringen 145 Birkach Stadtteil mit Nummer 731 741 404 262 561 552 581 407 411 Plieningen Kilometer 00,5 1 2 3 4 5 551 Kartengrundlage (c) Stadtmessungsamt, Kartografie: Statistisches Amt Stand: 1. Januar 2009 Mitte (M) noch: Ost (O) Bad Cannstatt (Ca) Degerloch (De) noch: Möhringen (Mö) Sillenbuch (Si) noch: Vaihingen (Vai) 101 Oberer Schlossgarten 145 Ostheim 201 Muckensturm 311 Degerloch 406 Sternhäule 601 Sillenbuch 721 Büsnau 102 Rathaus 146 Gaisburg 202 Schmidener Vorstadt 312 Waldau 407 Fasanenhof-Ost 611 Heumaden 731 Rohr 103 Neue Vorstadt 147 Gablenberg 203 Espan 313 Tränke 411 Fasanenhof 621 Riedenberg 741 Dürrlewang 104 Universität 151 Frauenkopf 204 Kurpark 314 Haigst 421 Sonnenberg 105 Europaviertel 205 Cannstatt-Mitte 321 Hoffeld Stammheim -

SMALL. STRONG. PROMISING. Small
SMALL. STRONG. PROMISING. small. strong. a great place to live. BOUNTIFUL BIBERACH. WELCOME! Biberach an der Riß can look back on a rich historical Many much-desired products on the world market have This love for their town, which usually swiftly captures past. In the reserved, Swabian manner, they are sophi- their home in Biberach. Not just the administrative the heart of even newly-adopted Biberach citizens, is the sticated, close to their roots and, yes, industrious too. district of Biberach and the regional economy, but also greatest treasure of this town: so come and be carried With a firm eye on the future, the people there bank on the town of Biberach boomt a bissle (is booming a bit), away – bountiful Biberach is a place to look forward to. persistence and security. spoken with the typical Upper Swabian understatement. This is definitely because the Biberach people love their town, are keen on voluntary involvement, enjoy its cul- tural wealth and actively contribute to this themselves. Norbert Zeidler, Mayor of Biberach 04 HISTORY BIBERACH SUCCESS HAS WILFULNESS A HOME TODAY „Stuttgart, Ulm and Biberach, the Swabian railway“ Biberach is one of the most dynamic growth areas in Germany. A powerful small and medium-sized business sector with productive industrial, research and service operations is showcasing its competitive abilities throughout the world. 1083 Around 1500 1849 A great place for living Outstanding education A meeting place for research The first direct proof of the There are plenty of imposing buil- Rail traffic opened up the world. and leisure opportunities and development existence of Biberach: “Luipoldus dings such as the Martinskirche The population doubled in size to In the middle of Upper Swabia. -

Archbp. = Archbishop/Archbishopric; B
Cambridge University Press 978-0-521-88909-4 - German Histories in the Age of Reformations, 1400-1650 Thomas A. Brady Index More information Index Abbreviations: archbp. = archbishop/archbishopric; b. = born; bp. = bishop/bishopric; d. = died; r. = reigned/ruled Aachen, 89, 207, 252, 303, 312 Albert V ‘‘the Magnanimous’’ (b. 1528,r. absolutism, 7. See also European imperial 1550–79), duke of Bavaria, 294 nation-state Albert ‘‘the Stout-hearted’’ (1443–1500), duke academies: Bremen, 253; Herborn, 253, 279 of Saxony, 244 Acceptance of Mainz, 92n13 Albertine Saxony. See Saxony, Albertine acculturation, 289n101 Alcala´de Henares (Castile), 210 accumulation, benefices, 57n25 Alexander VI (r. 1492–1503), pope, 144 Adalbero (d. 1030), bp. of Laon, 29–30, 34, 49 Alexander VII (r. 1655–67), pope, 401n83, 410 Admont, abbey (Styria), 81 Alfonso I (b. 1396,r.1442–58), king of Naples, Adrian VI (r. 1522–23), pope, 145n63, 208 93 AEIOU, 91 Allga¨u, 193 Agnes (1551–1637), countess of Mansfeld- alliances, confessional: Catholics 1525, 215; Eisleben, 365 League of Gotha 1526, 215; Protestants 1529, Agricola, Gregor, pastor of Hatzendorf 216; Swiss cities with Strasbourg and Hesse (Styria), 344 1530, 217. See also Smalkaldic League Agricola, Johannes (1494–1566), 39 Alsace, 18, 23, 190; religious wars, 239; Swabian agriculture, 31 War, 119 Agrippa of Nettesheim, Cornelius (1486–1535), Alt, Salome (1568–1633), domestic partner of 54n10 Archbp. Wolf Dietrich von Raitenau, 306 Ahausen (Franconia), 368 Alte Veste, battle 1632, 382 Alba, duke of, Francisco Alvarez de Toledo Altenstetter, David (1547–1617), goldsmith of (1507–82), 238n41, 250n80 Augsburg, 332 Alber, Erasmus (1500–53), 264, 281 Alto¨ tting, shrine (Bavaria), 286 Albert (b. -
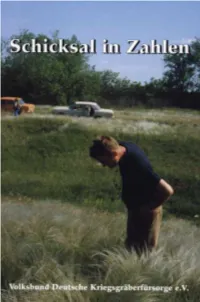
Layout-A K T. MD
Schicksal in Zahlen Informationen zur Arbeit des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. Herausgegeben vom: Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. Werner-Hilpert-Straße 2, 34112 Kassel Internet: www.volksbund.de E-Mail: [email protected] Redaktion und Gestaltung: AWK-Dialog Marketing 6. Auflage - (61) - April 2000 Druck: Graphischer Großbetrieb Pössneck Fotos: Nagel (1), Kammerer (3), Volksbund Archiv Titelbild: Mitarbeiter des Volksbundes suchen in der Steppe von Wolgograd - dem ehemaligen Schlachtfeld von Stalingrad - nach den Gräbern deutscher Soldaten. 2 Aus dem Inhalt Gedenken und Erinnern ..................................... 3 Seit 80 Jahren ein privater Verein ...................... 8-36 Gedenken an Kriegstote ..................................... 8 Sorge für Kriegsgräber ........................................ 11 Ein historisches Ereignis .................................... 37-38 Volkstrauertag ..................................................... 39-44 Totenehrung .......................................................... 40 Aus Gedenkreden ................................................ 41 Zentrales Mahnmal .............................................. 45 Rechtliche Grundlagen ...................................... 48-59 Umbettung von Gefallenen ............................... 60-63 Deutsche Dienststelle ......................................... 64 Gräbernachweis .................................................... 66-72 Grabschmuck ........................................................ 70 Gräbersuche im -

The Corporate Governance of Benedictine Abbeys - What Can Stock Corporations Learn from Monasteries?
1 The corporate governance of Benedictine abbeys - What can stock corporations learn from monasteries? - Katja Rost, Institute of Organization and Administrative Science, University of Zurich, Switzerland, [email protected], Universitätsstrasse 84, CH-8006 Zurich, Switzerland Katja Rost is a research assistant at the Institute of Organization and Administrative Science at the University of Zurich. She obtained her PhD in 2006 on the topic of social capital and innovation and currently does her habilitation in the area of corporate governance. Emil Inauen, Institute of Organization and Administrative Science, University of Zurich, Switzerland, [email protected], Universitätsstrasse 84, CH-8006 Zurich, Switzerland Emil Inauen is a PhD student at the Institute of Organization and Administrative Science and the Institute for Empirical Research in Economics at the University of Zurich. His primary research interest is the economics of religion. Before starting his study of economics he worked as a teacher of religion for several years and has experienced the monastic life. Margit Osterloh, Institute of Organization and Administrative Science, University of Zurich, Switzerland, [email protected], Universitätsstrasse 84, CH-8006 Zurich, Switzerland Margit Osterloh is Professor of Organization at the University of Zurich and Research Director of CREMA - Centre for Research in Economics, Management and the Arts, Switzerland. Her primary research interests include organizational theory, knowledge management, corporate governance and motivational theory. Bruno S. Frey, Institute for Empirical Research in Economics, University of Zurich, Switzerland, [email protected], Winterthurerstrasse 30, CH-8006 Zurich, Switzerland Bruno S. Frey is Professor of Economics at the University of Zurich and Research Director of CREMA - Centre for Research in Economics, Management and the Arts, Switzerland.