Internationaler Frauentag
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Split Infinities: German Feminisms and the Generational Project Birgit
This is an Accepted Manuscript of an article published by Taylor & Francis in Oxford German Studies on 15 April 2016, available online: http://dx.doi.org/10.1080/00787191.2015.1128648 Split Infinities: German Feminisms and the Generational Project Birgit Mikus, University of Oxford Emily Spiers, St Andrews University When, in the middle of the nineteenth century, the German women’s movement took off, female activists/writers expressed a desire for their political work to initiate a generational project. The achievement of equal democratic rights for men and women was perceived to be a process in which the ‘democratic spirit’ was instilled in future generations through education and the provision of exceptional role models. The First Wave of the women’s movement laid the ground, through their writing, campaigning, and petitioning, for the eventual success of obtaining women’s suffrage and sending female, elected representatives to the Reichstag in 1919. My part of this article, drawing on the essays by Hedwig Dohm (1831–1919) analyses how the idea of women’s political and social emancipation is phrased in the rhetoric of a generational project which will, in the short term, bring only minor changes to the status quo but which will enable future generations to build on the foundations of the (heterogeneous, but mostly bourgeoisie-based) first organised German women’s movement, and which was intended to function as a generational repository of women’s intellectual history. When, in the mid-2000s, a number of pop-feminist essayistic volumes appeared in Germany, their authors expressed the desire to reinvigorate feminism for a new generation of young women. -
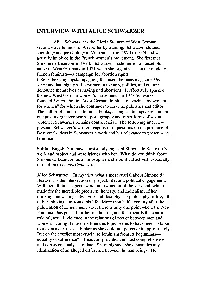
Interview with Alice Schwarzer
INTERVIEW WITH ALICE SCHWARZER Alice Schwarzer is the Gloria Steinern ofWest German second wave feminism. Areporter by training, Schwarzer studied sociology and psychology at Vincennes from 1970 to 1974 and was actively involved in the French women's movement. She first met Simone de Beauvoir in 1970. Schwarzer made herself a household name in West Germany in 1971 when she organized--on the model of French feminists-a campaign for abortion rights (HSelbstbezichigungskampagne") that used the mass magazine Der Stern and had high-profile women in the arts, politics, and culture denounce themselves as having had abortions. It effectively sparked the new West German women's movement. In 1977 Schwarzer founded Emma, the first West German feminist magazine "by women for women" for which she continues to serve as publisher and editor. The author ofnumerous feminist books, a sought-after speaker, and an outspoken organizer against pomography and other forms of sexual violence, Schwarzer remains controversial. The following interview presents Schwarzer's written responses to questions on the presence of Beauvoir's ideas in Schwarzer's work and her relevance to present-day feminism. Sabine Engel: You have consistently engaged Simone de Beauvoir's work and project and were friends with her. What do you think about Simone de Beauvoir as a philosopher and a political activist, especially in relation to Le deuxieme sexe? Alice Schwarzer: In my view what's most cmcial about Simone de Beauvoir is the interseetion of project, life, and political engagement. With her all three aspects were intertwined until the very end, which made for the incredible precision, honesty, and radicalism ofher thinking and writing. -

Alice Schwarzer, 2011: Lebenslauf Metz-Göckel, Sigrid
www.ssoar.info Rezensionen: Monika Jaeckel, 2011: (M)ein bewegtes Leben ; Alice Schwarzer, 2011: Lebenslauf Metz-Göckel, Sigrid Veröffentlichungsversion / Published Version Rezension / review Zur Verfügung gestellt in Kooperation mit / provided in cooperation with: Verlag Barbara Budrich Empfohlene Zitierung / Suggested Citation: Metz-Göckel, S. (2013). Rezensionen: Monika Jaeckel, 2011: (M)ein bewegtes Leben ; Alice Schwarzer, 2011: Lebenslauf. GENDER - Zeitschrift für Geschlecht, Kultur und Gesellschaft, 5(1), 153-157. https://nbn-resolving.org/ urn:nbn:de:0168-ssoar-397464 Nutzungsbedingungen: Terms of use: Dieser Text wird unter einer CC BY-SA Lizenz (Namensnennung- This document is made available under a CC BY-SA Licence Weitergabe unter gleichen Bedingungen) zur Verfügung gestellt. (Attribution-ShareAlike). For more Information see: Nähere Auskünfte zu den CC-Lizenzen finden Sie hier: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de Rezensionen 153 Sigrid Metz-Göckel Monika Jaeckel, 2011: (M)ein bewegtes Leben. Hrsg. v. Katrin Rohnstock. Sulzbach/Ts.: Ulrike Helmer Verlag. 196 Seiten. 19,95 Euro. Alice Schwarzer, 2011: Lebenslauf. Köln: Kiepenheuer & Witsch. 464 Seiten. 22,99 Euro Zwei Pionierinnen der neuen Frauenbewegung Monika Jaeckel und Alice Schwarzer sind Frauen, die in der neuen Frauenbewegung in Deutschland von Anfang an eine herausragende Rolle gespielt haben. Beide sind frau- enidentifi zierte „Bewegungsfrauen“, die ihr persönliches Leben in einen allgemeinen frauenpolitischen Kontext gestellt und diesen mit verändert haben. Sie repräsentieren unterschiedliche Bewegungsaspekte: Alice Schwarzer, die geniale, selbstbewusste „self- made woman“, Emma-Erfi nderin und Herausgeberin mit fortwährender Medienpräsenz und allgemeinen frauenpolitischen Statements, und Monika Jaeckel, die Gruppenfrau, die stets in unterschiedlichen Gemeinschaften mit anderen gelebt hat und als Kinderlose zu den Gründerinnen der Mütterzentren gehört. -

Global Feminisms Comparative Case Studies of Women's
GLOBAL FEMINISMS COMPARATIVE CASE STUDIES OF WOMEN’S ACTIVISM AND SCHOLARSHIP SITE: Germany Transcript of Gudrun KocH Interviewer: Sławomira WaLczewska Location: Berlin, Germany Date: Dec 2, 2017 University of MicHigan Institute for ResearcH on Women and Gender 1136 Lane HaLL Ann Arbor, MI 48109- 1290 Tel: (734) 764-9537 E-mail: [email protected] Website:http://www.umich.edu/~glblfem © Regents of tHe University of MicHigan, 2017 1 Gudrun KocH was born in Kolberg in East Pomerania in 1945. She studied education in Dortmund and Berlin 1964-1970, and became a secondary school teacher of German and history, after passing the state exams. She taught from 1967-73, and in 1974 began postgraduate studies in social sciences and adult education, taught adult education, and during that same period was co-founder of the Women’s Action Dortmund (FAD). She engaged in practical theater training in the late 1970s in Berlin, and in the 1980s pursued both theater studies and experimental theater work in Paris. Beginning in 1990 (and continuing through 2006) she worked on the establishment of a European women’s cultural association, which was the external link of European Women’s Action (EFA) eV Berlin. She planned and implemented eVents in Europe and North Africa, and also worked on documentaries. Sławomira WaLczewska, born 1960, feminist actiVist and philosopher (PhD). In 1999, Walczewska published Ladies, Knights and Feminists: Feminist Discourse in Poland, the first Polish book about the history of women’s emancipation in Poland from a cultural perspective. That book was nominated, as one of 20 books, for the most prestigious book award in Poland at that time, NIKE, in 2000. -

“Leave Your Men at Home:” Autonomy in the West German Women's
“Leave Your Men at Home:” Autonomy in the West German Women’s Movement, 1968-1978 by Bailee Maru Erickson B.A., Simon Fraser University, 2008 A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of MASTER OF ARTS in the Department of History Bailee Maru Erickson, 2010, University of Victoria All rights reserved. This thesis may not be reproduced in whole or in part, by photocopy or other means, without the permission of the author. ii Supervisory Committee “Leave Your Men at Home:” Autonomy in the West German Women’s Movement, 1968-1978 by Bailee Maru Erickson B.A., Simon Fraser University, 2008 Supervisory Committee Dr. Tom Saunders, Supervisor (Department of History) Dr. Oliver Schmidtke, Departmental Member (Department of History) iii Abstract Supervisory Committee Dr. Tom Saunders, Supervisor (Department of History) Dr. Oliver Schmidtke, Departmental Member (Department of History) This thesis examines “autonomy” as a political goal of the West German women’s movement from its beginning in 1968 to 1978. As the central concept of the movement, autonomy was interpreted and applied in women’s groups and projects through a variety of organizational principles. The thesis takes case studies of different feminist projects. Successive chapters examine the Berlin Women’s Centre; Verena Stefan’s novel Shedding, the women’s press Frauenoffensive, and the women’s bookstore Labrys; and the periodicals Frauenzeitung, Courage, and Emma. These studies show that autonomously organized projects were characterized by the expression of an anti- hierarchical ethos. The Berlin Women’s Centre organized itself around collective decision making and self sustainability. Women’s writing and publishing projects established an alternative literary space. -
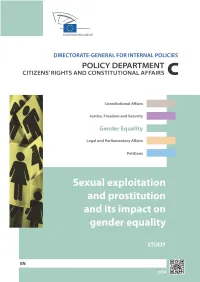
Sexual Exploitation and Prostitution and Its Impact on Gender Equality
DIRECTORATE GENERAL FOR INTERNAL POLICIES POLICY DEPARTMENT C: CITIZENS' RIGHTS AND CONSTITUTIONAL AFFAIRS GENDER EQUALITY Sexual exploitation and prostitution and its impact on gender equality STUDY Abstract The objective of this briefing paper is to provide background information drawn from the international literature on sexual exploitation and prostitution and its impact on gender equality in relation to the report of the Women’s Rights and Gender Equality Committee. The study concentrates on the debate on whether prostitution could be voluntary or has rather to be regarded in any case as a violation of women’s human rights. It also presents an overview of the policies on prostitution in the Member States as well as four case studies: Germany, the Netherlands, Spain, and Sweden. Conclusions are presented with the view to enhance the debate. PE 493.040 EN This document was requested by the European Parliament's Committee on Women’s Rights and Gender Equality AUTHORS Erika Schulze Sandra Isabel Novo Canto, Research Assistant Peter Mason, Research Assistant Maria Skalin, Research Assistant RESPONSIBLE ADMINISTRATOR Erika Schulze Policy Department C: Citizens' Rights and Constitutional Affairs European Parliament B-1047 Brussels E-mail: [email protected] LINGUISTIC VERSIONS Original: EN Translation: DE, FR ABOUT THE EDITOR To contact the Policy Department or to subscribe to its monthly newsletter please write to: [email protected] European Parliament, manuscript completed in January 2014. © European Union, Brussels, 2014. This document is available on the Internet at: http://www.europarl.europa.eu/studies DISCLAIMER The opinions expressed in this document are the sole responsibility of the author and do not necessarily represent the official position of the European Parliament. -

„Die Gläserne Wand“ Siege Und Niederlagen Der Frauen Im Kampf Gegen Die Männerherrschaft
Gesellschaft Alice Schwarzer, 1942 in Wuppertal gebo- viewten Frauen auf. Ihre Analyse: „Der va- Die Feministin Alice Schwarzer ren, studierte in Paris Psychologie und So- ginale Orgasmus ist ein Mythos“, die „Se- zieht Bilanz: „Die Saat geht auf“ ziologie, als sie sich in der Bundesrepublik xualität ein Instrument der Unterdrückung“. 1971 als Initiatorin einer breiten Kam- Das traf. Patriarchalische Familienordnung pagne gegen den Abtrei- und erigiertes Selbstbildnis der Männer- „Der kleine Unterschied bungsparagrafen 218 welt gerieten ins Wanken. Es schäumte die und seine Folgen“ hieß das hervortat. Ihren durch verbale Erregung in den Medien und an Buch, das Alice Schwarzer 1975 berühmt machte. spektakuläre TV-Auftritte den Stammtischen: „Schwanz-ab-Schwar- Ihre Streitschrift gegen die erworbenen Ruf als radi- zer“, „Hexe“, „frustrierte Tucke“. Die geifern- Unterdrückung des weib- kale Kritikerin der Männer- de Wut vieler Männer und die Mundpropa- lichen Geschlechts gilt gesellschaft festigte die ganda der Frauen machten das Buch zum seitdem als Manifest der Journalistin mit ihrem Bestseller. Die Autorin wurde 1977 Heraus- Frauenbewegung in Deutsch- Buch vom „kleinen Unter- geberin und Chefredakteurin einer neu ge- land. Nächste Woche schied“: In 14 Protokollen gründeten „Zeitschrift von Frauen für Frau- erscheint ihr neues Buch zeichnete sie den von Bit- en“ namens „Emma“. Schwarzer bewies („Der große Unterschied“) – ternis und sexueller Ge- fortan ihr Talent, sich selbst und ihre The- eine streitbare Bestands- DPA walt gekennzeichneten men medienwirksam zu inszenieren. Sie aufnahme. Autorin Schwarzer Alltag der von ihr inter- erfand den „Pascha des Monats“ (das Erst- FRAUENBEWEGUNG „Die gläserne Wand“ Siege und Niederlagen der Frauen im Kampf gegen die Männerherrschaft. -

Wuppertal – Traces of a Glorious Textile Past by Dorothea Nicolai
Wuppertal Traces of a glorious textile past Dorothea Nicolai Costume and Set Designer, Zurich, Switzerland Fig. 1: Old Wuppertal postcard, probably early 1970s. Photo: D. Nicolai. Abstract: Wuppertal today is a town of 350,000 inhabitants in the densely populated land of North Rhine-Westphalia / Bergisches Land in Germany and merged from six cities, Elberfeld and Barmen being the most important ones, in 1929. The name derives from the river, Wupper, along which textile handicraft developed since medivial times, and, starting in the mid-18th century, transformed into a wealthy innovative textile industry centre, known as the German Manchester. Famous quality products like Goldzack elastic or Bemberg lining came from there, it’s the birthplace of Aspirin by Bayer, the Rauhfasertapete (a popular ingrain wallpaper), but also Friedrich Engels, co-author of the Communist Manifest, and the poet Else Lasker-Schüler were born here. In 1900 the Schwebebahn (suspension railway) was inaugurated, then and still a symbol for technical innovation, connecting the city following the Wupper. Beautiful villas and industrial architecture manifest the textile past. Today the Pina Bausch dance company and the sculptor Tony Cragg found their home in Wuppertal. This paper tries to explore this intriguing place via its textile context. Content: Introduction / City history / Religious diversity and social / Famous companies and their products / Textile museums / People from Wuppertal / Wuppertal today / Selected Bibliography / Links and addresses 1 Fig. 2: Illustration found in an old tourist brochure, probably late 1950s. Photo: D. Nicolai. Introduction I came to Wuppertal for the first time in spring 2016, while I was working as a costume designer in nearby Cologne. -

Forum Demokratieforschung Beiträge Aus Studium Und Lehre
Working Paper No 12 Forum Demokratieforschung Beiträge aus Studium und Lehre Working Paper‐Reihe im Fachgebiet Demokratieforschung am Institut für Politikwissenschaft der Philipps‐Universität Marburg Working Paper No 12 Zum antimuslimischen Rassismus im Dominanzfeminismus Eine diskurstheoretisch fundierte frame‐Analyse von Alice Schwarzers Beiträgen in "Der Schock. Die Silvesternacht in Köln." Bachelorarbeit im Studiengang Politikwissenschaft am Institut für Politikwissenschaft der Philipps‐Universität Marburg Patricia Rams Titelbild: Füllhorn von Christel Irmscher (Original: Acryl auf Leinwand 1997) Impressum Forum Demokratieforschung, Working Paper Reihe im Fachgebiet Demokratieforschung Am Institut für Politikwissenschaft an der Philipps‐Universität Marburg, Beiträge aus Studium und Lehre Herausgeberinnen: Prof'in Dr. Ursula Birsl, Matti Traußneck (M.A. Politologin) Working Paper No 12 (Februar 2018) ISSN 2197‐9490 http://www.uni‐marburg.de/fb03/politikwissenschaft/institut/lehrende/birsl/forumdemokratie Kontakt: Prof'in Dr. Ursula Birsl Matti Traußneck Philipps‐Universität Marburg Institut für Politikwissenschaft Wilhelm‐Röpke‐Str. 6G DE‐35032 Marburg E‐Mail: [email protected]‐marburg.de [email protected]‐marburg.de Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung ............................................................................................................................. 7 2. Zur Anlage der Arbeit ........................................................................................................ 9 2.1. Intersektionalität -

Alice Schwarzer Lebenslauf
Alice Schwarzer Lebenslauf Kiepenheuer & Witsch Verlag Kiepenheuer & Witsch, FSC-N001512 1. Auflage 2012 © 2011, 2012, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Umschlaggestaltung: Barbara Thoben, Köln Umschlagmotiv: © Bettina Flitner Gesetzt aus der Linotype Univers und der Stempel Garamont Satz: Barbara Thoben, Köln Druck und Bindung: GGP Media GmbH, Pößneck ISBN 978-3-462-04456-0 1942/1943 Eine unerwünschte Geburt Und die Flucht vor den Bomben »Es ist ein Mädchen.« – Der Zettel liegt auf dem Küchentisch und der Satz ist in seiner klaren, schönen Handschrift geschrieben. Er war also trotzdem hingegangen. Obwohl sie erklärt hatte: »Ich will das Kind nicht sehen!« Und auch sie wird einige Tage später auftauchen, auf das Neugeborene blicken und dem Kind noch Jahre später in ihrer sarkastischen Art erzählen: »Hübsch warst du nicht gerade. Du warst ganz winzig, tomatenrot und schrum- pelig.« Er, das ist mein Großvater, Ernst Schwarzer, zum Zeitpunkt meiner Geburt 47; sie ist meine Großmutter, Margarete (genannt Grete) Schwarzer, geborene Büsche, 46 Jahre alt. Sobald ich spre- chen kann, werde ich sie »Papa« und »Mama« nennen, meine Mut- ter ist die »Mutti«. Wir schreiben den 3. Dezember 1942. Es ist das Jahr, in dem die Wannsee-Konferenz die »Endlösung der Judenfrage« beschließt. Und das Jahr, in dem die flächendeckenden Bombardierungen deutscher Städte beginnen. Beides beschäftigt bzw. betrifft meine Familie existenziell. Wuppertal-Elberfeld wird wenige Monate spä- ter in einem Flammenmeer versinken. -
Book Reviews
Book Reviews TOWARDS A FEMINIST CRITIQUE OF HEIMAT Gisela Ecker (ed.) Kein Land in Sicht. Heimat ± weiblich? (No Land in Sight: Feminist Critiques of Heimat) Munich: Fink, 1997. 224 pp., ISBN 3-7705-3104-3 Since 1989 there has been a renewal of debates on nation and nationalism in Germany, and these debates are of continuing consequence in the face of all the problems of a process which has been welcomed as `a growing together of what belongs together', namely a German nation, as well as problems which arise in the wake of globalization (a catchword for a complex of social problems arising from the neoliberal turn in politics) and the founding of a uni®ed Europe and the wars we have witnessed in the Balkans and in countries formerly belonging to the Soviet Union. Kein Land in Sicht. Heimat ± weiblich? is an interdisciplinary collection of essays which illuminate aspects of Heimat and add considerably to an under- standing of its importance for the discourse of the nation. Heimat is of central importance in the German discourse of the nation. It is a uniquely German word, although, as Gertrud Koch explains in her essay (`Vom Heimat®lm zu Heimat'), we can ®nd the complex of feelings described by Heimat in discourses of regional movements trying to construct differences and regional identities. To give an idea of the complex of feelings, Koch quotes a passage on Scottishness from David Miller's On Nationality (1995): He also wanted to keep the past alive; though his intelligence suspected that much of the tradition owed itself to nineteenth-century invention and a wish in the Scots to be other than the Irish, his heart swelled in a way he could not stop at the old songs and stories. -

The Ambivalent Role of Gender in Redefining the German Nation Petra Rostock, Sabine Berghahn
The ambivalent role of gender in redefining the German nation Petra Rostock, Sabine Berghahn To cite this version: Petra Rostock, Sabine Berghahn. The ambivalent role of gender in redefining the German nation. Ethnicities, SAGE Publications, 2008, 8 (3), pp.345-364. 10.1177/1468796808092447. hal-00571908 HAL Id: hal-00571908 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00571908 Submitted on 1 Mar 2011 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. 345-364 092447 Rostock (D) 22/7/08 15:52 Page 345 ARTICLE Copyright © SAGE Publications 2008 (Los Angeles, London, New Delhi and Signapore) 1468-7968 Vol 8(3): 345–364; 092447 DOI:10.1177/1468796808092447 http://etn.sagepub.com The ambivalent role of gender in redefining the German nation PETRA ROSTOCK Free University of Berlin,Germany SABINE BERGHAHN Free University of Berlin,Germany ABSTRACT Since the maxim of Germany as a non-immigration country was finally relinquished at the end of the 20th century, the country has struggled with redefining itself as an immigration society and inventing a modified national identity. Our article argues that gender has come to play a pivotal role in this process of redefining a ‘German’ identity because it helps secure the ‘self’ by creating the Muslim/migrant ‘other’ as culturally different.