Mitteilungen Des
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Epistolae Phalaridis (The Epistles of Phalaris), Latin Translation by FRANCESCO GRIFFOLINI in Latin, Decorated Manuscript on Parchment Italy (Northern?), C
Epistolae Phalaridis (The Epistles of Phalaris), Latin translation by FRANCESCO GRIFFOLINI In Latin, decorated manuscript on parchment Italy (Northern?), c. 1460-1480 iii (modern paper) + 80 + iii (modern paper) folios on parchment, eighteenth- or nineteenth-century foliation in brown ink made before any leaves were removed, 17-88, 97-104, lacking 40 leaves: quires A, B, M, O and P (collation [lacking A-B8] C-L8 [lacking M8] N8 [lacking O-P8]), alphanumerical leaf signatures, Ci, Cii...Niii, Niiii, horizontal catchwords, ruled in brown ink (justification 95 x 57 mm.), written in gray ink in a fine humanistic minuscule in a single column on 16 lines, addressees of letters in red capitals, letter numbers in red in the margins, each letter begins with a very fine 2-line initial in burnished gold on a ground painted in red and blue, highlighted with white penwork, light scribbles in black ink on ff. 40v-41, f. 1 darkened and stained, further stains and signs of use especially in the lower margins at the beginning and the end, edges darkened, but in overall good condition. In modern light brown calf binding, spine almost entirely detached, slightly scratched on the back board. Dimensions 164 x 113 mm. The Italian humanists were fascinated by this collection of fictional letters by the monstrous Sicilian tyrant, Phalaris, famous for torturing his enemies inside a bronze bull and eating human babies. In keeping with the established tradition in Ancient Greece of epistolary fiction, these letters are a literary creation by a yet unknown author, who reinvented Phalaris and explored his public and private life through the fictional letters. -

Muße Und Rekursivität in Der Antiken Briefliteratur
I Otium Studien zur Theorie und Kulturgeschichte der Muße Herausgegeben von Thomas Böhm, Elisabeth Cheauré, Gregor Dobler, Günter Figal, Hans W. Hubert und Monika Fludernik Beirat Barbara Beßlich, Christine Engel, Michael N. Forster, Udo Friedrich, Ina Habermann, Richard Hunter, Irmela von der Lühe, Ulrich Pfisterer, Gérard Raulet, Gerd Spittler, Sabine Volk-Birke 1 II III Muße und Rekursivität in der antiken Briefliteratur Mit einem Ausblick in andere Gattungen Herausgegeben von Franziska C. Eickhoff Mohr Siebeck IV Franziska C. Eickhoff, geboren 1988; 2008–2013 Studium der Lateinischen Philologie und der Romanischen Philologie; 2013 M.A. und 1. Staatsexamen; 2010–2011 Fremdsprachen- assistentin in Tours, Frankreich; seit 2014 Wissenschaftliche Mitarbeiterin im SFB 1015 „Muße. Konzepte, Räume, Figuren“ im Teilprojekt der Klassischen Philologie mit einer Promotionsarbeit zu „Muße und Poetik in der lateinischen Briefliteratur“. ISBN 978-3-16-154538-2 eISBN 978-3-16-154539-9 ISSN 2367-2072 (Otium) Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Natio- nalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb. de abrufbar. © 2016 Mohr Siebeck Tübingen. www.mohr.de Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Ver wertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustim mung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfälti gungen, Übersetzungen, Mi- kroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbei tung in elektronischen Systemen. Das Buch wurde von Computersatz Staiger in Rottenburg/N. aus der Minion gesetzt, von Hubert und Co. in Göttingen auf alterungsbeständiges Werkdruck papier gedruckt und von der Großbuchbinderei Spin ner in Ottersweier gebunden. Den Umschlag entwarf Uli Gleis in Tübingen; Umschlagabbildung Pompejanische Vögel im Schloss Dreilützow (Schullandheim der Caritas Mecklenburg e.V.), Foto: Achim Bötefür. -

Friendship and Literary Criticism at the School of Gaza*
What Did Diodorus Write? Friendship and Literary Criticism at the School of Gaza* Federica Ciccolella The so-called School of Gaza, which flourished between the fifth and the sixth centuries, represented the twilight of Greco-Roman culture in Palestine before the Muslim conquest of 635.1 Although Procopius of Gaza is generally considered the school’s most important representative, his work did not attract much attention until a decade ago, when scholars were suddenly reminded of his existence thanks to the fortunate discovery of an exchange of letters between Procopius and a contemporaneous rhetorician, Megethius, in a manuscript of the Marciana Library in Venice.2 This renewed interest has led to a wave of studies resulting in two critical editions of Procopius’s rhetorical works. Recent translations of these works into Italian and French will certainly spark more interest in Procopius and his works.3 Our most important source on Procopius’s life is an oration that his pupil Choricius wrote after his death, which is approximately dated 536.4 Born in Gaza between 463 and 473, Procopius received his primary education in his city and then moved to Alexandria, where he perfected rhetoric and studied philosophy probably at the school of Olympiodorus the Elder. Procopius became a sophist and a teacher of rhetoric; after teaching in Pamphylia and, perhaps, at Caesarea and in other cities, he eventually returned to Gaza, where he spent the rest of his life. Procopius’s teaching attracted many * This article is a revised and expanded version of the paper I gave at the 44th Conference of the Israel Society for the Promotion of Classical Studies (The Open University of Israel, Ra‘anana, June 3-4, 2015), after presenting a first draft, in Italian, at the University of Florence (June 8, 2014). -

Roman Domestic Religion : a Study of the Roman Lararia
ROMAN DOMESTIC RELIGION : A STUDY OF THE ROMAN LARARIA by David Gerald Orr Thesis submitted to the Faculty of the Graduate School of the University of Maryland in partial fulfillment of the requirements fo r the degree of Master of Arts 1969 .':J • APPROVAL SHEET Title of Thesis: Roman Domestic Religion: A Study of the Roman Lararia Name of Candidate: David Gerald Orr Master of Arts, 1969 Thesis and Abstract Approved: UJ~ ~ J~· Wilhelmina F. {Ashemski Professor History Department Date Approved: '-»( 7 ~ 'ii, Ii (, J ABSTRACT Title of Thesis: Roman Domestic Religion: A Study of the Roman Lararia David Gerald Orr, Master of Arts, 1969 Thesis directed by: Wilhelmina F. Jashemski, Professor This study summarizes the existing information on the Roman domestic cult and illustrates it by a study of the arch eological evidence. The household shrines (lararia) of Pompeii are discussed in detail. Lararia from other parts of the Roman world are also studied. The domestic worship of the Lares, Vesta, and the Penates, is discussed and their evolution is described. The Lares, protective spirits of the household, were originally rural deities. However, the word Lares was used in many dif ferent connotations apart from domestic religion. Vesta was closely associated with the family hearth and was an ancient agrarian deity. The Penates, whose origins are largely un known, were probably the guardian spirits of the household storeroom. All of the above elements of Roman domestic worship are present in the lararia of Pompeii. The Genius was the living force of a man and was an important element in domestic religion. -

Apoikia in the Black Sea: the History of Heraclea Pontica, Sinope, and Tios in the Archaic and Classical Periods
University of Central Florida STARS Honors Undergraduate Theses UCF Theses and Dissertations 2018 Apoikia in the Black Sea: The History of Heraclea Pontica, Sinope, and Tios in the Archaic and Classical Periods Austin M. Wojkiewicz University of Central Florida Part of the Ancient History, Greek and Roman through Late Antiquity Commons, and the European History Commons Find similar works at: https://stars.library.ucf.edu/honorstheses University of Central Florida Libraries http://library.ucf.edu This Open Access is brought to you for free and open access by the UCF Theses and Dissertations at STARS. It has been accepted for inclusion in Honors Undergraduate Theses by an authorized administrator of STARS. For more information, please contact [email protected]. Recommended Citation Wojkiewicz, Austin M., "Apoikia in the Black Sea: The History of Heraclea Pontica, Sinope, and Tios in the Archaic and Classical Periods" (2018). Honors Undergraduate Theses. 324. https://stars.library.ucf.edu/honorstheses/324 APOIKIA IN THE BLACK SEA: THE HISTORY OF HERACLEA PONTICA, SINOPE, AND TIOS IN THE ARCHAIC AND CLASSICAL PERIODS by AUSTIN M. WOJKIEWICZ A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the Honors in the Major Program in History in the College of Arts & Humanities and in The Burnett Honors College at the University of Central Florida Orlando, FL Spring Term, 2018 Thesis Chair: Edward Dandrow ABSTRACT This study examines the influence of local and dominant Network Systems on the socio- economic development of the southern Black Sea colonies: Heraclea Pontica, Sinope, and Tios during the Archaic and Classical Period. I argue that archeological and literary evidence indicate that local (populations such as the Mariandynoi, Syrians, Caucones, Paphlagonians, and Tibarenians) and dominant external (including: Miletus, Megara/Boeotia, Athens, and Persia) socio-economic Network systems developed and shaped these three colonies, and helped explain their role in the overarching Black Sea Network. -

Hier Finden Sie Das Ganze Dokument (Pdf, 2
Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung des Deutschen Instituts für Internationale Pädagogische Forschung Lehrstuhl für Allgemeine Pädagogik der Universität Leipzig Dic Cur Hic Sag, warum du hier bist Joachimsthal – Berlin – Templin 400 Jahre Joachimsthalsches Gymnasium Katalog zur Ausstellung Berlin 2007 Herausgeber: Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung des Deutschen Instituts für Internationale Pädagogische Forschung Ausstellungskonzeption: PD Dr. Jonas Flöter Gestaltung und Ausführung der Ausstellung: Angelika Dahm-Ritzi + Rainer von Braun Umschlaggestaltung: Angelika Dahm-Ritzi Ausstellungsdauer: 18. Juni bis 9. November 2007 Ausstellungsort: Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung Warschauer Str. 34 10243 Berlin Öffnungszeiten: Montag – Freitag: 10.00 – 18.00 Uhr Vorwort 1956 löste die Bezirksregierung Neubrandenburg eine der bedeutendsten Bildungseinrichtungen des ehemaligen Preußens auf. Damit endet auf den ersten Blick die Geschichte des Joachimsthalschen Gymnasiums, das 1607 von Kurfürst Joachim Friedrich als Fürstenschule gegründet wurde. Bei genauerem Hinsehen finden sich jedoch institutionelle Kon- tinuitätslinien bis in die Gegenwart, worauf an anderer Stelle zurückge- kommen wird. Das Joachimsthalsche Gymnasium hatte über Jahrhun- derte einen wichtigen Beitrag zur Elitenbildung in der preußischen Mo- narchie geleistet und dabei eine eigene Tradition, ein eigenes Selbstver- ständnis entwickelt. Diese fest verwurzelte Identität der Joachimsthaler passte nicht mehr in die gesellschaftlichen Verhältnisse -
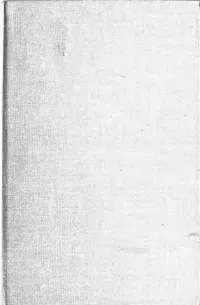
Illinois Classical Studies, Volume I
r m LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN 880 v.l Classics The person charging this material is re- sponsible for its return to the library from which it was withdrawn on or before the Latest Date stamped below. Theft, mutilation, and underlining of books are reasons for disciplinary action and may result in dismissal from the University. UNIVERSITY OF ILLINOIS LIBRARY AT URBANA-CHAMPAIGN DEC la 76 199^ hwvi (JCTl2«n Mil TO JUL 08 1938 SFP 1 3 19 '9 mi 1 4 15'^1), ^JUL s 5 ^f FES 2 i U84 JAIIZ2 m 3 1939 L161 — O-1096 ILLINOIS CLASSICAL STUDIES, VOLUME I ILLINOIS CLASSICAL STUDIES VOLUME I 1976 Miroslav Marcovich, Editor UNIVERSITY OF ILLINOIS PRESS Urbana Chicago London [976 by the Board of Trustees of the University of Illinois Manufactured in the United States of America ISBN: 0-252-00516-3 •r or CLASSICS Preface Illinois Classical Studies (ICS) is a serial publication of the Classics Depart- ments of the University of Illinois at Urbana-Champaign and Chicago Circle which contains the results of original research dealing with classical antiquity and with its impact upon Western culture. ICS welcomes scholarly contributions dealing with any topic or aspect of Greek and/or Roman literature, language, history, art, culture, philosophy, religion, and the like, as well as with their transmission from antiquity through Byzantium or Western Europe to our time. ICS is not limited to contributions coming from Illinois. It is open to classicists of any flag or school of thought. In fact, of sixteen contributors to Volume I (1976), six are from Urbana, two from Chicago, six from the rest of the country, and two from Europe. -

Bär Zu Brodersen
Kai BRODERSEN (Hg., Übers.), Ailianos. Tierleben. Berlin/Boston: De Gruyter 2018, 864 S. Der römische Sophist und Rhetoriklehrer Claudius Aelianus (ca. 170-222 n. Chr.) hat mehrere griechische Prosaschriften zu unterschiedlichen Themen verfasst. Von diesen sind uns drei heute noch vollständig erhalten: Eine Bunte Ge- schichte (Ποικίλη ἱστορία, Varia historia) in vierzehn Büchern, eine Schrift Über die Eigenart der Tiere (Περὶ ζῴων ἰδιότητος, De natura animalium) in siebzehn Büchern, sowie zwanzig (in ihrer Echtheit allerdings angezweifelte) Bauern- briefe (Ἐπιστολαὶ ἀγροικικαί, Epistulae rusticae). Kai Brodersen (B.) – Professor für Alte Geschichte an der Universität Erfurt und im deutschsprachigen Raum einer breiten Öffentlichkeit als Übersetzer und Vermittler der Antike be- kannt – hat die beiden erstgenannten Schriften letztes Jahr in der renommier- ten zweisprachigen Sammlung Tusculum herausgebracht (Brodersen 2018a; Brodersen 2018b). Seine Übersetzung von De natura animalium ist Gegenstand dieser Rezension. Eine „Einführung“ (S. 14-20) und ein „Anhang“ (S. 849-864) rahmen den Hauptteil des über achthundert Seiten starken Buches. In der Einführung gibt B. einen Überblick über das Wenige, was aus Aelians Leben bekannt ist, und über den Aufbau und die Wirkungsintention von dessen Schrift De natura animalium, deren Titel erst seit dem Mittelalter bezeugt ist und sich in seiner deutschen Wiedergabe durch B. an Brehms Thierleben – die bekannte populär- wissenschaftliche Darstellung der Tier- und Artenvielfalt des deutschen Zoo- logen Alfred Brehm (1829-1884)1 – anlehnt. Ebenfalls angesprochen und disku- tiert werden der hohe Wert des Werkes für die Quellenforschung, der darin besteht, dass Aelian „eine Vielzahl älterer Autoren und Werke [nennt]“ (S. 11), sowie die bisher existierenden Textausgaben und Übersetzungen. Im Anhang finden sich eine Gegenüberstellung der älteren, auf Hercher (1864) zurück- gehenden Kapitelzählung mit der neuen von García Valdés/Llera Fueyo/Rod- ríguez-Noriega Guillén (2009) (GLR), deren griechischen Text B. -

Bibliography R W A
BIBLIOGRAPHY Reference Works The Anchor Bible Dictionary. Ed. David Noel Freedman. 6 vols. New York: Doubleday, 1992. Bauer, W., F.W. Danker, W.F. Arndt, and F.W. Gingrich. A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature. 3rd ed. Chicago: University of Chicago Press, 1999. Brill’s New Pauly: Encyclopedia of the Ancient World. Eds. H. Cancik and H. Schneider; English Edn. Managing Ed. Christine F. Salazar. 9 volumes. Leiden: Brill, 2006. Der neue Pauly: Enzyklopädie der Antike. Eds. H. Cancik and H. Schneider. 16 vols. Stuttgart: J.B. Metzler, 1996–2003. Lexicon of Greek Personal Names. Eds. P.M. Fraser and E. Matthews. 4 vols. Oxford: Clarendon Press. 1987–2005. Liddell, H.G. and R. Scott. Greek-English Lexicon. Rev. H.S. Jones and R. McKenzie. 9th ed. with rev. supplement. Oxford: Clarendon, 1949; 1996. Metzger, Bruce M. A Textual Commentary on the Greek New Testament. 2nd ed. New York; London: United Bible Society, 1971. The Oxford Classical Dictionary. 3rd ed. Eds. Simon Hornblower and Antony Spaw- forth. Oxford; New York: Oxford University Press, 1996. Smyth, H.W. Greek Grammar. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1920; rev. 1956. Ancient Sources and Translations Aelian. Claudii Aeliani de natura animalium libri xvii, varia historia, epistolae, frag- menta. Ed. Rudolf Hercher. 2 vols Leipzig: Teubner, 1864 (repr. 1971). Aelius Theon. Progymnasmata. L. Spengel, Rhetores Graeci, vol. 2. Leipzig: Teubner, 1854 (repr. 1966): 59–130. The Letters of Alciphron, Aelian, and Philostratus. With an English translation by Allen Rogers Benner and Francis H. Fobes. LCL. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1949. -

Florida State University Libraries
Florida State University Libraries 2016 The Historicity of Homeric Warfare: Battle in the 'Iliad' and the Hoplite Phalanx, c. 750 to 480 BCE Carlos Devin Fernandez Follow this and additional works at the FSU Digital Library. For more information, please contact [email protected] THE FLORIDA STATE UNIVERSITY COLLEGE OF ARTS & SCIENCES The Historicity of Homeric Warfare: Battle in the Iliad and the Hoplite Phalanx, c. 750 – 480 BCE By CARLOS DEVIN FERNANDEZ A Thesis submitted to the Department of Classics in partial fulfillment of the requirements for graduation with Honors in the Major Spring, 2016 2 The members of the Defense Committee approve the thesis of Carlos Devin Fernandez defended on April 19, 2016. 3 Chapter One: Introduction The purpose of this thesis is to examine the nature of battle in Homer’s Iliad, and its relationship to the actual practices of the Archaic period. In particular, it aims to focus on the roles of foot soldiers in Homeric battle, and how their features compare to those of hoplites, who first emerged during the poet’s own era. The renowned epos of war relates the story of Achilles’ wrath against his fellow Greeks during the final year of the Trojan War, and as such, contains innumerable scenes of combat. Though the epic tends to underscore the aristeia (‘excellence’) of its heroes, who are often engaged in single-combat with one another, the same episodes also illustrate the participation of the masses on the battlefield. I shall argue that these scenes of battle, and their representations of infantry combat, when examined with supplementary literary and archaeological evidence, are essential tools in interpreting eighth- to sixth-century BCE warfare, particularly the roles of the average citizen and the development of the hoplite phalanx.1 Background: The Dating of a ‘Homeric Society’ The Iliad has been rigorously analyzed in the resurgence of ancient warfare scholarship over the last few decades. -

Christ As the Telos of Life: Moral Philosophy, Athletic Imagery, and the Aim of Philippians
CHRIST AS THE TELOS OF LIFE: MORAL PHILOSOPHY, ATHLETIC IMAGERY, AND THE AIM OF PHILIPPIANS Submitted by Bradley Arnold to the University of Exeter as a thesis for the degree of Doctor of Philosophy in Theology in March 2013. This thesis is available for Library use on the understanding that it is copyright material and that no quotation from the thesis may be published without proper acknowledgement. I certify that all material in this thesis which is not my own work has been identified and that no material has previously been submitted and approved for the award of a degree by this or any other University. Signature: …………………………………………………………………………………… ABSTRACT The aim of Paul’s letter to the Philippians has been understood in various ways: e.g. reassurance, consolation, advance of the gospel. This thesis presents a new analysis of Philippians that challenges these proposals and offers a new way of thinking about Paul’s overarching argumentative aim in this letter. After demonstrating the need to examine three areas (viz. moral philosophy, athletics, and vivid speech) in an historical analysis of Philippians and addressing methodological issues pertinent to this investigation (Part I), I turn to map out the historical context relevant for this project (Part II): viz. the broad structure of thought in ancient moral philosophy, ancient athletics and its association with virtue, and the use of vivid description to persuade an audience. The final part of this thesis (Part III) is an exegetical analysis of Philippians that interprets the letter in light of the contextual material discussed in Part II, exploring how this contextual material contributes to and is interrelated in Paul’s persuasive appeal to morally form the Philippian Christians in a particular way. -

Ingo Werner Gerhartz Tragische Schuld
Ingo Werner Gerhartz Tragische Schuld ALBER THESEN A Die Frage nach der Schuld des Ödipus ist nicht nur eines der meist- diskutierten Probleme der philologischen Tragödienforschung, son- dern verweist als Paradigma tragischen Handelns auf die Verstrickun- gen einer menschlichen Freiheit, die sich von den Bedingungen ihrer eigenen Existenz zu lösen versucht und ihnen doch stets verhaftet bleibt. Solange jedoch ein modernes, auf individuelle Verantwortlich- keit reduziertes Verständnis von Schuld unhinterfragt an das antike Drama herangetragen wurde, musste Sophokles schweigen. Erst die philosophische Reflexion grundlegender Begrifflichkeiten eröffnet den Blick auf die kultische Metaphorik der Befleckung (miasma) im rituellen Untergrund der Tragödie und den wesenhaft ekstatischen Ursprungsbezug von Mythologie überhaupt. Indem tragische Schuld solcherart über die engen Grenzen sub- jektiver Zurechenbarkeit hinaus gedeutet wird, liefert sie nicht nur wichtige Impulse für mehrere Forschungsprobleme der beteiligten Disziplinen, sondern erschließt auch eine neue Perspektive auf das Verhältnis des Stücks zu drängenden Fragen unserer Zeit als Aus- einandersetzung mit Hybris und Fehlbarkeit des Menschen im Schat- ten eines mißverstandenen Ideals grenzenloser Machbarkeit. Der Autor: Ingo Werner Gerhartz, Jahrgang 1979, studierte in Mainz Philoso- phie und Griechische Philologie. Seit 2015 ist er Lehrbeauftragter am Arbeitsbereich für Praktische Philosophie der Johannes Guten- berg-Universität Mainz. Ingo Werner Gerhartz Tragische Schuld Philosophische