Teil 2: Visionen Und Realität – Vielfalt Innerhalb Der Gesellschaft
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Dorot: the Mcgill Undergraduate Journal of Jewish Studies Volume 15
Dorot: The McGill Undergraduate Journal of Jewish Studies Volume 15 – 2016 D O R O T: The McGill Undergraduate Journal of Jewish Studies D O R O T: The McGill Undergraduate Journal of Jewish Studies Published by The Jewish Studies Students’ Association of McGill University Volume 15 2016 Copyright © 2016 by the Jewish Studies Students’ Association of McGill University. All rights reserved. Printed in Canada. No part of this book may be used or reproduced in any manner whatsoever without permission except in the case of brief quotations embodied in critical articles or reviews. The opinions expressed herein are solely those of the authors included. They do not necessarily reflect those of the Department of Jewish Studies or the Jewish Studies Students’ Association. ISSN 1913-2409 This is an annual publication of the Jewish Studies Students’ Association of McGill University. All correspondence should be sent to: 855 Sherbrooke Street West Montreal, Quebec, Canada H3A 2T7 Editor in Chief Caroline Bedard Assistant Editors Akiva Blander Rayna Lew Copy Editors Lindsay MacInnis Patricia Neijens Cover Page Art Jennifer Guan 12 Table of Contents Preface i Introduction v To Emerge From the Ghetto Twice: Anti-Semitism and 1 the Search for Jewish Identity in Post-War Montreal Literature Madeleine Gomery The Origins of Mizrahi Socio-Political Consciousness 21 Alon Faitelis The “Israelization” of Rock Music and Political Dissent 38 Through Song Mason Brenhouse Grace Paley’s Exploration of Identity 54 Madeleine Gottesman The Failure of Liberal Politics in Vienna: 71 Alienation and Jewish Responses at the Fin-de-Siècle Jesse Kaminski Author Profiles 105 Preface Editor-in-chief, Caroline Bedard, and five contributors put together a terrific new issue of Dorot, the undergraduate journal of McGill’s Department of Jewish Studies. -
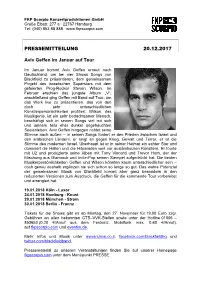
PRESSEMITTEILUNG 20.12.2017 Aviv Geffen Im
FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH Große Elbstr. 277 a ∙ 22767 Hamburg Tel. (040) 853 88 888 ∙ www.fkpscorpio.com PRESSEMITTEILUNG 20.12.2017 Aviv Geffen im Januar auf Tour Im Januar kommt Aviv Geffen erneut nach Deutschland, um bei vier Shows Songs von Blackfield zu präsentieren, dem gemeinsamen Projekt des israelischen Superstars mit dem gefeierten Prog-Rocker Steven Wilson. Im Februar erschien das jüngste Album „V“, anschließend ging Geffen mit Band auf Tour, um das Werk live zu präsentieren, das von den doch sehr unterschiedlichen Künstlerpersönlichkeiten profitiert. Wilson, das Musikgenie, ist ein sehr bedachtsamer Mensch, beschäftigt sich in seinen Songs viel mit sich und seinem teils eher dunkel angehauchten Seelenleben. Aviv Geffen hingegen richtet seine Stimme nach außen – in seinen Songs fordert er den Frieden zwischen Israel und den arabischen Ländern, er singt an gegen Krieg, Gewalt und Terror, er ist die Stimme des modernen Israel. Überhaupt ist er in seiner Heimat ein echter Star und dominiert die Hallen und die Hitparaden weit vor ausländischen Künstlern. Er tourte mit U2 und produzierte seine Alben mit Tony Visconti und Trevor Horn, der der Mischung aus Glamrock und Indie-Pop seinen Stempel aufgedrückt hat. Die beiden Musikerpersönlichkeiten Geffen und Wilson könnten kaum unterschiedlicher sein – doch genau deshalb ergänzen sie sich schon so lange so gut. Das wahre Potenzial der gemeinsamen Musik von Blackfield kommt aber ganz besonders in den reduzierten Versionen zum Ausdruck, die Geffen für die kommende Tour vorbereitet und arrangiert hat. 19.01.2018 Köln - Luxor 24.01.2018 Hamburg - Knust 29.01.2018 München - Strom 30.01.2018 Berlin - Frannz Tickets für die Shows gibt es ab Montag, den 27. -
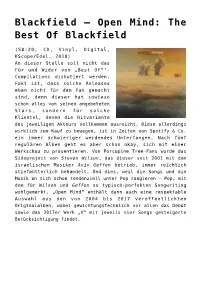
Open Mind: the Best of Blackfield
Blackfield – Open Mind: The Best Of Blackfield (58:20, CD, Vinyl, Digital, KScope/Edel, 2018) An dieser Stelle soll nicht das Für und Wider von „Best Of“‘- Compilations diskutiert werden. Fakt ist, dass solche Releases eben nicht für den Fan gemacht sind, denn dieser hat sowieso schon alles von seinen angebeteten Stars, sondern für solche Klientel, denen die Hitvariante des jeweiligen Akteurs vollkommen ausreicht. Diese allerdings wirklich zum Kauf zu bewegen, ist in Zeiten von Spotify & Co. ein immer schwieriger werdendes Unterfangen. Nach fünf regulären Alben geht es aber schon okay, sich mit einer Werkschau zu präsentieren. Von Porcupine Tree-Fans wurde das Sideproject von Steven Wilson, das dieser seit 2001 mit dem israelischen Musiker Aviv Geffen betrieb, immer reichlich stiefmütterlich behandelt. Und dies, weil die Songs und die Musik an sich schon tendenziell unter Pop rangieren – Pop, mit dem für Wilson und Geffen so typisch-perfekten Songwriting wohlgemerkt. „Open Mind“ enthält dann auch eine respektable Auswahl aus den von 2004 bis 2017 veröffentlichten Originalalben, wobei gewichtungstechnisch vor allen das Debüt sowie das 2017er Werk „V“ mit jeweils vier Songs gesteigerte Berücksichtigung findet. Zum Schutz Ihrer persönlichen Daten ist die Verbindung zu YouTube blockiert worden. Klicken Sie auf Video laden, um die Blockierung zu YouTube aufzuheben. Durch das Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzbestimmungen von YouTube. Mehr Informationen zum Datenschutz von YouTube finden Sie hier Google – Datenschutzerklärung & Nutzungsbedingungen. YouTube Videos zukünftig nicht mehr blockieren. Video laden Es ist aber auch hier wie bei anderen Bands mit einem Rock’n Pop Aspekt – wo viel Licht ist eben auch viel Schatten. -

Table of Contents
Table of Contents From the Editors 3 From the President 3 From the Executive Director 5 The Sound Issue “Overtures” Music, the “Jew” of Jewish Studies: Updated Readers’ Digest 6 Edwin Seroussi To Hear the World through Jewish Ears 9 Judah M. Cohen “The Sound of Music” The Birth and Demise of Vocal Communities 12 Ruth HaCohen Brass Bands, Jewish Youth, and the Sonorities of a Global Perspective 14 Maureen Jackson How to Get out of Here: Sounding Silence in the Jewish Cabaretesque 20 Philip V. Bohlman Listening Contrapuntally; or What Happened When I Went Bach to the Archives 22 Amy Lynn Wlodarski The Trouble with Jewish Musical Genres: The Orquesta Kef in the Americas 26 Lillian M. Wohl Singing a New Song 28 Joshua Jacobson “Sounds of a Nation” When Josef (Tal) Laughed; Notes on Musical (Mis)representations 34 Assaf Shelleg From “Ha-tikvah” to KISS; or, The Sounds of a Jewish Nation 36 Miryam Segal An Issue in Hebrew Poetic Rhythm: A Cognitive-Structuralist Approach 38 Reuven Tsur Words, Melodies, Hands, and Feet: Musical Sounds of a Kerala Jewish Women’s Dance 42 Barbara C. Johnson Sound and Imagined Border Transgressions in Israel-Palestine 44 Michael Figueroa The Siren’s Song: Sound, Conflict, and the Politics of Public Space in Tel Aviv 46 Abigail Wood “Surround Sound” Sensory History, Deep Listening, and Field Recording 50 Kim Haines-Eitzen Remembering Sound 52 Alanna E. Cooper Some Things I Heard at the Yeshiva 54 Jonathan Boyarin The Questionnaire What are ways that you find most useful to incorporate sound, images, or other nontextual media into your Jewish Studies classrooms? 56 Read AJS Perspectives Online at perspectives.ajsnet.org AJS Perspectives: The Magazine of President Please direct correspondence to: the Association for Jewish Studies Pamela Nadell Association for Jewish Studies From the Editors perspectives.ajsnet.org American University Center for Jewish History 15 West 16th Street Dear Colleagues, Vice President / Program New York, NY 10011 Editors Sounds surround us. -

The Story of Israel at 66 Through the Songs of Arik Einstein
1 The Soundtrack of Israel: The Story of Israel at 66 through the songs of Arik Einstein Israel turns sixty six this year and a so much has happened in this seemingly short lifetime. Every war, every peace treaty, every struggle, and every accomplishment has left its impact on the ever changing character of the Jewish State. But throughout all of these ups and downs, all of the conflicts and all of the progress, there has been one voice that has consistently spoken for the Jewish nation, one voice that has represented Israelis for all 66 years and will continue to represent a people far into the future. That is the voice of Arik Einstein. Einstein’s music, referred to by Prime Minister Benjamin Netanyahu as the “soundtrack of Israel,” transcended generations. Einstein often took the words of high-brow Israeli poets such as Chaim Nachman Bialik, Rahel, Nathan Alterman and Avraham Halfi and turned them into rock anthems sung by vibrant Israeli youth. Einstein captured the heart and soul of Israelis old and young. For every Zionist, peacenik, settler, hopeless romantic, nostalgia aficionado and child (or child at heart) in Israel, there is at least one Arik Einstein song that speaks to them. For every historic Israeli moment, there is an Arik Einstein song that represents the emotion of a united nation, or a shuttered people. Although fairly unknown outside of Israel, Arik Einstein was loved by all, and mourned by all after his sudden death in November of 2013, when tens of thousands of Israelis joined together to pay their respects to the iconic Sabra at a memorial service in Rabin Square in Tel Aviv. -

Pardes : Zeitschrift Der Vereinigung Für Jüdische Studien Ev
PaRDeS ZEITSCHRIFT DER VEREINIGUNG FÜR JÜDISCHE STUDIEN E.V. PaRDeS. DIE ZEITSCHRIFT DER VEREINIGUNG FÜR JÜDISCHE STUDIEN E.V., möch- te die fruchtbare und facettenreiche Kultur des Judentums sowie seine Berührungspunkte zur Umwelt in den unterschiedlichen Bereichen dokumentieren. Daneben dient die Zeitschrift als Forum zur Positionierung der Fächer Jüdische Studien und Judaistik innerhalb des wissen- schaftlichen Diskurses sowie zur Diskussion ihrer historischen und gesellschaftlichen Verantwortung. Das Wort Pardes (Obstgarten) und die Kultur der altorientalischen Königsgärten tritt bereits in den biblischen Erzählungen vom Gan Eden, dem Paradies der ersten Menschen, in Erscheinung. In der rabbinischen Tradition schafft Pardes als Stichwort Assoziationen zur tal- mudischen Legende von den vier Gelehrten, die mystische Studien betrieben und RaSCHI zufolge mittels heiliger Gottesnamen vor den himmlischen Thron Gottes zu gelangen versuchten. Ist für diesen mittelalterlichen Ausleger das Wort Pardes Sinnbild für den Höhepunkt des mystischen Erlebnisses, so verstehen die Kabbalisten PaRDeS als Abbreviatur für den vierfa- chen Schriftsinn, der als exegetische Methode den Weg zur Seele der Tora und zur Vereinigung mit Gott beschreibt. Eine andere Bedeutung als in der traditionellen Literatur des Judentums erhielt das Wort mit dem Entstehen des Zionismus. Der Pardes und seine durch eine gleichna- mige Orangen-Export-Gesellschaft nach Europa verschifften Früchte wurden zum Symbol für die landwirtschaftlichen Errungenschaften der jüdischen Kolonien und die wirtschaftlichen Erfolge des Staates Israel. THEMENHEFT ZUM 150. TODESTAG VON HEINRICH HEINE ISSN 1614-6492 ISBN 3-939469-19-X (2006) HEFT 12 ISBN 978-3-939469-19-3 UNIVERSITÄTSVERLAG POTSDAM PaRDeS 12 PaRDeS ZEITSCHRIFT DER VEREINIGUNG FÜR JÜDISCHE STUDIEN E.V. HERAUSGEGEBEN VON NATHANAEL RIEMER IM AUFTRAG DER VEREINIGUNG FÜR JÜDISCHE STUDIEN E.V. -

Y I R M I P I N K U S / C U R R I C U L U M V I T
- 1 - Y i r m i P i n k u s / C u r r i c u l u m V i t a e First and last name: Yirmi Waldmann Pinkus Born: Israel, 15th of July 1966 Family status: B + 1 Address: 68 Bilu St., Tel Aviv 6425615 Tel: +972-3-6293964 Email address: [email protected] Yirmi Pinkus is an Israeli illustrator, author and associate professor at the Shenkar College of Art, Engineering and Design in Israel. Pinkus is one of the founders of the alternative comics group Actus (founded in 1996), that has won international acclaim and was listed in 2007 by the American ID design magazine as one of the most prominent contemporary design groups. On 2000 he founded the program for illustration studies at the Shenkar College, Israel, and served as the director of the program for 11 years. In 2008 Pinkus's illustrated novel entitled Professor Fabrikant’s Historical Cabaret was published. The book was awarded the Sapir Prize for Debut Literature, and was translated into Italian and published by Cargo Publishing, and into French by Grasset Publishing. In 2010 he was awarded the Israeli Prime Minister's Award for his achievements as an author of fiction and graphic novellas. In 2011, an exhibition of Pinkus' work was shown at the Cartoonmuseum Basel (Basel Caricature Museum). His comics book Mr. Fibber the Storyteller, based on stories by Lea Goldberg, won the 2014 Israel Museum Award for Children's Book Illustration. In 2013, he founded, with Prof. Rutu Modan (Bezalel Academy of Art) Noah Books - an independent, experimental publishing house whose goal is to nurture and foster visual literacy among pre-schoolers. -

Yesterday. Inspiring Tomorrow
1 Yesterday. Inspiring tomorrow. An Educator's Guide to Israel's Attic Vintage Posters Reflecting the Zionist Idea as Expressed in The Jerusalem Program Office of the Vice Chairman, World Zionist Organization Draft – Not for Distribution 2 Prepared by: Dr. David Breakstone Atara Volk Gila Ansell Brauner Office of the Vice-Chairman, World Zionist Organization 3 An Educator's Guide to Israel's Attic Vintage Posters Reflecting the Zionist Idea as Expressed in The Jerusalem Program Table of Contents 1. Foreword 2. The Jerusalem Program 3. List of Posters and Titles 4. Option One: General Activity for the Entire Exhibition 5. Option Two: Option Two: Cluster-Based Activities 6. Cluster by Cluster Guide: 1) Value #1 Return 2) Value #2 Aliyah 3) Value #3 Hebrew 4) Value #4 Peace and Security 5) Value #5 Normalization 6) Value #6 Empowerment of Women 7) Value #7 Produce of Israel 8) Value #8 Continuing the Vision 4 1. Foreword The activities proposed on these pages offer ideas and suggestions for working with the set of posters, "Yesterday. Inspiring tomorrow." They are aimed at enhancing the learner's appreciation of the Zionist idea and are appropriate for use with various target populations and a range of ages from middle school through adult, irrespective of prior knowledge of the subject. These activity ideas can be adapted to both formal and informal educational frameworks, either as a stand-alone units or as part of a wider program. The units are designed to help the target population associate affectively with the theme of the exhibition, using the visual and aural senses, as well as through cognitive perception. -

Corpus Antville
Corpus Epistemológico da Investigação Vídeos musicais referenciados pela comunidade Antville entre Junho de 2006 e Junho de 2011 no blogue homónimo www.videos.antville.org Data Título do post 01‐06‐2006 videos at multiple speeds? 01‐06‐2006 music videos based on cars? 01‐06‐2006 can anyone tell me videos with machine guns? 01‐06‐2006 Muse "Supermassive Black Hole" (Dir: Floria Sigismondi) 01‐06‐2006 Skye ‐ "What's Wrong With Me" 01‐06‐2006 Madison "Radiate". Directed by Erin Levendorf 01‐06‐2006 PANASONIC “SHARE THE AIR†VIDEO CONTEST 01‐06‐2006 Number of times 'panasonic' mentioned in last post 01‐06‐2006 Please Panasonic 01‐06‐2006 Paul Oakenfold "FASTER KILL FASTER PUSSYCAT" : Dir. Jake Nava 01‐06‐2006 Presets "Down Down Down" : Dir. Presets + Kim Greenway 01‐06‐2006 Lansing‐Dreiden "A Line You Can Cross" : Dir. 01‐06‐2006 SnowPatrol "You're All I Have" : Dir. 01‐06‐2006 Wolfmother "White Unicorn" : Dir. Kris Moyes? 01‐06‐2006 Fiona Apple ‐ Across The Universe ‐ Director ‐ Paul Thomas Anderson. 02‐06‐2006 Ayumi Hamasaki ‐ Real Me ‐ Director: Ukon Kamimura 02‐06‐2006 They Might Be Giants ‐ "Dallas" d. Asterisk 02‐06‐2006 Bersuit Vergarabat "Sencillamente" 02‐06‐2006 Lily Allen ‐ LDN (epk promo) directed by Ben & Greg 02‐06‐2006 Jamie T 'Sheila' directed by Nima Nourizadeh 02‐06‐2006 Farben Lehre ''Terrorystan'', Director: Marek Gluziñski 02‐06‐2006 Chris And The Other Girls ‐ Lullaby (director: Christian Pitschl, camera: Federico Salvalaio) 02‐06‐2006 Megan Mullins ''Ain't What It Used To Be'' 02‐06‐2006 Mr. -

Voice O Âúˆùèîfi˜ ¯¿ÚÙ˘ Ù˘ Aı‹Ó·˜
25 ¡√∂ªµƒπ√À - 1 ¢∂∫∂ªµƒπ√À 2004 . ∆∂ÀÃ√™ 58 . 210 ∏ ºø¡∏ ∆∏™ ∞£∏¡∞™.WWW.ATHENSVOICE.GR . FREE PRESS ∫∞£∂ ¶∂ª¶∆∏ voice M·ı‹Ì·Ù· ÂÈˇ›ˆÛ˘ T˘ M·Ú›·˜ XÔ‡ÎÏË, ÛÂÏ.10 «AÓÔÚıfi‰ÔÍÔÈ» ŒÏÏËÓ˜ ATHENS ∆Ô˘ ¢ËÌ‹ÙÚË º‡ÛÛ·, ÛÂÏ. 12 Lifting ÛÙÔ §˘Î·ˇËÙÙÔ T˘ B¿Ï˘˜ B·˚Ì¿ÎË, ÛÂÏ. 15 O ÂÚˆÙÈÎfi˜ ¯¿ÚÙ˘ TˆÓ M·Ú›·˜ Cyber,Ù˘ AÚÈÛÙ›‰Ë Aı‹Ó·˜Z‹Ó‰ÚÔ˘, ÛÂÏ. 16 NÀÃ∆∞ ™∆∞™√À... H «A.V.» ¿ÂÈ ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ· T˘ °ÈÒÙ·˜ AÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘, ÛÂÏ. 18 2 ATHENS VOICE 25 ¡√∂ªµƒπ√À - 1 ¢∂∫∂ªµƒπ√À 2004 25 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ - 1 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2004 ¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞ ∂ÈÎfiÓ· Â͈ʇÏÏÔ˘: ¡›ÎÔ˜ µ·Ó‰ÒÚÔ˜ EDITO ∆Ô˘ ºø∆∏ °∂øƒ°∂§∂ £∂ª∞∆∞ Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ËıÔÔÈÔ‡˜ ÙÔ˘ Û›ÚÈ·Ï «AگȤϷÁÔ˜» ¤ÏÂÁ ¤Ó· ‚Ú¿‰˘: «¶ÚÈÓ ·fi Ï›Á· ¯ÚfiÓÈ·, fiÙ·Ó Á˘Ú›˙·Ì ٷÈÓ›· ÙÔ˘ AÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˘ ÛÙË ºÏÒÚÈÓ·, Ù· ÌÂÁ¿ÊˆÓ· ÙˆÓ ÂÎ- 10 EȉÈÎfi˜ ÛÙËÓ ÂÈˇ›ˆÛË Œ ÎÏËÛÈÒÓ ¤·È˙·Ó ÂÌ‚·Ù‹ÚÈ· fiÏË Ì¤Ú· Î·È ÔÈ ·¿‰Â˜ ÊÒÓ·˙·Ó, ›ÛÙ ·Ì·ÚÙˆÏÔ›, ı· •ÈÊÔÌ·¯Â› Ì ÙÔ˘˜ ÂÊÈ¿ÏÙ˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∫fiÏ·ÛË Û·˜ ·ÊÔÚ›ÛÔ˘ÌÂ. TÒÚ· ‰Â¯Ù‹Î·Ì ›ıÂÛË ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Ê·Ó·ÙÈÎÔ‡˜». Afi ÙÔ ¯ˆÚÈfi §¿- Î·È ÛÙÔÓ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ – Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ · Ù˘ A¯·˝·˜ ˆ˜ ÙÔ ¯ˆÚÈfi E¯›ÓÔ˜ Ù˘ £Ú¿Î˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË ·fiÛÙ·ÛË. ¶ÚÈÓ ·fi ¤Ó· Ì‹Ó· T˘ M·Ú›·˜ XÔ‡ÎÏË Â›¯·Ì ÙË ÁÓˆÛÙ‹ ÂÙ‹ÛÈ· Û˘˙‹ÙËÛË Ù˘ ÛËÌ·›·˜. -

Agent Fox Mulder - Top 20 Albums of 00'S Decade Written by Agent Fox Mulder – July 2011 Agent Fox Mulder - Top 20 Albums of 00'S Decade
Agent Fox Mulder - Top 20 Albums of 00's Decade Written by Agent Fox Mulder – July 2011 Agent Fox Mulder - Top 20 Albums of 00's Decade As I started listen to the music around 10 years ago, I was studying in secondary school at that time. I was changing from Pop-Rock teen hits music to classic rock band like Queen, Pink Floyd & The Beatles. That is ten years until now. So I grew up with 70’s music while the world was moving to 00’s. The decade that everybody said that there will be lots of good things happen. Now 00’s is over, with the answer I got that the world consecutively moves to civilisation age. But if’s in good or bad way is very personal thing. When human population increases, complexity in social and cultures increases. It‘s harder to tell that whatever something is good or bad. As each other is always has his/her owns personal reason. So you may waste your time on trying to understand these reasons. How the world changes, I couldn’t say much. But for Thai life & culture, 00’s is the decade that technologies, fashion, communication and social networking completely eradicate art. Thai life & culture that I thought that it is extensive and colourful. But the last ten years tells me that it was confined. This is something that we can’t avoid if the life & cultures are still driving by technologies, fashion, communication and social networking like this. The world will be full of the people who wishs the same lifestyle. -

The Mini-Scroll
WWW. TTHE MMINI‐‐SSCROLL A PUBLICATION OF OHEV SHOLOM TALMUD TORAH CONGREGATION 18320 Georgia Avenue P.O. Box 1227 Olney, MD 20832 PHONE: 301‐570‐8663 FAX: 301‐260‐2040 WWW.OSTTOLNEY.ORG PARSHAS KI SAVO This week's Gala Kiddush is sponsored by the Olney Community in honor of the Shields and Rosenthal Families. Thank you for everything that you did for the community for the last year! All are invited to a festive Shalosh Seudos Sheva Brachos for David and Batsheva Faust sponsored by the Chansky Family. Friday Shabbos Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Aug 27 Aug 28 Aug 29 Aug 30 Aug 31 Sep 1 Sep 2 Shacharis Hashkama Shacharis I Shacharis Shacharis Shacharis Shacharis 6:30 am 7:45 am 7:30 am 6:20 am 6:30 am 6:30 am 6:20 am Mincha Parsha Class Shacharis II Mincha Mincha Mincha Mincha 6:45 pm 8:15 am 8:30 am 7:30 pm 7:30 pm 7:30 pm 7:30 pm Preferred Shacharis Mincha Maariv Maariv Maariv Maariv Candle 8:40 am 7:30 pm 8:30 pm 8:30 pm 8:30 pm 8:30 pm Lighting by: 7:15 pm Mincha Maariv Sanhedrin 5:50 pm 8:30 pm Shiur btwn Mincha & Maariv Shalosh Seudos 6:10 pm COMMUNITY INFO Classes •If you want to sponsor a Kiddush please contact Chava 7:45 pm Elbaum at [email protected] or 301.570.0763. • Do you know someone who needs help with meals or in Maariv other ways? Sisterhood wants to help.