Kooperieren, Vernetzen, Umsetzen Horst Klinkmann
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Findbuch Zum Bestand
Findbuch zum Bestand Persönlicher Archivbestand Jutta und Eberhard Seidel bearbeitet von Tina Krone ROBERT-HAVEMANN-GESELLSCHAFT Berlin 2014 Dieses Findbuch ist Ergebnis eines Erschließungsprojektes, das durch die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur und den Landesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR des Landes Berlin finanziert wurde. Robert-Havemann-Gesellschaft e.V. Schliemannstraße 23 10437 Berlin www.havemann-gesellschaft.de Reproduktion, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Robert-Havemann-Gesellschaft e.V. II Inhaltsverzeichnis Vorwort Geschichte und Aufbau des Bestandes II Biografische Daten Jutta und Eberhard Seidel VIII Hinweise zur Benutzung des Findbuches X Abkürzungsverzeichnis XI Bestandsverzeichnis 1. Persönliche Unterlagen / Korrespondenz 1 2. Arbeitsunterlagen / Thematische Materialsammlungen 2 2.1. Opposition der DDR 2 2.2. Bürgerbewegung, Revolution 1989/90 5 2.3. Ärzte für den Frieden / IPPNW 9 2.3.1. Ärzte für den Frieden 9 2.3.2. Ärzte in sozialer Verantwortung - DDR-Sektion der IPPNW, ab 1990 14 2.3.3. Deutsche Sektion der IPPNW/Ärzte in sozialer Verantwortung 16 2.3.4. Sekretariat der IPPNW, Sektion der DDR, bis 1990 17 2.3.4.1. Tätigkeit der DDR-Sektion der IPPNW 17 2.3.4.2. Korrespondenz der DDR-Sektion der IPPNW 21 2.3.4.3. Veranstaltungen der DDR-Sektion der IPPNW 23 2.3.4.4. Kongresse, Symposien, internationale Treffen und Veranstal- tungen der IPPNW 24 2.3.4.5. IPPNW-Zentrales Büro Boston und Europabüro London 30 2.3.4.6. Thematische Unterlagen 31 2.3.4.7. Sonstiges 32 2.4. Forschungsprojekt "MfS und IPPNW" 32 2.4.1. Unterlagen der eigenen Forschungstätigkeit 32 2.4.2. -

Prof. Dr. Dr.Hc (Mult.)
Prof. Dr. Dr.h.c. (mult.) Horst Klinkmann Professor Horst Klinkmann received his medical and engineering training in Germany, Hungary, Sweden and the U.K. He worked as a research professor and collaborated with W.J. Kolff, the father of artificial organs, at the University of Utah on the development of new blood purification procedures. In 1971 he became a professor and chairman of the Department of Internal Medicine at Rostock University, Germany, where he established one of the first interdisciplinary research centers for artificial organs in the world. In 1990 he was elected president of the German Academy of Science in Berlin. Since 1989 he has been dean of the International Faculty for Artificial Organs (INFA), an academic association of 16 universities around the world. From 2002 to 2015 he was president of BioCon Valley and president of the Curatorium for Health Economy in the federal state of Mecklenburg‐West Pomerania. Fourteen universities around the world awarded him an honorary doctorate or professorship, and eighteen national and international societies and institutes an honorary presidency or honorary membership (the International Society of Artificial Organs (ISAO), the European Society of Artificial Organs (ESAO), the Royal Colleges of Medicine and Surgery in Glasgow and Edinburgh, U.K., the Belgian Academy of Science, the Macedonian Academy of Sciences and Arts, the International Academy of Science, the German National Academy of Sciences Leopoldina and the Leibniz Association, the International Faculty of Artificial Organs (INFA), and the National Institute of Molecular Biology at Nankai University, Tianjin, China among others). Horst Klinkmann's publication list contains more than 500 scientific publications, books and book‐ chapters. -

Die Neue Landesregierung Von Mecklenburg-Vorpommern
Die neue Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern Schwerin, 24.10.2011 Morgen findet im Landtag die Wahl des Ministerpräsidenten statt. Anschließend wird der Ministerpräsident die weiteren Nummer: 246/2011 Mitglieder der Landesregierung ernennen. Der neuen Landesregierung von Mecklenburg- Vorpommern sollen folgende Mitglieder angehören: Erwin Sellering (SPD) Ministerpräsident Lorenz Caffier (CDU) Stellvertretender Ministerpräsident und Minister für Inneres und Sport Uta-Maria Kuder (CDU) Justizministerin Heike Polzin (SPD) Finanzministerin Harry Glawe (CDU) Minister für Wirtschaft, Bau und Tourismus Dr. Till Backhaus (SPD) Minister für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Mathias Brodkorb (SPD) Staatskanzlei Mecklenburg-Vorpommern Minister für Bildung, Wissenschaft und Kultur Schloßstraße 2– 4 19053 Schwerin Volker Schlotmann (SPD) Telefon: +49 385 588-1030 Telefax: +49 385 588-1038 Minister für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung E-Mail: [email protected] Manuela Schwesig (SPD) Internet: www.mv-regierung.de/stk Ministerin für Arbeit, Gleichstellung und Soziales V. i. S. d. P.: Andreas Timm 2 Kurzbiografien Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD) wurde am 18. Oktober 1949 in Sprockhövel geboren. Er studierte Rechtswissenschaften an den Universitäten Heidelberg, Bochum und Münster. Nach den beiden juristischen Staatsprüfungen 1975 und 1978 war er als Verwaltungsrichter am Verwaltungsgericht Gelsenkirchen tätig, ab 1994 am Verwaltungsgericht Greifswald. Von 1998 bis 2000 war er als Abteilungsleiter in der Staatskanzlei tätig und übernahm im September 2000 das Amt des Justizministers. 2006 wechselte er als Minister in das Ressort Soziales und Gesundheit. Seit 1994 ist Erwin Sellering Mitglied der SPD und gehört seit 1997 dem Landesvorstand an. Seit 2007 ist er Landesvorsitzender der SPD. Erwin Sellering ist seit 2002 Mitglied des Landtages. Im Oktober 2008 wählte der Landtag Erwin Sellering zum Ministerpräsidenten. -

Research, Innovation –Annual Report I on 2012/13 Forschung Innovation Jahresbericht Der Hochschule Wismar 2012/13 Research, Innovation – Annual Report 2012/13 4 5
ISBN: 978-3-942100-19-9 2012/13 FORSCHUNG UND INNOVATIon – JahreSBERICHT | RESEARCH AND INNOVATIon – ANNUAL REPORT | HOCHSCHULE WISMAR INNOVAT FORSCHUNG Jahresbericht der Hochschule Wismar | Wismar derHochschule Jahresbericht Research, Innovation – Annual Report –Annual Innovation Research, I ON 2012/13 FORSCHUNG INNOVATION Jahresbericht der Hochschule Wismar 2012/13 Research, Innovation – Annual Report 2012/13 4 5 Inhalt 1. Vorworte 3.1.14 Entwicklung, Bau und Test eines Prototypen für ein 3.3.11 Caspar-David-Friedrich Stipendium 72 neuartiges Touristik-Wasserfahrzeug mit 1.1 Forschung ist Teamarbeit 8 3.3.12 Hochschulinterne Forschungsförderung 73 innovativem Fahrassistenz-System 43 1.2 Senatsausschuss Forschung und Innovation (SAFI) 9 3.1.15 Hochschulinterne Forschungsförderung 44 4. Fakultätsübergreifende Aktivitäten 75 3.1.16 IfOD – Institut für Oberflächen- und 2. Forschungsorganisation Dünnschichttechnik 46 4.1.1 Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses 76 2.1 Forschung mit Blick auf den Horizont 12 3.1.17 ISSIMS – Institut für Innovative Schiffs-Simulation 4.1.2 Probabilistischer Bemessungsansatz zur und Maritime Systeme 46 Sicherung von Sohle und Böschungen an 2.2 Netzwerkarbeit zwischen Wissenschaft Bundeswasserstraßen 80 und Wirtschaft 24 4.1.3 Kommunikation im Raum europäischer Unternehmen 2.3 FGW – Forschungs-GmbH Wismar 26 3.2 Fakultät für Wirtschaftswissenschaften 49 als Interaktion zwischen internationaler Marketing- 3.2.1 Verbesserte Anbindung des Ostseeraums strategie und architektonischer Gestaltung am durch Luftverkehr -

Jahresbericht 2008 Mitglieder Biocon Valley Mecklenburg-Vorpommern E.V
Gesund. Innovativ. Annual Report Jahresbericht 2008 Mitglieder BioCon Valley Mecklenburg-Vorpommern e.V. Firmen (Gesundheitswirtschaft & Life Science) Aglycon Mycoton GmbH, Luckenwalde - AKG Reha-Zentrum GmbH & Co. KG, Graal-Müritz - AQUAZOSTA MB Marine Plant Biotechnolo- gy, Schwerin - arivis GmbH, Rostock - Armin Baack Bedarf und Technik für Labor und Medizin, Schwerin - ARTOSS GmbH, Rostock - ASD Advanced Simulation & Design GmbH, Rostock - Baltic Analytics GmbH, Greifswald - BioArt Products GmbH, Rostock - Bionas GmbH, Rostock - BIOSERV Diagnostics GmbH, Greifswald - Centrum für QualitätsMonitoring GmbH, Bentwisch - CHEPLAPHARM Arzneimit- tel GmbH, Mesekenhagen - ChromaTec GmbH, Greifswald - CONVENTIS AG, Rostock-Bentwisch - Cytocentrics AG, Rostock - DECODON GmbH, Greifswald - Dialyse Gemeinschaft Nord e.V., Rostock - DNA-Diagnostik Nord GmbH, Rostock - DOT GmbH, Rostock - DST - Diga- gnostische Systeme und Technologien GmbH, Schwerin - Dr. Ebel Fachkliniken GmbH u. Co., „Moorbad“ Bad Doberan KG, Bad Dobe- ran - Dr. Heydenreich GmbH, Greifswald - F.X. Mayr-Gesundheitszentrum, Ostseebad Baabe - Gesundheitszentrum Hotel MEERSINN GmbH, Binz/Rügen - Gutshaus Rederank, Rederank - Hanseklinikum Stralsund GmbH, Stralsund - HNP Mikrosysteme GmbH, Parchim - Hoffrichter GmbH, Schwerin - Hygiene Nord GmbH, Greifswald - Laborpraxis für Sport- und Leistungsdiagnostik Rostock, Rederank - Medical Biomaterial Products GmbH, Neustadt-Glewe - MEDIGREIF GmbH, Greifswald - Medizintechnik Rostock GmbH, Rostock - MI- CROMUN GmbH, Greifswald - Miltenyi -

2015 Annual Report
2015 ( in Figures Annual Report BioCon Valley® GmbH Long Version Table of Contents 2015 Top Events – within the Health Economy in the Federal State of Mecklenburg-Vorpommern » . 3 Economic Footprint – Health Economy Leaves its Traces in Mecklenburg-Vorpommern » . 5 BioCon Valley® GmbH – at a Glance » ............................................................. 7 Networks and Industry Monitoring » . 9 Projects – Turning Knowledge into Business » ...................................................... 12 New Markets – Internationalization » ............................................................. 15 Getting Publicity – Providing the right Forum » ..................................................... 17 BioCon Valley Mecklenburg-Vorpommern e.V. » ..................................................... 20 Register of Members – BioCon Valley Mecklenburg-Vorpommern e.V. » . 21 ( 2 ) 2015 Top Events within the Health Economy in the Federal State of Mecklenburg-Vorpommern 2015 was a year of minor and major premiere cooperation, the organizers for the first time facilitated events within the health economy. It has become a separate workshop for a partner country, which was obvious that the industry has left behind a positively received. significant economic footprint in the Federal State of Mecklenburg-Vorpommern (MV). Furthermore, the funding of new projects was successful. The EU project “Baltic Blue BioTech Alliance” This is evident from a BioCon Valley® GmbH initiative, with BioCon Valley® GmbH as a stakeholder has where a research study was conducted on behalf of been drafted to bring further development to marine the Ministry of Economic Affairs, Construction and biotechnology within the Baltic Sea region. Tourism MV. The survey, the first of its kind, provides The idea competition which was organized by the comprehensive and comparable statistics on all health Ministry of Economics, Construction and Tourism MV economy sectors and their effect on the economic in 2015 on the topic of health economy has become footprint within the entire region of MV. -
THE ÜBERSICHT Mdb (Stm) LANDWIRTSCHAFT Horst Seehofer Niels Annen Mdb (Stm) Prof
#THEUBERSICHT KABINETT UND PARL. STAATSSEKRETÄRE BUNDESKANZLERIN VERTEIDIGUNG ARBEIT UMWELT Dr. Angela Merkel MdB Dr. Ursula von der Leyen Hubertus Heil MdB Svenja Schulze MdB Kerstin Griese MdB Florian Pronold MdB KANZLERAMT Dr. Peter Tauber MdB Anette Kramme MdB Rita Schwarzelühr-Sutter Prof. Dr. Helge Braun MdB Thomas Silberhorn MdB MdB Dorothee Bär MdB (StM) AUSSEN INNEN, BAU U. HEIMAT Annette Widmann-Mauz ERNÄ HRUNG U. Heiko Maas MdB THE ÜBERSICHT MdB (StM) LANDWIRTSCHAFT Horst Seehofer Niels Annen MdB (StM) Prof. Monika Grütters Julia Klöckner Michael Roth MdB (StM) Dr. Günter Krings MdB MdB (StM) Michael Stübgen MdB Michelle Müntefering Stephan Mayer MdB Dr. Hendrik Hoppenstedt Hans-Joachim Fuchtel MdB MdB (StM) Marco Wanderwitz MdB MdB (StM) LEGISLATUR 2017 – 2021 BILDUNG U. JUSTIZ WIRTSCHAFTLICHE WIRTSCHAFT ZUSAMMENARBEIT FORSCHUNG Dr. Katarina Barley U. ENERGIE U. ENTWICKLUNG BUNDESREGIERUNG Anja Karliczek MdB MdB Peter Altmaier MdB Thomas Rachel MdB Christian Lange MdB Dr. Gerd Müller MdB Christian Hirte MdB Dr. Michael Meister MdB Rita Hagl-Kehl MdB Norbert Barthle MdB UND PARLAMENT Oliver Wittke MdB Dr. Maria Flachsbarth MdB Thomas Bareiß MdB FINANZEN FAMILIE VERKEHR U. DIGITALE Olaf Scholz Dr. Franziska Giff ey GESUNDHEIT INFRASTRUKTUR Bettina Hagedorn MdB Caren Marks MdB Jens Spahn MdB Christine Lambrecht MdB Stefan Zierke MdB Andreas Scheuer MdB Sabine Weiss MdB Steff en Bilger MdB Dr. Thomas Gebhart MdB Enak Ferlemann MdB BUNDESRAT BUNDESTAG Stimmenverteilung Stimmen im Bundesrat fraktionslos: 2 BADEN-WÜRTTEMBERG 66 MP Winfried Kretschmann 709 69 BAYERN 92 66 Linke MP Dr. Markus Söder AfD SITZE INSGESAMT BERLIN Mehrheit mit 44 Reg. BM Michael Müller 80 355 Stimmen BRANDENBURG 153 44 FDP MP Dr. -

German Security Measures and the Refugee Crisis 2012 - October 2016
German security measures and the refugee crisis 2012 - October 2016 Author: Katharina Koch Tutor: Dr. Ludwig Gelot Examiner: Dr. Heiko Fritz Semester: Fall 2016 Course code: 2FU32E Table of contents Abstract ...................................................................................................................................... 3 List of figures ............................................................................................................................. 4 List of abbreviations ................................................................................................................... 5 1. Introduction ............................................................................................................................ 6 1.1 Introduction and research problem ................................................................................... 6 1.2. Topic relevance ................................................................................................................ 7 1.3 Objective and research questions ..................................................................................... 7 1.4 Literature review ............................................................................................................... 8 1.5 Theoretical framework ..................................................................................................... 9 1.6 Methodological framework ............................................................................................ 10 1.7 Limitations -

Jahresbericht 2007
Gesund. Innovativ. Annual Report Jahresbericht 2 0 0 7 Firmen (Life Science) Aglycon Mycoton GmbH, Parchim AKG Reha-Zentrum GmbH & Co. KG, Graal-Müritz AQUAZOSTA GmbH, Schwerin arivis GmbH, Rostock Armin Baack Bedarf und Technik für Labor und Medizin, Schwerin ARTOSS GmbH, Rostock ASD Advanced Simulation & Design GmbH, Rostock Baltic Analytics GmbH, Greifswald BioArt Products GmbH, Rostock Bionas GmbH, Rostock BIOSERV Diagnostics GmbH, Greifswald BioTechnikum Greifswald GmbH, Greifswald BSM Bionic Solution Management GmbH, Greifswald CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH, Mesekenhagen ChromaTec GmbH, Greifswald CONVENTIS AG, Rostock-Bentwitsch Cytocentrics AG, Rostock DECODON GmbH, Greifswald Dialyse Gemeinschaft Nord e.V., Rostock DNA-Diagnostik Nord GmbH, Rostock DOT GmbH, Rostock Dr. Ebel Fachkliniken GmbH u. Co., „Moorbad“ Bad Doberan KG, Bad Doberan Dr. Heydenreich GmbH, Greifswald Ganomycin GmbH, Greifswald german carbon teterow GmbH, Teterow Gutshaus Rederank, Rederank HNP Mikrosysteme GmbH, Parchim Hoffrichter GmbH, Schwerin Hygiene Nord GmbH, Greifswald LZ Synapsis GmbH, Neubrandenburg F.X. Mayr-Gesundheitszentrum, Ostseebad Baabe Medical Biomaterial Pro- ducts GmbH, Neustadt-Glewe MEDIGREIF GmbH, Greifswald MICROMUN GmbH, Greifswald Miltenyi Biotec GmbH, Niederlassung Teterow Norddeutsche Pflanzenzucht, Hans-Georg Lembke KG, Malchow/Poel NETC GmbH, Rostock NORDUM Institut für Umwelt und Analytik GmbH & Co.KG, Kessin/b. Rostock Parsch Gebäudereinigung, Sanitz P+P MEDICAL GmbH, Schwerin Pflanzenzucht Dr. h.c. Carsten - Inh. Erhardt Eger -

Prof. Dr. Horst Klinkmann
CURRICULUM VITAE Professor Dr. med. Dr. h.c. (mult.) Horst Klinkmann, F.R.C.P. PERSÖNLICHE DATEN geboren 07. Mai 1935, in Teterow, Deutschland Verheiratet mit Frau Dr. Hannelore Klinkmann, Fachärztin für Orthopädie ein Sohn, Dipl. med. Jens Klinkmann AUSBILDUNG HOCHSCHULAUSBILDUNG: Studium der Medizin Universität Rostock, Deutschland 1954 - 1959 Promotion zum Dr. med. 1959 Habilitation 1969 BERUFSAUSBILDUNG: Universität Rostock, Deutschland Universität Budapest, Ungarn Universität Lund, Schweden Strathclyde University, Glasgow, U.K. BERUFSABSCHLÜSSE Facharzt für Innere Medizin 1966 Subspezialist für Nephrologie 1992 BERUFLICHER WERDEGANG GEGENWÄRTIGE POSITIONEN: Berater und Botschafter - Gesundheitswirtschaft - (01.01.2018) Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern Dekan und Ordentlicher Professor International Faculty for Artificial Organs (INFA) Bologna, Italien Direktor ehrenhalber und Professor h.c. SCE Institute for Bioactive Material Nankai University Tianjin, VR China Vizepräsident, ScanBalt Akademie, Kopenhagen Aufsichtsratsvorsitzender Festspiele Mecklenburg - Vorpommern Vorsitzender, Kuratorium Stiftung Freunde der Leibniz - Societät Ehrenpräsident des Kuratorium Gesundheitswirtschaft des Landes Mecklenburg-Vorpommern 1 / 6 FRÜHERE POSITIONEN: Research Professor University of Utah, USA 1964 - 1971 (AUSWAHL) Direktor und Ordentlicher Professor, Klinik für Innere Medizin, Universität Rostock, Deutschland 1974 - 1993 Präsident, Rat für Medizinische Wissenschaften, DDR 1982 - 1990 Vize-Präsident, Forschungsrat der DDR 1990 - 1991 Präsident, -

BSPC in a Nutshell –
Baltic Sea Parliamentary Conference Landtag The 24th Baltic Sea Parliamentary Conference 30th August - 1st September 2015 in Rostock, Germany – BSPC in a Nutshell – Baltic Sea Region – A Role Model for Innovation in Social- and Healthcare The 24th Baltic Sea Parliamentary bour and city tour as well as a recep- „Accordion meets string quartet” per- Conference took place in Ros- tion at the town hall provided the par- formance in the Boat House. tock-Warnemünde. Around 180 de- ticipants with insight into the cultural legates met in the Yachting & Spa Re- wealth and architecture characteristics On Tuesday, 1st September, Ms Sylvia sort, Hohe Düne, right on the edge of of this part of Germany. A reception Bretschneider, BSPC Chair and Presi- the Baltic Sea. The aim of the confer- hosted by Mr Erwin Sellering, Prime dent of the Landtag Mecklen- ence was to pass a resolution on the Minister of Mecklenburg-Vorpom- burg-Vorpommern, gave a commem- Baltic Sea Region as a role model for mern, closed the first day. orative address on the beginning of innovation in social and healthcare. the 2nd World War. Ms Manuela On Monday, three sessions took place Schwesig, Federal Minister for Fami- The participants arrived on Saturday that focused on cooperation in the lies, Senior Citizens, Women and and the BSPC Drafting Committee Baltic Sea Region, on cross-border co- Youth, held a keynote speech to open and the BSPC Standing Committee operation in healthcare and on health the fourth session and this was fol- held their first sessions on Sunday, and economy. In the evening, a prize- lowed by a roundtable discussion. -
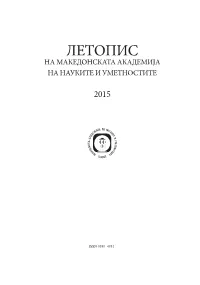
Letopis 2015 Летопис На Македонската Академија На Науките И Уметностите
LETOPIS 2015 ЛЕТОПИС НА МАКЕДОНСКАТА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ 2015 ISSN 0589–4981 2 LETOPIS NA MAKEDONSKATA AKADEMIJA NA NAUKITE I UMETNOSTITE 2015 SKOPJE 2016 3 Ureduva~ki odbor: akad. Леонид Грчев, pretsedatel доп. член. Марјан Марковиќ Lidija Simovska 4 MAKEDONSKA AKADEMIJA NA NAUKITE I UMETNOSTITE PRETSEDATELSTVO akad. Vlado Kambovski pretsedatel akad. Qup~o Kocarev potpretsedatel akad. Vlado Matevski sekretar akad. Bla`e Ristovski sekretar na Oddelenieto za lingvistika i literaturna nauka akad. Goce Petreski sekretar na Oddelenieto za op{testveni nauki akad. Vladimir Serafimoski sekretar na Oddelenieto za medicinski nauki akad. Tome Bo{evski sekretar na Oddelenieto za tehni~ki nauki (do 31.10.2016) akad. Gligor Jovanovski sekretar na Oddelenieto za prirodno-matemati~ki i biotehni~ki nauki akad. Luan Starova sekretar na Oddelenieto za umetnost akad. Milan \ur~inov izbran ~len na Pretsedatelstvoto akad. Vlada Uro{evi} izbran ~len na Pretsedatelstvoto IZVR[EN ODBOR NA PRETSEDATELSTVOTO Izvr{niot odbor go so~inuvaat pretsedatelot, potpretsedatelot i sekretarot 5 SEKRETARIJAT I STRU^NI SLU@BI NA AKADEMIJATA Lidija Simovska, sekretar na Sekretarijatot Sowa Todorovska, rakovoditel na Sektorot za pravni, stru~no-administrativni i op{ti raboti Nada Georgieva, rakovoditel na Bibliotekata Qubomir \orevski, rakovoditel na Arhivot Zorka Panovska, rakovoditel na Sektorot za finansiski pra{awa Nada Хaxi-Nikolova, rakovoditel na Oddelot za nau~ni i umetni~ki proekti, za nau~ni sobiri i za me|unarodna sorabotka Violeta Jovanovska, rakovoditel na Oddelot za izdava~ka dejnost (do 30 juni 2015 godina) Aleksandar Stojanovski, {ef na Oddelot za bezbednost i tehni~ka organizacija Qubica Mincikovska, administrativen sekretar na Pretsedatelstvoto 6 S O D R @ I N A I.