Leseprobe Angela Merkel
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Angela Merkel
ANGELA MERKEL The Chancellor and Her World Stefan Kornelius Translated by Anthea Bell and Christopher Moncrieff ALMA BOOKS ALMA BOOKS LTD London House 243–253 Lower Mortlake Road Richmond Surrey Tw9 2LL United Kingdom www.almabooks.com First published in German by Hoffmann und Campe Verlag in 2013 This translation, based on a revised German text including the additional chapter ‘The British Problem’, first published by Alma Books Limited in 2013 Copyright © 2013 by Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg Translation © Anthea Bell and Christopher Moncrieff, 2013 Front-cover image © Armin Linnartz The translation of this work was supported by a grant from the Goethe- Institut which is funded by the German Ministry of Foreign Affairs. Stefan Kornelius asserts his moral right to be identified as the author of this work in accordance with the Copyright, Designs and Patents Act 1988 Printed and bound by CPI Group (UK) Ltd, Croydon, CR0 4YY ISBN (hArdbacK): 978-1-84688-307-1 ISBN (expOrT eDITION): 978-1-84688-309-5 ISBN (eBOOK): 978-1-84688-308-8 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in or introduced into a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise), without the prior written permission of the publisher. This book is sold subject to the condition that it shall not be resold, lent, hired out or otherwise circulated without the express prior consent of the publisher. cONTeNTS Merkelmania The Chancellor’s New Power 3 Another World A -

Wolfgang Thierse – Günter Nooke – Florian Mausbach – Günter Jeschonnek
Wolfgang Thierse – Günter Nooke – Florian Mausbach – Günter Jeschonnek Berlin, im November 2016 An die Mitglieder des Kultur- und Medienausschusses des Deutschen Bundestags Mitglieder des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages Sehr geehrter Herr/Frau N.N., der Deutsche Bundestag hat am 9. November 2007 beschlossen, ein Freiheits- und Einheitsdenkmal zu errichten und entschied 2008 in einem weiteren Beschluss die Schlossfreiheit als seinen Standort. Es soll an die friedliche Revolution von 1989 und die Wiedergewinnung der staatlichen Einheit erinnern. 2011 ging aus zwei internationalen Wettbewerben mit 920 Einreichungen der Entwurf „Bürger in Bewegung“ als Sieger hervor. Überraschend hatte der Haushaltsausschuss am 13. April 2016 die Bundesregierung aufgefordert, das mittlerweile TÜV-zertifizierte und baureife Freiheits- und Einheitsdenkmals an historischer Stelle vor dem Berliner Schloss „nicht weiter zu verfolgen“. Begründet hat er diesen in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Beschluss mit einer angeblichen „Kostenexplosion“. Diese Entscheidung kam ohne vorherige öffentliche Diskussion zustande: Weder wirkte der dafür fachlich zuständige Kulturausschuss mit, noch hatte sich das Plenum des Deutschen Bundestages damit erneut befasst. Nach öffentlichen Interventionen von verschiedener Seite stellte Bundestagspräsident Lammert am 29. September 2016 im Ältestenrat fest, dass der Beschluss eines Ausschusses keinen Plenarbeschluss aufheben kann und hat die Fraktionen aufgefordert, sich Gedanken über das weitere Vorgehen zu machen. -
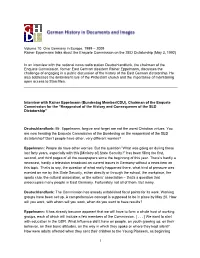
Interview with Rainer Eppelmann (MP/CDU), Chairman of the Enquete
Volume 10. One Germany in Europe, 1989 – 2009 Rainer Eppelmann talks about the Enquete Commission on the SED Dictatorship (May 3, 1992) In an interview with the national news radio station Deutschlandfunk, the chairman of the Enquete Commission, former East German dissident Rainer Eppelmann, discusses the challenge of engaging in a public discussion of the history of the East German dictatorship. He also addresses the ambivalent role of the Protestant church and the importance of maintaining open access to Stasi files. Interview with Rainer Eppelmann (Bundestag Member/CDU), Chairman of the Enquete Commission for the “Reappraisal of the History and Consequenes of the SED Dictatorship” Deutschlandfunk: Mr. Eppelmann, forgive and forget are not the worst Christian virtues. You are now heading the Enquete Commission of the Bundestag on the reappraisal of the SED dictatorship? Don‟t people have other, very different worries? Eppelmann: People do have other worries. But the question “What was going on during these last forty years, especially with this [Ministry of] State Security?” has been filling the first, second, and third pages of all the newspapers since the beginning of this year. There‟s hardly a newscast, hardly a television broadcast on current issues in Germany without a news item on this topic. That‟s to say, the question of what really happened there, what kind of pressure was exerted on me by this State Security, either directly or through the school, the workplace, the sports club, the cultural association, or the writers‟ association – that‟s a question that preoccupies many people in East Germany. Fortunately not all of them. -

Germany, International Justice and the 20Th Century
Paul Betts Dept .of History University of Sussex NOT TO BE QUOTED WITHOUT PERMISSION OF THE AUTHOR: DRAFT VERSION: THE FINAL DRAFT OF THIS ESSAY WILL APPEAR IN A SPECIAL ISSUE OF HISTORY AND MEMORY IN APRIL, 2005, ED. ALON CONFINO Germany, International Justice and the 20th Century The turning of the millennium has predictably spurred fresh interest in reinterpreting the 20th century as a whole. Recent years have witnessed a bountiful crop of academic surveys, mass market picture books and television programs devoted to recalling the deeds and misdeeds of the last one hundred years. It then comes as no surprise that Germany often figures prominently in these new accounts. If nothing else, its responsibility for World War I, World War II and the Holocaust assures its villainous presence in most every retrospective on offer. That Germany alone experienced all of the modern forms of government in one compressed century – from constitutional monarchy, democratic socialism, fascism, Western liberalism to Soviet-style communism -- has also made it a favorite object lesson about the so-called Age of Extremes. Moreover, the enduring international influence of Weimar culture, feminism and the women’s movement, social democracy, post-1945 economic recovery, West German liberalism, environmental politics and most recently pacifism have also occasioned serious reconsideration of the contemporary relevance of the 20th century German past. Little wonder that several commentators have gone so far as to christen the “short twentieth century” between 1914 and 1989 as really the “German century,” to the extent that German history is commonly held as emblematic of Europe’s 20th century more generally.1 Acknowledging Germany’s central role in 20th century life has hardly made things easy for historians, however. -

Merkels Stasi Umfeld Von Rolf Ehlers
Merkels Stasi Umfeld von Rolf Ehlers Wenn wir beurteilen wollen, was wir von einem Menschen erwarten können, fragen wir immer erst danach, wo er denn hekommt. Wir suchen uns ein Bild von ihm zu machen, indem wir ergründen, in welchem Umfeld jemand in der Vergangenheit gelebt hat, was seine Freunde und Verwandten waren und welches ihre Überzeugungen waren und sind. Das nicht zu tun, hieße blauäugig zu sein… Wir deutschen Wähler werden aber seit Jahren darüber im Dunkeln gelassen, aus welchem Umfeld denn unsere Kanzlerin kommt. Keine der maßgebenden Zeitungen hat darüber mehr als oberflächlich berichtet, bis jetzt das Schweizmagazin am 29.5.2008 titelte: “Deutsche Kanzlerin Merkel ein Stasi-Spitzel?” In der Talk-Show von Anne Will wies Oskar Lafontaine, der sich heftigen Angriffen wegen seiner Zusammenarbeit mit Gegor Gysi als angeblichem Zuträger der Stasi ausgesetzt sah, darauf hin, dass es die Kanzlerin Merkel selbst sei, die eine Aktivistin des DDR-Systems gewesen sei. Informationen, die in den Archiven vergraben waren und die nach der Wende in der großen Vernichtungsaktion nicht untergegangen waren, sind Vielen schon seit Jahren bekannt. Ihre Veröffentlichung ist aber nicht opportun. Offenbar gefällt es maßgebenden Leuten in den Redaktionen und Verlagen oder denen, die Macht über sie haben, Frau Merkel vor allen Angriffen zu schützen. Ob diese Leute selbst wissen, über wen sie da die Hand halten? Die Verflechtung mit dem DDR-Regime von Angela Dorothea Kasner, die mit ihrer ersten Ehe den Namen Merkel annahm und ihn nach Eingehung der zweiten Ehe behielt, hängt eng mit ihrem familiären Umfeld und ihren persönlichen und politischen Freunden zusammen, die fast ohne Ausnahme mit der Stasi verbandelt waren. -

Erfahrungen Erinnerungen Gedanken
Hanfried Müller Erfahrungen Erinnerungen Gedanken Zur Geschichte von Kirche und Gesellschaft in Deutschland seit 1945 GNN Verlag ISBN 978-3-89819-314-6 © 2010 by GNN Gesellschaft für Nachrichtenerfassung und Nachrichtenverbrei- tung, Verlagsgesellschaft für Sachsen/Berlin mbH, Badeweg 1, D- 04435 Schkeuditz Alle Rechte vorbehalten Gesamtherstellung: GNN Schkeuditz 4 Noch kurz vor seinem Tode am 3. März 2009 war Hanfried Müller mit sei- ner »Autobiographie« befaßt, in der ein Kapitel deutscher Geschichte und Kirchengeschichte festgehalten werden sollte. Nicht um seine Person ging es ihm also und schon gar nicht um private Befindlichkeit, wohl aber um eine Geschichtsschreibung, die gesellschaftliche und kirchenpolitische Verhältnisse und Entwicklungen im Fokus persönlicher Erfahrungen und Erinnerungen widerspiegelt. Seine Aufzeichnungen sind ein Torso geblieben. Dennoch enthält bereits der publizierbare Text eine solche Fülle an grundsätzlicher historischer Einsicht und politischer Erkenntnis, daß seine Lektüre weit über den Blickwinkel subjektiver Wertungen hinausträgt. Von Hanfried Müller war, selbstredend, keine Retrospektive zu erwarten, der sich bürgerliches Herrschaftsbewußtsein und schon gar nicht deutsche Kleinbürgerlichkeit akkommodieren könnten. Schließlich verstieß er als Sohn aus »guter Gesellschaft« gegen die ehernen Prinzipien dieser Gesell- schaft; und schon zu seinen Lebzeiten ist ihm sein Klassenverrat niemals verziehen worden. Seine »Erinnerungen« zeichnen nach, warum und wie er und seine Frau Rosemarie Müller-Streisand einen Weg gegangen sind, der - ebenso außer- gewöhnlich wie konsequent - mitten in den Klassenkampf des Kalten Krieges führte, mithin also auch in die Auseinandersetzung mit einem Kir- chenverständnis, dem weitgehend die Signaturen einer konservativen Partei eigneten und das schon deshalb Müllers reformatorische Theologie als Zumutung und Provokation empfinden mußte. Die Aufzeichnungen enden 1973. Die bereits detailliert konzipierten Kapi- tel V. -

Parish Directory
The Beacon “I AM THE LIGHT OF THE WORLD + WHOEVER FOLLOWS ME WILL + NEVER WALK IN DARKNESS BUT WILL HAVE THE LIGHT OF LIFE” (NRSV) BETHANY LUTHERAN CHURCH • HICKORY, NC AUGUST + 2018 Dear brothers and sisters in Christ: There are three things I would like to address as part of my letter this month. The first is a quick update on the windows in the Narthex. The second matter has to do with the ongoing work of our ad hoc Long-term Planning Committee. I will address in that portion of this letter a way in which all of us can begin to contemplate ways of facilitating, supporting, and enabling both the ongoing and future ministries of Bethany Congregation and other ministries and organizations about which we are passionate. Finally, as we prepare to observe the Sunday of the Recognition of the Ministries of Women on Sunday, August 5, I want to share the story of a woman who has lived out her Baptismal faith in a profound way. Therefore, I want to share the story of a woman who serves to remind us that we are all called in the waters of Baptism, but our areas of service are different. In preparation for that Sunday of the Recognition of the Ministries of Women on Sunday August 5, the 11th Sunday After Pentecost, we can all look forward to hearing from our guest preacher for that Sunday who will be Deacon Susan Jackson. Deacon Jackson has just accepted a new call to serve St. Paul's Lutheran Church, Wilmington, NC as the Youth and Family Coordinator. -

German Post-Socialist Memory Culture
8 HERITAGE AND MEMORY STUDIES Bouma German Post-Socialist MemoryGerman Culture Post-Socialist Amieke Bouma German Post-Socialist Memory Culture Epistemic Nostalgia FOR PRIVATE AND NON-COMMERCIAL USE AMSTERDAM UNIVERSITY PRESS German Post-Socialist Memory Culture FOR PRIVATE AND NON-COMMERCIAL USE AMSTERDAM UNIVERSITY PRESS Heritage and Memory Studies This ground-breaking series examines the dynamics of heritage and memory from a transnational, interdisciplinary and integrated approaches. Monographs or edited volumes critically interrogate the politics of heritage and dynamics of memory, as well as the theoretical implications of landscapes and mass violence, nationalism and ethnicity, heritage preservation and conservation, archaeology and (dark) tourism, diaspora and postcolonial memory, the power of aesthetics and the art of absence and forgetting, mourning and performative re-enactments in the present. Series Editors Ihab Saloul and Rob van der Laarse, University of Amsterdam, The Netherlands Editorial Board Patrizia Violi, University of Bologna, Italy Britt Baillie, Cambridge University, UK Michael Rothberg, University of Illinois, USA Marianne Hirsch, Columbia University, USA Frank van Vree, NIOD and University of Amsterdam, The Netherlands FOR PRIVATE AND NON-COMMERCIAL USE AMSTERDAM UNIVERSITY PRESS German Post-Socialist Memory Culture Epistemic Nostalgia Amieke Bouma Amsterdam University Press FOR PRIVATE AND NON-COMMERCIAL USE AMSTERDAM UNIVERSITY PRESS Cover illustration: Kalter Abbruch Source: Bernd Kröger, Adobe Stock Cover -

Television and the Cold War in the German Democratic Republic
0/-*/&4637&: *ODPMMBCPSBUJPOXJUI6OHMVFJU XFIBWFTFUVQBTVSWFZ POMZUFORVFTUJPOT UP MFBSONPSFBCPVUIPXPQFOBDDFTTFCPPLTBSFEJTDPWFSFEBOEVTFE 8FSFBMMZWBMVFZPVSQBSUJDJQBUJPOQMFBTFUBLFQBSU $-*$,)&3& "OFMFDUSPOJDWFSTJPOPGUIJTCPPLJTGSFFMZBWBJMBCMF UIBOLTUP UIFTVQQPSUPGMJCSBSJFTXPSLJOHXJUI,OPXMFEHF6OMBUDIFE ,6JTBDPMMBCPSBUJWFJOJUJBUJWFEFTJHOFEUPNBLFIJHIRVBMJUZ CPPLT0QFO"DDFTTGPSUIFQVCMJDHPPE Revised Pages Envisioning Socialism Revised Pages Revised Pages Envisioning Socialism Television and the Cold War in the German Democratic Republic Heather L. Gumbert The University of Michigan Press Ann Arbor Revised Pages Copyright © by Heather L. Gumbert 2014 All rights reserved This book may not be reproduced, in whole or in part, including illustrations, in any form (be- yond that copying permitted by Sections 107 and 108 of the U.S. Copyright Law and except by reviewers for the public press), without written permission from the publisher. Published in the United States of America by The University of Michigan Press Manufactured in the United States of America c Printed on acid- free paper 2017 2016 2015 2014 5 4 3 2 A CIP catalog record for this book is available from the British Library. ISBN 978– 0- 472– 11919– 6 (cloth : alk. paper) ISBN 978– 0- 472– 12002– 4 (e- book) Revised Pages For my parents Revised Pages Revised Pages Contents Acknowledgments ix Abbreviations xi Introduction 1 1 Cold War Signals: Television Technology in the GDR 14 2 Inventing Television Programming in the GDR 36 3 The Revolution Wasn’t Televised: Political Discipline Confronts Live Television in 1956 60 4 Mediating the Berlin Wall: Television in August 1961 81 5 Coercion and Consent in Television Broadcasting: The Consequences of August 1961 105 6 Reaching Consensus on Television 135 Conclusion 158 Notes 165 Bibliography 217 Index 231 Revised Pages Revised Pages Acknowledgments This work is the product of more years than I would like to admit. -

Amy Winehouse a Very English Man in Japan
Issue No. 10 THE COUNTRY GIRL MEGAN MCKENNA JAMES COSMO NICK FERRARI GAME OF THRONES FLASH IN THE PAN JOHNNY ACTON ANGELA MERKEL A VERY ENGLISH MAN WHO’S THAT GIRL? IN JAPAN MITCH WINEHOUSE AMY WINEHOUSE £4.95 $7.40 €6.70 ¥880 Being unique is the ultimate competitive advantage. The Panamera Sport Turismo. The Panamera has always set the benchmark. As a Sport Turismo it is now in a class of its own. With powerful engines delivering up to 550 hp and a design that sets new standards, it’s a car created for those who forge their own path. Discover more at www.porsche.co.uk Porsche recommends and Fuel consumption for Panamera Turbo Sport Turismo: Urban in l/100 km (mpg) 13.1 – 12.9 (21.6 – 21.9); Extra-urban in l/100 km (mpg) 7.4 – 7.3 (38.2 – 38.7); Combined in l/100 km (mpg) 9.5 – 9.4 (29.7 – 30.1); CO2 emissions in g/km 217 – 215. 14047 Panamera ST DPS 297x420mm_NCI_PCGB.indd 1 14/09/2017 16:01 ZENITH, THE FUTURE OF SWISS WATCHMAKING DEFY I El Primero 21 1/100th of a second chronograph www.zenith-watches.com Zenith_HQ • Visual: U29_DE1 • Magazine: Boisdale_ (UK) • Language: English • Issue: 24/08/2017 • Doc size: 420 x 297 mm • Calitho #: 08-17-124052 • AOS #: ZEN_13833 • TS 25/08/2017 Autumn 2017 BOISDALELIFE.COM Issue no.10 EDITOR’S LETTER THE RETURN OF THE RAT PACK TO BOISDALE ay I offer you a warm welcome to the 10th edition of Boisdale Life Magazine. -

Rainer Eppelmann
CURRICULUM VITAE Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. Stand: Februar 2009 www.kas.de Rainer Eppelmann www.kas.de/rednertour2009 DEUTSCHER EV. THEOLOGE UND POLITIKER, BUNDESVORSITZENDER DER CDA (1994 – 2001), CDU Herkunft Rainer Eppelmann wurde am 12. Febr. 1943 in Berlin als Sohn eines Zimmermanns und ei- ner Schneiderin geboren. Sein Vater blieb nach dem Bau der Berliner Mauer 1961 im Wes- ten. Ausbildung Bis 1961 besuchte EPPELMANN, der im Ostteil der Stadt wohnte, die Oberschule in West- Berlin. Weil der Vater im Westen war, konnte er das geplante Architekturstudium nicht rea- lisieren. Er musste sich zunächst als Dachdeckerhilfsarbeiter "bewähren", erlernte dann den Beruf des Maurers, den er anschließend einige Jahre ausübte. EPPELMANN verweigerte 1966 den Wehrdienst und auch das als "Bausoldat" geforderte Gelöbnis und kam dafür acht Mo- nate ins Gefängnis. Im Alter von 26 Jahren begann EPPELMANN ein Studium der evangeli- schen Theologie, das er 1974 an der Berliner Theologischen Fachhochschule Paulinum ab- schloss. Wirken 1974 wurde EPPELMANN Pfarrer an der Berliner Samariterkirche und war über sieben Jahre lang Kreisjugendpfarrer für den Kirchenkreis Berlin-Friedrichshain. Er galt dem SED-Regime als unbequemer Prediger, der sich nicht auf seelsorgerische und karitative Aufgaben be- schränken ließ. EPPELMANN war Initiator des "Berliner Appells" ("Frieden schaffen ohne Waffen"), der sich gegen die SED-Parole stellte: "Der Friede muss bewaffnet sein." Da er auch bei weiteren Protestaktionen aktiv war, zog sich EPPELMANN die Aufmerksamkeit des Staatssicherheitsdienstes ("Stasi") zu, was bis zu lebensbedrohenden Maßnahmen (z. B. in- szenierter "Verkehrsunfall") reichte. Zusammen mit anderen Dissidenten gründete EPPELMANN Anfang Okt. 1989 den Demokra- tischen Aufbruch (DA), wenige Wochen vor der Öffnung der osteuropäischen Grenzen und dem Ende des SED-Regimes. -

Kirche in Der DDR
Kirche in der DDR Das Pfarrhaus in der DDR befand sich in einem »politisch-ideologischen Hochspannungsfeld«, wie Lothar de Maiziere einmal schrieb. Denn sein Selbstverständnis entstand aus der erzwungenen Defensive, aus dem Widerständigen seiner bloßen Existenz. Ob es wollte oder nicht, das Pfarrhaus bildete die Enklave einer Gegenkultur im atheistischen DDR-Staat. Es wurde, so Pfarrer Wilhelm Schlemmer, zum »Lebensraum zwischen Barrikaden«. Schon der Glaube an sich war ein Politikum, als Gegenentwurf zum Marxismus- Leninismus. Das materialistische Menschenbild bedurfte keiner Transzendenz. Heilserwartungen waren mit Marx als »Opium des Volkes« denunziert, der christliche Glaube erschien als Illusion, wenn nicht als reaktionäre Bewegung. Das Christentum predigte Nächstenliebe, sein Pendant und Ersatz wurde der politische Begriff der Solidarität. Berührungspunkte zwischen Sozialismus und Kirche wären durchaus vorhanden gewesen. Seit Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts gab es evangelische Bewegungen, die eine christliche Sozialethik mit politischer Stoßrichtung forcierten. Die Schweizer Theologen Hermann Kutter und Leonhard Ragaz hatten 1906 für einen religiösen Sozialismus plädiert, für ein »ganzes Christentum, das dessen sozialen Sinn ins Licht stellt«. Auch die evangelische Kirchenpartei Bund religiöser Sozialisten, 1926 gegründet, diskutierte eine Sozialutopie, die sich als Reich Gottes auf Erden in einer sozialistischen Gesellschaft erfüllen könnte. Der reformierte Schweizer Theologe Karl Barth, einer der Mitbegründer der Bekennenden