Zu Den Inschriften Des Apollo Grannus
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Appendix 1 Damona
Appendix 1 Damona Gallia Belgica Inscriptions 1. Bourbonne-les-Bains Deo Apol|lini Boruoni | et Damonae. | C(aius) Daminius | Ferox, ciuis | Lingonus, ex | uoto. « To the god Apollo Boruo and to Damona. Caius Daminius Ferox, Lingo citizen, after a vow. » Ivory marble stele, damaged on the bottom left side. Height: 15.7 cm, width: 12.6 cm. CIL XIII, 5911 = ILing 200 = D 4656 According to ILing, this text proves that Boruo is assimilated to Apollo. For the nomen Daminius: Schulze 1966: 240 and Solin-Salomies 1994: 66. For the Latin cognomen, Ferox: Kajanto 1965: 267 and Solin-Salomies 1994: 331. The dedicant had the tria nomina of a Roman citizen and at the same time, he said that he was a lingo citizen. According to ILing, that double citizenship was nothing but normal. Date: c. 2nd century AD. 2. Bourbonne-les-Bains Boruoni et [Da]|monae. C(aius) Ia[…]|[…]nius Ro|manus, (L)in|g(onus), pro salu|te Cocillae | fil(iae), ex uoto. « To Boruo and to Damona. Caius Ia…nius Romanus, Lingo, (made this monument) for his daughter Cocilla’s sake, after a vow.» Grey oolithic limestone stele. Height: 38 cm, width at the bottom: 50 cm, depth: 13 cm. CIL XIII, 5916 = ILing 203 According to ILing, a hesitation is possible between Iatinus and Latinus for the nomina. For these nomina: Schulze 1966: 176 et 522, and Solin-Salomies 1994: p. 95 and 102. The father Romanus had a Latin cognomen: Kajanto 1965: p. 182 and Solin-Salomies 1994: 392. Cocilla, the daughter, had a cognomen that could be Latin or Celtic. -

Nameless Or Nehallenia
Archaeologia Cantiana Vol. 70 1956 NAMELESS OR NEHALENNIA By FRANK JENKINS, F.S.A. A SMALL clay figurine found some years ago at Canterbury has for a long time provided an enigma in the identity of the personage which it represents.1 Although the head is missing it is otherwise complete and depicts a matron seated on a throne or high-backed chair, holding a small dog in her arms. The type is well known in north-east Gaul, where numerous examples have been found. These figurines were mass-produced in moulds, two of which have come to light at Bertrich near Trier,2 and it is from that region probably that the Canterbury example came, either as an object of trade or as a personal possession. That figurines of this type had some religious significance is clear from their frequent occurrence on the sites of temples, particularly at Trier3 and in the surrounding countryside.4 For instance, in the temple-area at Trier a number of these figurines were found together by a small shrine, before the door of which stood a stone statue of a seated matron who holds a basket of fruits upon her lap and has a dog seated at her side.5 The presence of the same type of figurine in Roman graves further suggests that it served some ritual purpose.6 Curiously enough in spite of all this abundant material the name of the goddess has in no case been revealed. It is this lacuna in our knowledge that has stimu- lated the writer to search for any evidence which might shed light on the matron's identity. -

Celtic Mythology Ebook
CELTIC MYTHOLOGY PDF, EPUB, EBOOK John Arnott MacCulloch | 288 pages | 16 Nov 2004 | Dover Publications Inc. | 9780486436562 | English | New York, United States Celtic Mythology PDF Book It's amazing the similarities. In has even influenced a number of movies, video games, and modern stories such as the Lord of the Rings saga by J. Accept Read More. Please do not copy anything without permission. Vocational Training. Thus the Celtic goddess, often portrayed as a beautiful and mature woman, was associated with nature and the spiritual essence of nature, while also representing the contrasting yet cyclic aspects of prosperity, wisdom, death, and regeneration. Yours divine voice Whispers the poetry of magic that flow through the wind, Like sweet-tasting water of the Boyne. Some of the essential female deities are Morrigan , Badb , and Nemain the three war goddess who appeared as ravens during battles. The Gods told us to do it. Thus over time, Belenus was also associated with the healing and regenerative aspects of Apollo , with healing shrines dedicated to the dual entities found across western Europe, including the one at Sainte-Sabine in Burgundy and even others as far away as Inveresk in Scotland. In most ancient mythical narratives, we rarely come across divine entities that are solely associated with language. Most of the records were taken around the 11 th century. In any case, Aengus turned out to be a lively man with a charming if somewhat whimsical character who always had four birds hovering and chirping around his head. They were a pagan people, who did not believe in written language. -

Goddesses As Consorts of the Healing Gods in Gallia Belgica and the Germaniae: Forms of Cult and Ritual Practices
Article How to Cite: Ferlut, A 2016 Goddesses as Consorts of the Healing Gods in Gallia Belgica and the Germaniae: Forms of Cult and Ritual Practices. Open Library of Humanities, 2(1): e5, pp. 1–26, DOI: http://dx.doi.org/10.16995/ olh.43 Published: 29 February 2016 Peer Review: This article has been peer reviewed through the double-blind process of Open Library of Humanities, which is a journal published by the Open Library of Humanities. Copyright: © 2016 The Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0), which permits unrestricted use, distri- bution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. See http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/. Open Access: Open Library of Humanities is a peer-reviewed open access journal. Digital Preservation: The Open Library of Humanities and all its journals are digitally preserved in the CLOCKSS scholarly archive service. Audrey Ferlut, ‘Goddesses as Consorts of the Healing Gods in Gallia Belgica and the Germaniae: Forms of Cult and Ritual Practices’ (2016) 2(1): e5 Open Library of Humanities, DOI: http://dx.doi. org/10.16995/olh.43 ARTICLE Goddesses as Consorts of the Healing Gods in Gallia Belgica and the Germaniae: Forms of Cult and Ritual Practices Audrey Ferlut1 1 Enseignant Chercheur Associé, UMR 5189 Hisoma-Lyon, FR [email protected] Healing gods have traditionally been analysed on their own within their sanctuaries. Moreover, few scholars have paid attention to their feminine consorts in the western part of the Roman Empire, and even fewer have studied the Northern provinces, such as Gallia Belgica and the Germaniae. -

Ancient Celtic Goddesses Author(S): E
Ancient Celtic Goddesses Author(s): E. Anwyl Source: The Celtic Review, Vol. 3, No. 9 (Jul., 1906), pp. 26-51 Published by: Stable URL: http://www.jstor.org/stable/30069895 Accessed: 23-11-2015 23:24 UTC Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at http://www.jstor.org/page/ info/about/policies/terms.jsp JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. http://www.jstor.org This content downloaded from 128.122.230.148 on Mon, 23 Nov 2015 23:24:25 UTC All use subject to JSTOR Terms and Conditions 26 THE CELTIC REVIEW ANCIENT CELTIC GODDESSES Professor E. ANWYL THE extant remains of the Celtic forms of religion afford abundant testimony to the great variety of divine names which were associated therewith. No student of Celtic religion can fail to be impressed with the number of Celtic deities, who appear to have been local or tribal in character. Even where a certain deity appears to have become non-local, it will generally be found on investigation that the sphere of the extended worship has fairly well-defined areas and centres. We cannot take as our first guide for the classification and grouping of Celtic gods a Pantheon like that of Homer, behind which there is a long history of religious development, and upon which there is the impress of a literary tradition. -

Test Abonnement
L E X I C O N O F T H E W O R L D O F T H E C E L T I C G O D S Composed by: Dewaele Sunniva Translation: Dewaele Sunniva and Van den Broecke Nadine A Abandinus: British water god, but locally till Godmanchester in Cambridgeshire. Abarta: Irish god, member of the de Tuatha De Danann (‘people of Danu’). Abelio, Abelionni, Abellio, Abello: Gallic god of the Garonne valley in South-western France, perhaps a god of the apple trees. Also known as the sun god on the Greek island Crete and the Pyrenees between France and Spain, associated with fertility of the apple trees. Abgatiacus: ‘he who owns the water’, There is only a statue of him in Neumagen in Germany. He must accompany the souls to the Underworld, perhaps a heeling god as well. Abhean: Irish god, harpist of the Tuatha De Danann (‘people of Danu’). Abianius: Gallic river god, probably of navigation and/or trade on the river. Abilus: Gallic god in France, worshiped at Ar-nay-de-luc in Côte d’Or (France) Abinius: Gallic river god or ‘the defence of god’. Abna, Abnoba, Avnova: goddess of the wood and river of the Black Wood and the surrounding territories in Germany, also a goddess of hunt. Abondia, Abunciada, Habonde, Habondia: British goddess of plenty and prosperity. Originally she is a Germanic earth goddess. Accasbel: a member of the first Irish invasion, the Partholans. Probably an early god of wine. Achall: Irish goddess of diligence and family love. -

The Asteroids Report For
The Asteroids Report for Oprah Winfrey January 29, 1954 7:50 PM Kosciusko, Mississippi Marcha Fox B.S. Physics, Dipl. IAA www.ValkyrieAstrology.com Introduction to the Asteroids Report Asteroids orbit around the Sun just as planets do, but they are generally smaller than planets, and some of their physical characteristics and orbital characteristics are different from those of planets. Some objects are classified as being dwarf planets, and these objects are more similar to planets than most asteroids but do not fully have the characteristics that are typical of a planet. Pluto was once regarded officially as a planet but has been reclassified as a dward planet, and the asteroid Ceres is now widely regarded as a dwarf planet. Of the hundreds of thousands of asteroids that orbit around our Sun, over 1,000 of them have been given names that are related to myths, legends, literary or historical figures of interest, or places. Some astrologers believe that asteroids have a significance and relevance to human life just as the planets do, and that the astrological significance of the asteroid is often related in some way to the name of the asteroid. In this report 1,425 asteroids are analyzed to see if they are conjunct in zodiac longitude the Sun, Moon, or planets in the birth chart within a 1 degree orb. If the conjunction occurs, information about the asteroid is provided. Those astrologers who include hundreds of asteroids in their interpretations believe that the asteroids often related to very specific events in your life. The names of close family and friends and situations that you encounter in life often reflect the nature of the asteroids that are conjunct planets in your chart. -

Luciano Golzi Saporiti. I Toponimi Del Seprio
LUCIANO GOLZI SAPORITI. I TOPONIMI DEL SEPRIO 0 LUCIANO GOLZI SAPORITI. I TOPONIMI DEL SEPRIO I TOPONIMI DEL SEPRIO INTRODUZIONE Le etimologie proposte per buona parte dei toponimi del Seprio e delle aree immediatamente adiacenti risultano spesso fantasiose, dubbie e contraddittorie: scopo di questo studio è di tentare di stabilirne l’origine e il significato reali. Ricordiamo, innanzitutto, che i nomi di luogo, quando furono attribuiti, avevano un significato preciso e comprensibile, quasi sempre legato ad una divinità, al nome di una persona o a qualche visibile caratteristica fisica del territorio. A seconda delle epoche e delle mode, cambiarono i criteri di denominazione, ma rimasero sempre “semplici” spesso ripetitivi, come oggi i vari Albergo Bellavista, Ristorante della Posta, Trattoria da Giovanni, Residence Lago Blu, Villa Francesca, Cascina Bianchi, Santa Maria di..., Podere del Roveto, Grand Hôtel Terme, Villaggio le Ginestre, eccetera. In un lungo periodo di colonizzazione agricola del territorio, risultarono sempre particolarmente popolari i toponimi “prediali”, indicanti cioè il nome del fondatore e primo proprietario dell’insediamento. Ben raramente le località furono “ribattezzate”, ma i loro nomi subirono radicali modifiche, legate alle variazioni progressive della lingua e della pronuncia; con il passare del tempo, l’origine dei toponimi fu dimenticata e il loro significato divenne incomprensibile. Facciamo degli esempi. Sabaudia, Carbonia e Latina [già Littoria] sono toponimi recenti; ne conosciamo sia il significato che l’origine: tra una generazione saranno dimenticati. Montechiaro, Villafranca, Castelnuovo, Roncaccio sono toponimi medievali ancora comprensibili: abbiamo però dimenticato perchè si chiamino così. Di Busto, Varese, Tradate e Abbiate non conosciamo il significato nè l’origine: possiamo solo ipotizzarli. -

Apollo Grannus: I Luoghi Di Culto Di Un Dio Solare
Traces in Time n. 9 – 2019 Incontri di Archeologia - Studenti Sapienza - I APOLLO GRANNUS: I LUOGHI DI CULTO DI UN DIO SOLARE AUTHOR Elena Roveda ABSTRACT Apollo Grannus, a healing and solarg god usually worshipped at healing sanctuaries near sacred springs since the first imperial age, was created as the religious assimilation of a celtic deity, Grannus, and a greco-roman god, Apollo Medicus, on the ground of common qualities and characteristics. Apollo Grannus is therefore a perfect example of the so-called interpretatio romana, i.e. the interpretation of the celtic pantheon from a roman point of view. In roman times the religious syncretism didn’t affect merely arts and religious iconography, but rather it is also clearly distinguishable in temple architecture and archaeological remains, as proved by the construction of gallo-roman temples. The worship of Apollo Grannus was uncommonly widespread, as compared to other celtic-roman gods, which were often connected to just one place or ethnic group. On the contrary, the presence of Apollo Grannus is witnessed by about fifty inscriptions and several religious buildings discovered in many roman provinces, from Britannia to Greece; nevertheless, the provinces where Apollo Grannus is better documented are Germania and Raetia, while a significant part of his worshippers came from the military class: undoubtedly, soldiers and governors played an essential role in spreading Apollo Grannus’ worship and rituals across the Roman Empire. _______________________________________________________________ INTRODUZIONE La documentazione archeologica ed epigrafica testimonia l’esistenza in età imperiale di una divinità largamente diffusa negli antichi territori celtici governati da Roma, nota con l’appellativo di Apollo Grannus, una divinità solare preposta alla guarigione, originaria delle province nord- occidentali dell’impero e venerata presso santuari delle acque o sorgenti sacre. -

Celtic Religion Across Space and Time
Celtic Religion across Space and Time J. Alberto Arenas-Esteban (ed.) IX Workshop F.E.R.C.AN FONTES EPIGRAPHICI RELIGIONVM CELTICARVM ANTIQVARVM JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA - 2010 FICHA CATALOGRÁFICA Workshop F.E.R.C.A.N. (9 ª.2010. Molina de Aragón) Celtic Religion across space and time : fontes epigraphici religionvm celticarvm antiqvarvm / J. Alberto Arenas-Esteban (ed) . – Molina de Aragón : CEMAT (Centro de Estudios de Molina y Alto Tajo) ; Toledo : Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Servicio del Libro, Exposiciones y Audiovisuales, 2010. 298 p. : il. ; 29 cm. – (Actas) ISBN: 978-84-7788-589-4 Depósito Legal: AB-328-2010 1. Antropología social 2. Historia Antigua 3. Arqueología 39 (364) : 94 902 (364) Con la colaboración de C.E.M.A.T. Queda rigurosamente prohibida la reproducción parcial o total de esta obra sin la autorización escrita de los titulares del copyright. © de los autores I.S.B.N.: 978-84-7788-589-4 Depósito Legal: AB-328-2010 FOTOGRAFÍA DE PORTADA: Altar de los Lugoves. (Cortesía del Museo Numantino, Soria) MAQUETACIÓN: M. Marco Blasco IMPRIME: Sonora Comunicación Integral, S.L. EDICIÓN: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y CULTURA DE CASTILLA-LA MANCHA Impreso en España - Printed in Spain Contents PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL. PRESENTATION. Jesús Alberto Arenas-Esteban. 1. EPIGRAPHY AND PHILOLOGY: METHODOLOGICAL REMARKS AND REGIONAL STUDIES. Patrizia de Bernardo Stempel Method in the analysis of Romano-Celtic theonymic materials: improved readings and etymological interpretations. 18 Patrizia de Bernardo Stempel & Manfred Hainzmann Sive in theonymic formulae as a means for introducing explications and identifications. 28 Bernard Rémy Corpus Fercan: les provinces romaines des Alpes occidentales (Alpes graies, cottiennes, maritimes, pœnines). -

Bababababababababababa
PART SEVEN THE DRUID MISCELLANY Introduction Most of the material in this section is of very little importance to most pre 1986 Carleton Druids (because of its heavy Celtic Pagan orientation), but I feel that it has great importance for understanding the later NRDNA, and it may be of use to modern Carleton Druids. The books have been pretty much reprinted in order and verba- tim from DC(E). This is better preserves the historical nature of these documents, to show the approach and “angle” that the DC(E) of 1976 was presenting, especially to the compilers of religious ency- clopedists. Many issues of The Druid Chronicler magazine would essentially add to this section from 1976 to 1980. I removed the Book of Footnotes, broke it up and placed them under the appropri- ate texts rather than stuffing all of them in this obscure section of ARDA. I have added those sections and indicated so. As with every section of this collection, none of this material is necessarily indicative of the opinion of any other Druid except that of the author(s). The material is not dogmatic or canonical, and can not be assumed to represent the Reform as a whole. Most of it is terribly out of date, and much better recent materials are available. Day 1 of Foghamhar Year XXXIV of the Reform (August 1st, 1996 c.e.) Michael Schardin THE DRYNEMTUM PRESS BABABABABABABABABABABABABABAB The Original Chapter Contents OtherOther: The Humanist Society:* check local phone book. in DC(E) The Theosophical Society:* clpb Different Strokes The Vedanta Society:* The Pronunciation -
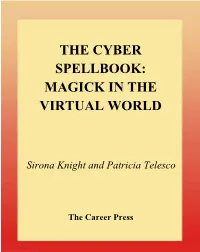
The Cyber Spellbook: Magick in the Virtual World
THE CYBER SPELLBOOK: MAGICK IN THE VIRTUAL WORLD Sirona Knight and Patricia Telesco The Career Press The CYBERCYBER S pellbook MAGICK in the VIRTUAL WORLD By S IRONA KNIGHT and P ATRICIA TELESCO NEW PAGE BOOKS A division of The Career Press, Inc. Franklin Lakes, NJ Copyright 2002 by Sirona Knight and Patricia Telesco All rights reserved under the Pan-American and International Copy- right Conventions. This book may not be reproduced, in whole or in part, in any form or by any means electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system now known or hereafter invented, without written permission from the publisher, The Career Press. THE CYBER SPELLBOOK: MAGICK IN THE VIRTUAL WORLD Edited by Kate Preston Typeset by Eileen Dow Munson Cover design by Diane Y. Chin Printed in the U.S.A. by Book-mart Press To order this title, please call toll-free 1-800-CAREER-1 (NJ and Canada: 201-848-0310) to order using VISA or MasterCard, or for further information on books from Career Press. The Career Press, Inc., 3 Tice Road, PO Box 687, Franklin Lakes, NJ 07417 www.careerpress.com www.newpagebooks.com Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Knight, Sirona, 1955- The cyber spellbook : magick in the virtual world / by Sirona Knight and Patricia Telesco. p. cm. Includes bibliographical references (p. ) and index. 1. Witchcraft. 2. Virtual reality. 3. Cyberspace. I. Knight, Sirona, 1955- II. Title. BF1571 .T425 2002 133.4’3—dc21 2002025508 The authors and publisher cannot be held responsible for any injuries or other damages which may result from us- ing the information in this book.