Ein Gallisches Götterpaar in Augst
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Zu Den Inschriften Des Apollo Grannus
Zu den Inschriften des Apollo Grannus. ' Von M. Ihm. Eine in Schweden auf getauchte Votivinschrift an den keltischen Apollo Gramms ist seit längerer Zeit bekannt, aber weder bei Grelli (nr. 1997) noch von Undset Bullettino d. Inst. 1883 p. 237 1), aus denen Holder Altkeltischer Sprachschatz 1 Sp. 2038 schöpft, richtig publiziert. Sie steht auf einem schönen Bronze-Eimer, welcher, „eine vereinfachte Weiterbildung der Pompe- janischen Prachteimer“ darstellend, im Jahre 1818 in einem Grabhügel bei Fycklinge in der schwedischen Landschaft Westmanland gefunden wurde, und lautet nach der Abbildung in der schönen Publikation von Heinrich Will er s über „die römischen Bronze-Eimer von Hemmoor “12 ) 3folgendermassen : APOLLINI - GRANNO DONVM • A A\ M I L L V S CONSTANS • PRAEF ■ TEMPL I P S I V S V S L L M also: Apollini Granno donum Ammilliusd) Constans praef(ectus) templi ipsius v(otam) s(olvit) l(ibens) l(aetus) m(erito), Beachtung verdient der pvaefectus templi , für den ich keine Analogie beizubringen weiss. Wie das verhältnismässig prunkvolle Votivstück nach Schweden gelangt ist, darüber lassen sich natürlich nur unsichere Vermutungen aufstellen. Undset meint, es sei aus ßätien importiert worden. Willers schliesst auf Grund der bis jetzt bekannten Inschriftenfunde, dass der Eimer zum Inventar eines Apollo tempels in Süd- oder Westdeutschland gehört habe. „Auf welchem Wege “, 1) Undset stellt dort p. 234ff. die in Skandinavien gefundenen römischen In- - Schriften zusammen; es handelt sich meist um Aufschriften auf Bronzegegenständen. 2) Hannover und Leipzig 1901 p. 119 (nach Montelius, Svenska Fornsaker. Jernäldern nr. 372). 3) So, nicht Ammilius. Vgl. den Frauennamen Ammilla (Holder, Altkelt. -

Appendix 1 Damona
Appendix 1 Damona Gallia Belgica Inscriptions 1. Bourbonne-les-Bains Deo Apol|lini Boruoni | et Damonae. | C(aius) Daminius | Ferox, ciuis | Lingonus, ex | uoto. « To the god Apollo Boruo and to Damona. Caius Daminius Ferox, Lingo citizen, after a vow. » Ivory marble stele, damaged on the bottom left side. Height: 15.7 cm, width: 12.6 cm. CIL XIII, 5911 = ILing 200 = D 4656 According to ILing, this text proves that Boruo is assimilated to Apollo. For the nomen Daminius: Schulze 1966: 240 and Solin-Salomies 1994: 66. For the Latin cognomen, Ferox: Kajanto 1965: 267 and Solin-Salomies 1994: 331. The dedicant had the tria nomina of a Roman citizen and at the same time, he said that he was a lingo citizen. According to ILing, that double citizenship was nothing but normal. Date: c. 2nd century AD. 2. Bourbonne-les-Bains Boruoni et [Da]|monae. C(aius) Ia[…]|[…]nius Ro|manus, (L)in|g(onus), pro salu|te Cocillae | fil(iae), ex uoto. « To Boruo and to Damona. Caius Ia…nius Romanus, Lingo, (made this monument) for his daughter Cocilla’s sake, after a vow.» Grey oolithic limestone stele. Height: 38 cm, width at the bottom: 50 cm, depth: 13 cm. CIL XIII, 5916 = ILing 203 According to ILing, a hesitation is possible between Iatinus and Latinus for the nomina. For these nomina: Schulze 1966: 176 et 522, and Solin-Salomies 1994: p. 95 and 102. The father Romanus had a Latin cognomen: Kajanto 1965: p. 182 and Solin-Salomies 1994: 392. Cocilla, the daughter, had a cognomen that could be Latin or Celtic. -

Nameless Or Nehallenia
Archaeologia Cantiana Vol. 70 1956 NAMELESS OR NEHALENNIA By FRANK JENKINS, F.S.A. A SMALL clay figurine found some years ago at Canterbury has for a long time provided an enigma in the identity of the personage which it represents.1 Although the head is missing it is otherwise complete and depicts a matron seated on a throne or high-backed chair, holding a small dog in her arms. The type is well known in north-east Gaul, where numerous examples have been found. These figurines were mass-produced in moulds, two of which have come to light at Bertrich near Trier,2 and it is from that region probably that the Canterbury example came, either as an object of trade or as a personal possession. That figurines of this type had some religious significance is clear from their frequent occurrence on the sites of temples, particularly at Trier3 and in the surrounding countryside.4 For instance, in the temple-area at Trier a number of these figurines were found together by a small shrine, before the door of which stood a stone statue of a seated matron who holds a basket of fruits upon her lap and has a dog seated at her side.5 The presence of the same type of figurine in Roman graves further suggests that it served some ritual purpose.6 Curiously enough in spite of all this abundant material the name of the goddess has in no case been revealed. It is this lacuna in our knowledge that has stimu- lated the writer to search for any evidence which might shed light on the matron's identity. -
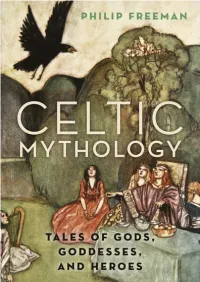
CELTIC MYTHOLOGY Ii
i CELTIC MYTHOLOGY ii OTHER TITLES BY PHILIP FREEMAN The World of Saint Patrick iii ✦ CELTIC MYTHOLOGY Tales of Gods, Goddesses, and Heroes PHILIP FREEMAN 1 iv 1 Oxford University Press is a department of the University of Oxford. It furthers the University’s objective of excellence in research, scholarship, and education by publishing worldwide. Oxford is a registered trade mark of Oxford University Press in the UK and certain other countries. Published in the United States of America by Oxford University Press 198 Madison Avenue, New York, NY 10016, United States of America. © Philip Freeman 2017 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, without the prior permission in writing of Oxford University Press, or as expressly permitted by law, by license, or under terms agreed with the appropriate reproduction rights organization. Inquiries concerning reproduction outside the scope of the above should be sent to the Rights Department, Oxford University Press, at the address above. You must not circulate this work in any other form and you must impose this same condition on any acquirer. CIP data is on file at the Library of Congress ISBN 978–0–19–046047–1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Printed by Sheridan Books, Inc., United States of America v CONTENTS Introduction: Who Were the Celts? ix Pronunciation Guide xvii 1. The Earliest Celtic Gods 1 2. The Book of Invasions 14 3. The Wooing of Étaín 29 4. Cú Chulainn and the Táin Bó Cuailnge 46 The Discovery of the Táin 47 The Conception of Conchobar 48 The Curse of Macha 50 The Exile of the Sons of Uisliu 52 The Birth of Cú Chulainn 57 The Boyhood Deeds of Cú Chulainn 61 The Wooing of Emer 71 The Death of Aife’s Only Son 75 The Táin Begins 77 Single Combat 82 Cú Chulainn and Ferdia 86 The Final Battle 89 vi vi | Contents 5. -

„LITANIA” DO CELTYCKIEJ BOGINI „Litanię”
ROCZNIKI HUMANISTYCZNE Tom XXXIV, zeszyt 2 - 1986 EDWARD ZWOLSKI Lublin „LITANIA” DO CELTYCKIEJ BOGINI „Litanię” układam z wezwań, kierowanych do bogini w ziemiach celtyckich od luzytańskiego zachodu i brytyjsko-iryjskiej północy po italskie południe i galacki wschód. Za wezwania biorę żeńskie imiona boskie z napisów na ołtarzach, coko łach, płytach dedykacyjnych i wotywnych. Pewne jawią się często, inne rzadko, nawet raz, ale wszystkie są „mowne”, ponieważ do bogini celtyckiej, nie wspiera nej powagą państwa, modlił się człowiek, który w nią wierzył. Starałem się odszukać wszystkie imiona. Nie wszystkie włączam do litanii, bo pewne, jak Navia w Hiszpanii, w Galii zaś: Acionna, Ancamna, Alauna, Ica, Icauna, Icovellauna, Soio i Qnuava, chociaż w części lub całości brzmią po celtyc- ku, swego znaczenia nie odsłaniają. Dzieła, po które sięgałem szukając napisów: Przede wszystkim berliński Corpus Inscriptionum Latinarum (skrót: CIL); dla Galii Narbońskiej - vol. XII, ed. O. Hirschfeld, 1888; dla trzech Galii (Lugduńskiej, Belgijskiej, Akwitańskiej) i obu Germanii (Górnej i Dolnej, założonych na ziemiach celtyckich) - vol. XIII, ed. A. Domaszewski, O. Bohn et E. Stein, 1899-1943 (praktycznie do 1916 r.); dla ziem dunajskich i Wschodu - vol. III, ed. Th. Mommsen, O. Hirschfeld et A. Domaszewski, 1873 (Supplementa, 1889-1902); dla Galu italskiej, vol. V, ed. Th. Mommsen, 1872-1877. Przedłużają CIL: Tom XII: E. Esperandieu, Inscriptions latines de Gaule (Narbonnaise), Paris 1929 (skrót: ILG). Tom XIII: H. Finke, Neue Inschriften, 17. Bericht der Römischgermanischen Kom mission, 1927, Berlin 1929 (skrót: 17, BRGK); H. Nesselhauf, Neue Inschriften aus dem römischen Germanien und den angrenzenden Gebieten, 27. BRGK, 1937, Berlin 1939 (skrót: 27. BRGK); F. -

Changing Views on Roman Funerary Rites
Changing Views on Roman Funerary Rites A study of the transition to the inhumation burial ritual in the region of Tongres, Cologne, and Trier in the imperial period The image on the cover depicts the variability in funerary rites at a part of the Roman southwest cemetery of Tongres (after Vanvinckenroye 1984). Changing Views on Roman Funerary Rites A study of the transition to the inhumation burial ritual in the region of Tongres, Cologne, and Trier in the imperial period Author: Tom de Rijk (s1283049) Research Master Thesis (ARCH 1046WTY) Supervisor: Prof. dr. Theuws Specialization: The Transformation of The Roman World University of Leiden, Faculty of Archaeology Leiden (15-06-2018), final version 1 2 Table of Contents 1. Introduction 6 2. Historiography and Theory 14 2.1 Historicizing theory 14 2.2 Burial rituals 24 2.3 Theory on personhood 29 3. Methodology 32 3.1 The research approach 32 3.1.1 Local origins 34 3.1.2 Eastern origins 34 3.1.3 Complex origins 35 3.2 The overview maps 36 3.2.1 The overview maps 37 4. Results 42 4.1 Tongres 42 4.1.1 The south cemeteries of Tongres 42 4.1.2 The north cemeteries of Tongres 46 4.1.3 The tumuli from Tongres and its vicinity 47 4.1.4 Synthesis and discussion of Tongres’ developments in funerary rites 48 4.2 Cologne 51 4.2.1 The funerary archaeology from near Cologne 52 4.2.2 Monumental graves from Cologne’s region 53 4.2.3 The north cemeteries of Cologne 53 4.2.4 The south cemeteries of Cologne 55 4.2.5 Synthesis and discussion of Cologne’s developments in funerary rites 62 4.3 The other sites than Cologne and Tongres from the research area 68 4.3.1 Trier 68 3 4.3.2 Andernach 72 4.3.3 Other sites from the research area 74 5. -

Life and Death in Aquae Sulis
TRANSLATION OF INSCRIPTIONS AT AQUAE SULIS This sheet also serves as an answersheet for the worksheets on individual tombstones and religious inscriptions. You will notice that many Latin names and words end with different letters on different inscriptions. That is because Latin is an inflected language: rather than relying on the order of words to convey the sense of a sentence, Latin changes the ending of the words. e.g. ‘ae’ ‘i’ ‘is’ (plural ‘orum’ ‘um’) = GENITIVE CASE and means ‘of’ or ‘apostrophes’. ‘ae’ ‘o’ ‘i’ (plural ‘is’ ‘ibus’) = DATIVE CASE and means ‘to’ or ‘for’. ‘a’ ‘e’ ‘u’ = ABLATIVE CASE and means ‘from’. Ligatures (joined letters) and reversed or smaller letters, are common on inscriptions after the 1st Century AD. TOMBSTONES See web‐page for photographs, powerpoint for line‐drawings and decoding leaflets for analysis. T2 (‘Life and Death in Aquae Sulis’) L[ucius] VITELLIUS MA Lucius Vitellius Tancinus, NTAI F[ilius] TANCINUS son of Mantaius, CIVES HISP[anus] CAURIE[n]SIS a tribesman of Caurium in Spain, EQ[ues] ALAE VETTONUM C[ivium] cavalryman of the Regiment of Vettones, Roman citizens, R[omanorum] ANN[orum] XXXXVI STIP[endiorum] XXVI aged 46, of 26 years’ service. H[ic] S[itus] E[st] Here he lies. The relief sculpture of a horseman over a defeated enemy is typical of 1st century A.D. tombstones. The cavalry regiment of the Vettones had all been granted Roman Citizenship by the Emperor Vespasian, presumably for their part in the invasion of Britain in 43 A.D. Notice that rather than taking his father’s first name, Tancinus has the Roman ‘Lucius’. -

Celtic Mythology Ebook
CELTIC MYTHOLOGY PDF, EPUB, EBOOK John Arnott MacCulloch | 288 pages | 16 Nov 2004 | Dover Publications Inc. | 9780486436562 | English | New York, United States Celtic Mythology PDF Book It's amazing the similarities. In has even influenced a number of movies, video games, and modern stories such as the Lord of the Rings saga by J. Accept Read More. Please do not copy anything without permission. Vocational Training. Thus the Celtic goddess, often portrayed as a beautiful and mature woman, was associated with nature and the spiritual essence of nature, while also representing the contrasting yet cyclic aspects of prosperity, wisdom, death, and regeneration. Yours divine voice Whispers the poetry of magic that flow through the wind, Like sweet-tasting water of the Boyne. Some of the essential female deities are Morrigan , Badb , and Nemain the three war goddess who appeared as ravens during battles. The Gods told us to do it. Thus over time, Belenus was also associated with the healing and regenerative aspects of Apollo , with healing shrines dedicated to the dual entities found across western Europe, including the one at Sainte-Sabine in Burgundy and even others as far away as Inveresk in Scotland. In most ancient mythical narratives, we rarely come across divine entities that are solely associated with language. Most of the records were taken around the 11 th century. In any case, Aengus turned out to be a lively man with a charming if somewhat whimsical character who always had four birds hovering and chirping around his head. They were a pagan people, who did not believe in written language. -

TRANSLATION of INSCRIPTIONS at AQUAE SULIS This Sheet Also Serves As an AnswerSheet for the Worksheets on Individual Tombstones and Religious Inscriptions
TRANSLATION OF INSCRIPTIONS AT AQUAE SULIS This sheet also serves as an answersheet for the worksheets on individual tombstones and religious inscriptions. You will notice that many Latin names and words end with different letters on different inscriptions. That is because Latin is an inflected language: rather than relying on the order of words to convey the sense of a sentence, Latin changes the ending of the words. e.g. ‘ae’ ‘i’ ‘is’ (plural ‘orum’ ‘um’) = GENITIVE CASE and means ‘of’ or ‘apostrophes’. ‘ae’ ‘o’ ‘i’ (plural ‘is’ ‘ibus’) = DATIVE CASE and means ‘to’ or ‘for’. ‘a’ ‘e’ ‘u’ = ABLATIVE CASE and means ‘from’. Ligatures (joined letters) and reversed or smaller letters, are common on inscriptions after the 1st Century AD. TOMBSTONES See web‐page for photographs, pdf or powerpoint for line‐drawings and decoding leaflets for analysis. T2 L[ucius] VITELLIUS MA Lucius Vitellius Tancinus, NTAI F[ilius] TANCINUS son of Mantaius, CIVES HISP[anus] CAURIE[n]SIS a tribesman of Caurium in Spain, EQ[ues] ALAE VETTONUM C[ivium] cavalryman of the Regiment of Vettones, Roman citizens, R[omanorum] ANN[orum] XXXXVI STIP[endiorum] XXVI aged 46, of 26 years’ service. H[ic] S[itus] E[st] Here he lies. The relief sculpture of a horseman over a defeated enemy is typical of 1st century A.D. tombstones. The cavalry regiment of the Vettones had all been granted Roman Citizenship by the Emperor Vespasian, presumably for their part in the invasion of Britain in 43 A.D. Notice that rather than taking his father’s first name, Tancinus has the Roman ‘Lucius’. -

CELTIC HEALER and WARRIOR MAIDEN Celtic Gods Served The
CHAPTER FOUR CELTIC HEALER AND WARRIOR MAIDEN Celtic gods served the tribe in matters of war and peace, justice and fertility, salvation and healing. As fully-fledged tribal deities, they did not entirely engage the interests of the soldier on the Roman fron tier, but some divine aspects were relevant and desirable. \Ve have already seen the Celtic god as horned warrior. It remains to con sider native gods and goddesses as healers. The ill relied as much on the supernatural as on empirical medicine, inextricably linked with religion. 1 Consequently, physicians and priests were on staff together at most healing shrines, Graeco-Roman as well as Celtic (i.e., 614). 2 Most healer gods are associated with water and curative springs; as will be seen, some have connections with curses and ret ribution (Sulis at Bath, Mercury at Uley). Warrior God and Healer Under numerous epithets, Mars was thoroughly assimilated into Celtic cults known both on the continent and in Britain alone: Camulus (467), Lenus (468, 469), Loucetius (470), Toutates (474). Celtic gods equated with Mars in Britain emphasize the god's regal and mili tary character: 1 Alator, the huntsman (603-604), Belatucadrus (Fair Shining One: 554, 55 7, 558, 562, 567),4 Rigisamus (most kingly: 472), Segomo (Victor),5 Toutates (Ruler of the people: 473, 474), Barrex (Supreme). 6 Occasionally his role as healer surfaces, especially 1 Allason-Jones, Women, 156. 2 For example, Asclepius' incubation shrines at Cos and Epidaurus. For Celtic examples, priests and physicians attended the sick at the Fontes Sequana, where the water spirit who personified the river Seine dwelled (Deyts, Sanctuaire) and at Bath where Sulis Minerva presided over a healing sanctuary (Cunlifle, Sacred Spring, 359 62). -

Goddesses As Consorts of the Healing Gods in Gallia Belgica and the Germaniae: Forms of Cult and Ritual Practices
Article How to Cite: Ferlut, A 2016 Goddesses as Consorts of the Healing Gods in Gallia Belgica and the Germaniae: Forms of Cult and Ritual Practices. Open Library of Humanities, 2(1): e5, pp. 1–26, DOI: http://dx.doi.org/10.16995/ olh.43 Published: 29 February 2016 Peer Review: This article has been peer reviewed through the double-blind process of Open Library of Humanities, which is a journal published by the Open Library of Humanities. Copyright: © 2016 The Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0), which permits unrestricted use, distri- bution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. See http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/. Open Access: Open Library of Humanities is a peer-reviewed open access journal. Digital Preservation: The Open Library of Humanities and all its journals are digitally preserved in the CLOCKSS scholarly archive service. Audrey Ferlut, ‘Goddesses as Consorts of the Healing Gods in Gallia Belgica and the Germaniae: Forms of Cult and Ritual Practices’ (2016) 2(1): e5 Open Library of Humanities, DOI: http://dx.doi. org/10.16995/olh.43 ARTICLE Goddesses as Consorts of the Healing Gods in Gallia Belgica and the Germaniae: Forms of Cult and Ritual Practices Audrey Ferlut1 1 Enseignant Chercheur Associé, UMR 5189 Hisoma-Lyon, FR [email protected] Healing gods have traditionally been analysed on their own within their sanctuaries. Moreover, few scholars have paid attention to their feminine consorts in the western part of the Roman Empire, and even fewer have studied the Northern provinces, such as Gallia Belgica and the Germaniae. -

Ancient Celtic Goddesses Author(S): E
Ancient Celtic Goddesses Author(s): E. Anwyl Source: The Celtic Review, Vol. 3, No. 9 (Jul., 1906), pp. 26-51 Published by: Stable URL: http://www.jstor.org/stable/30069895 Accessed: 23-11-2015 23:24 UTC Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at http://www.jstor.org/page/ info/about/policies/terms.jsp JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. http://www.jstor.org This content downloaded from 128.122.230.148 on Mon, 23 Nov 2015 23:24:25 UTC All use subject to JSTOR Terms and Conditions 26 THE CELTIC REVIEW ANCIENT CELTIC GODDESSES Professor E. ANWYL THE extant remains of the Celtic forms of religion afford abundant testimony to the great variety of divine names which were associated therewith. No student of Celtic religion can fail to be impressed with the number of Celtic deities, who appear to have been local or tribal in character. Even where a certain deity appears to have become non-local, it will generally be found on investigation that the sphere of the extended worship has fairly well-defined areas and centres. We cannot take as our first guide for the classification and grouping of Celtic gods a Pantheon like that of Homer, behind which there is a long history of religious development, and upon which there is the impress of a literary tradition.