Die Freiämter Im Nordöstlichen Aar-Gau
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

12/69 Der Gemeinderat Der Stadt Lenzburg an Den Einwohnerrat
12/69 Der Gemeinderat der Stadt Lenzburg an den Einwohnerrat Beteiligung der Stadt am Ersatzbau Pflegeheim Obere Mühle; Anpassung Baurecht; Solidarbürgschaft zugunsten der Alterszentrum Obere Mühle AG; Postulat der SVP-Fraktion vom 23. Juni 2011 betreffend Neubauprojekt AZOM Sehr geehrter Herr Präsident Sehr geehrte Damen und Herren Zu diesem Vorhaben unterbreiten wir Ihnen Bericht und Antrag: Zusammenfassung Die Alterszentrum Obere Mühle AG plant einen Ersatzbau des Pflegeheims. Das Bauprojekt umfasst 98 Betten, also 26 Betten mehr als bisher. Es ist geplant, während der Bauzeit die Bewohnerinnen und Bewohner in einem Provisorium auf der "Baumannsmatte" zu betreuen. Für den Ersatzbau, inkl. Provisorium, ergibt sich ein Finanzbedarf von 49,40 Mio. Franken. Davon sollen rund 9,92 Mio. Franken mit Darlehen, Kapitalerhöhungen der Aktien- gesellschaft und Sicherheiten durch die öffentliche Hand bereit gestellt wer- den. Die Gemeinderäte Staufen und Othmarsingen haben der Alterszentrum Obere Mühle AG in Aussicht gestellt, den Gemeindeversammlungen im Juni 2012 Vorlagen für eine Beteiligung zu unterbreiten. Die drei Partner- gemeinden Lenzburg, Staufen und Othmarsingen einigten sich mit der Alterszentrum Obere Mühle AG auf einen Verteilschlüssel aufgrund der Bettenbelegung im Pflegeheim. Für Lenzburg ergibt dieser Verteilschlüssel eine Beteiligung von 72,1 % was einem Betrag von Fr. 7'149'612.– entspricht. Lenzburg hat sich bereits mit 1,5 Mio. Franken am Aktienkapital der Alterszentrum Obere Mühle AG beteiligt. Für den verbleibenden Betrag von Fr. 5'649'612.– verpflichtet sich die Stadt als Solidarbürgin, wobei eine Maximalhaftung von 120 % vor- gesehen ist. Somit leistet Lenzburg den Beitrag zur Wahrnehmung der gesetzlichen Pflicht, indem eine Eventualverpflichtung eingegangen wird. Gleichzeitig wird das bestehende unentgeltliche Baurecht für das Pflege- heim dem Ersatzbauprojekt angepasst, verlängert und neu verzinst (Land- wert 4,9 Mio. -

Netzplan Region Lenzburg
Netzplan Region Lenzburg Brugg Brugg Zürich HB Industriestrasse Arena 382 Auenstein / Schinznach Dorf 393 Schloss Mägenwil Bahnhof 379 Brunegg Zentrum Wildegg 334 Electrolux Möriken Eckwil Baden 379 Züriacker Bösenrain 530 380 382 Mägenwil Gemeindehaus 381 Brunegg Mägenwil Dorf Wildegg Möriken 334 Bahnhof Zentrum Gemeindehaus Mägenwil Oberäsch Steinler Mägenwil Gewerbepark Aare Wildegg Schürz 530 393 Niederlenz Othmarsingen Dorfplatz Bahnhof 551 Bahnhofstrasse Rupperswil 530 Staufbergstrasse Niederlenz Rössli Othmarsingen Ringstrasse Hetex Militärbetriebe Högern Aarau Rupperswil 394 Nord Traitafina 381 Bahnhof Autobahn- Haldenweg viadukt Gexistrasse Lenzburg Volg Hunzenschwil Bahnhof 381 380 Othmarsinger- Schloss Zofingen Unterdorf Hunzenschwil Schule 382 strasse 391 Hendschiken 394 Lenzhard 393 Alte Bruggerstrasse Hägglingen Korbacker Coop Langsamstig Berufsschule Güterstrasse 391 ChrischonaDottikon 396 Kronenplatz Birkenweg Zeughaus 394 MehrzweckhalleNeuhofstrasse Dufourstr. 396 346 392 Dorfstrasse General Herzog-Strasse 395 Hypiplatz 390 Dottikon-Dintikon 389 Angelrain Dintikon Post- Friedweg Bahnhof Jumbo Fünflinden strasse Beyeler 346345 Oberdorf Augustin Keller-Strasse Ziegeleiweg Weiherweg Staufen Dintikon Post Hunzenschwil Talhard Fünfweiher Gemeindehaus Staufen Lenzburg Wohlen Lindenplatz Dintikon 396 391 392 Schule Chrüzweg Bachstrasse 392 395 Rebrainstrasse Ammerswil 511 390 Dorfplatz Kirche Ober Schafisheim Ausserdorf Ammerswilerstrasse 346 530 dorf Birren Nord Wohlen Schafisheim 389 Ammerswil 530 Gemeindehaus Birren Süd Milchgasse -

653 Aarau - Lenzburg/Othmarsingen - Wohlen - Rotkreuz Stand: 13
FAHRPLANJAHR 2021 653 Aarau - Lenzburg/Othmarsingen - Wohlen - Rotkreuz Stand: 13. Oktober 2020 S23 S26 S25 S26 S42 S23 37 S S26 S26 S26 8417 8619 8519 8621 19040 8421 2257 21016 8623 8623 8601 Olten Brugg AG Olten Zürich HB Langenthal Basel SBB Aarau 05 19 05 50 06 18 06 23 Rupperswil 05 23 06 23 Lenzburg 05 27 05 57 06 26 06 30 Zürich HB ab 05 08 06 08 06 08 06 08 05 08 06 08 06 08 06 08 Lenzburg an 05 27 06 27 06 27 06 27 05 28 06 28 06 28 06 28 Lenzburg 05 34 06 02 06 33 06 34 06 35 Hendschiken 06 05 06 36 06 38 Zürich HB ab 05 40 Zürich Altstetten ab 05 46 Brugg AG ab 05 33 Othmarsingen ab 05 42 Hendschiken 05 44 06 05 06 07 06 36 06 38 Dottikon-Dintikon 05 38 05 46 06 08 06 11 06 37 06 39 06 40 Wohlen AG 05 42 05 50 06 12 06 17 06 41 06 42 06 45 Boswil-Bünzen 05 46 06 16 06 21 06 45 06 47 06 49 Muri AG 05 50 05 58 06 19 06 25 06 42 06 49 06 50 06 54 Benzenschwil 05 53 06 22 06 45 06 52 Mühlau 05 55 06 25 06 48 06 54 Sins 05 59 06 29 06 52 06 58 06 58 Oberrüti 06 01 06 31 06 55 07 00 07 00 Rotkreuz 06 06 06 36 07 00 07 06 07 06 Rotkreuz ab 06 11 06 49 07 11 07 11 07 11 Luzern an 06 25 07 07 07 25 07 25 07 25 Rotkreuz ab 06 09 06 39 07 03 07 09 07 09 Zug an 06 21 06 51 07 14 07 21 07 21 Rotkreuz ab Arth-Goldau an Baden Baden Zürich HB Zug 1 / 25 FAHRPLANJAHR 2021 653 Aarau - Lenzburg/Othmarsingen - Wohlen - Rotkreuz Stand: 13. -

Wander(Ver)Führer Region Seetal
imageconcept.ch & monella.ch Tourismus Lenzburg Seetal Region Seetal Kronenplatz 24, 5600 Lenzburg Wander(ver)führer Telefon +41 (0)62 886 45 46 [email protected] www.seetaltourismus.ch Inhaltsverzeichnis Brugg Turgi BadenSeeuferweg Hallwilersee 6 Baldeggersee-Wanderung 30 Wettingen Birmenstorf Vom Eichberg zum See 10 Walking Trail Lenzburg 32 Schinznach-Dorf Birr Holderbank Industrie und Kultur am Aabach 12 Das Seetal erkunden per Velo... 36 Wildegg Auenstein Biberstein Mägenwil Mellingen Rupperswil Möriken Von Lenzburg zum Esterliturm 14 ...oder per Inline-Skates 37 Dietikon Niederlenz Othmarsingen Rohr Aarau Schlieren Buchs Staufen Petri Heil und Baldeggersee 18 Lenzburg – das Tor zum Seetal 38 Lenzburg Dottikon Suhr Unterentfelden SeetalerBremgarten Schlösser- und Burgenweg 20 Tal der Schlösser und Seen 40 Gränichen Wohlen Dintikon Egliswil Birmensdorf Däniken Oberentfelden Villmergen Waltenschwil Zufikon Seon Von Dintikon nach Schongau 24 Essen und trinken 48 Teufenthal Hallwil Seengen Sarmenstorf Safenwil Boniswil Aussichtspunkt Homberg 26 B&B, Camping und Gruppenunterkünfte 50 Schöftland Unterkulm Oberkulm Meisterschwanden Fahrwangen Schlossrued ÜbersichtskarteBoswil Wandergebiet Seetal 28 Birrwil Bettwil Zofingen Niederschongau Gontenschwil Beinwil a.S. Schongau OberschongauDiverse Themenwege 29 Muri Buttwil Aesch Merenschwand Reinach Pfeffikon Müswangen Geltwil Menziken Mosen Triengen Hämikon Hitzkirch Ermensee Sulz Rickenbach Gelfingen Beromünster Sins Retschwil Hohenrain Schenkon Cham Sursee Römerswil Hochdorf Hildisrieden Ballwil Dietwil Sempach Rain Nottwil Inwil Eschenbach Buttisholz Root Rothenburg Neuenkirch Ruswil Emmen Ebikon Küssnacht Luzern Wolhusen HBL_Anz_Wanderführer_Seetaltourismus_A5_1-1_hoch_114x180mm_col.pdf 1 11.12.2012 11:49:47 Liebe Seetal-Gäste Wandern liegt im Trend. Nicht nur die Generation 50+, sondern auch immer mehr jüngere Menschen sind vom Wandern begeistert. Wandern ist nicht nur Bewegung zu Fuss, Wandern ist gesund für Herz, Kreislauf, Muskulatur, Immunsystem und Stoffwechsel. -

Long-Term and Mid-Term Mobility During the Life Course
Long-term and Mid-term Mobility During the Life Course Sigrun Beige Travel Survey Metadata Series 28 January 2013 Travel Survey Metadata Series Long-term and Mid-term Mobility During the Life Course Sigrun Beige IVT, ETH Zürich ETH Hönggerberg, CH-8093 Zürich January 2013 Abstract Long-term and mid-term mobility of people involves on the one hand decisions about their residential locations and the corresponding moves. At the same time the places of education and employment play an important role. On the other hand the ownership of mobility tools, such as cars and different public transport season tickets are complementary elements in this process, which also bind substantial resources. These two aspects of mobility behaviour are closely connected to one another. A longitudinal perspective on these relationships is available from people's life courses, which link different dimensions of life together. Besides the personal and familial history locations of residence, education and employment as well as the ownership of mobility tools can be taken into account. In order to study the dynamics of long-term and mid- term mobility a retrospective survey covering the 20 year period from 1985 to 2004 was carried out in the year 2005 in a stratified sample of municipalities in the Canton of Zurich, Switzerland. Keywords Long-term and mid-term mobility during the life course Preferred citation style S. Beige (2013) Long-term and mid-term mobility during the life course , Travel Survey Metadata Series, 28, Institute for Transport Planning and Systems (IVT); ETH Zürich Beige, S. und K. W. Axhausen (2006) Residence locations and mobility tool ownership during the life course: Results from a retrospective survey in Switzerland, paper presented at the European Transport Conference, Strasbourg, October 2006. -
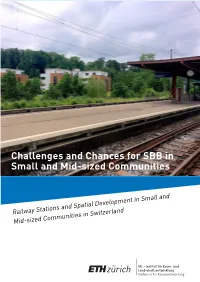
Challenges and Chances for SBB in Small and Mid-Sized Communities
Challenges and Chances for SBB in Small and Mid-sized Communities Railway Stations and Spatial Development in Small and Mid-sized Communities in Switzerland IRL – Institut für Raum- und Landschaftsentwicklung Professur für Raumentwicklung Imprint Editor ETH Zurich Institute for Spatial and Landscape Development Chair of Spatial Development Prof. Dr. Bernd Scholl Stefano-Franscini-Platz 5 8093 Zurich Authors Mahdokht Soltaniehha Mathias Niedermaier Rolf Sonderegger English editor WordsWork, Beverly Zumbühl Project partners at the SBB Stephan Osterwald Michael Loose SBB Research Advisory Board Prof. Dr. rer.pol. Thomas Bieger, University of St.Gallen Prof. Dr. Michel Bierlaire, EPFL Lausanne Prof. Dr. Dr. Matthias P. Finger, EPFL Lausanne Prof. Dr. Christian Laesser, University of St.Gallen Prof. Dr. Rico Maggi, University of Lugano (USI) Prof. Dr. Ulrich Weidmann, ETH Zurich Andreas Meyer, CEO of Schweizerische Bundesbahnen AG (Swiss Federal Railways, SBB). Project management Mahdokht Soltaniehha Mathias Niedermaier (Deputy) Print Druckzentrum ETH Hönggerberg, Zurich Photo credit Mahdokht Soltaniehha: Pages 8, 36 and cover photo Rolf Sonderegger: Pages 28 and 56 Data sources Amt für Raumentwicklung (ARE) Bundesamt für Statistik (BFS) Kantonale Geodaten AG, BE, SO, ZH Professur für Raumentwicklung, ETH Zürich - Raum+ Daten Schweizerische Bundesbahnen (SBB) swisstopo © 2015 (JA100120 JD100042) Wüest & Partner (W+P) 1 Final Report: SBB research fund Challenges and Chances for SBB in Small and Mid-sized Communities Railway Stations and Spatial Development in Small and Mid-sized Communities in Switzerland Citation suggestion: Scholl, B., Soltaniehha, M., Niedermaier, M. and Sonderegger, R. (2016). Challenges and Chances for SBB in Small and Mid-sized Communities: Railway Stations and Spatial Development in Small and Mid-sized Communities in Switzerland. -

"Othmissinger Perlen" Auswahl Gefallen
Ausgabe Nr. 227 Juni 2019 Jugendfest Othmarsingen 2019 Seitens der Schule ist die Idee entstanden, anlässlich des Jugendfests ein Musical aufzuführen. Dabei ist das Musical "s’Gheimnis vo de 7 Perle" in die engere "Othmissinger Perlen" Auswahl gefallen. Die Idee sowie der Vorschlag für das Motto "Othmissinger Perlen" wurde daraufhin in Liebe Othmissingerinnen und Othmissinger das OK getragen und für sehr gut befunden. Das Lo- go ist eine handgezeichnete und digitalisierte Co- Produktion eines Schülers, dessen Lehrerin und ei- In sieben Tagen ist es so- nem OK-Mitglied. weit, am Freitag, 28. Juni, beginnt das Jugendfest Getreu dem Motto hat das Jugendfest Othmarsingen 2019! Während drei Tagen 2019 viele interessante Programmpunkte zu bieten. können in Othmarsingen un- Unter anderem sind daraus 7 Perlen besonders her- ter dem Motto "Othmissinger vorzuheben, welche über das Festwochenende ver- Perlen" viele Perlen entdeckt teilt ein Highlight bilden. Diese sind: und bestaunt werden. Es soll ein Fest der Freude, der In- - Musical "s’Gheimnis vo de 7 Perle“ spiration und der Geselligkeit - Laternenzauber werden, welches Jung und Alt über die Grenzen von - Festumzug Othmarsingen hinaus miteinander verbinden soll! - "Schnellscht Othmissinger" Das Jugendfest hat in Othmarsingen, wie auch in vie- - "Töggeliturnier " len anderen Gemeinden im Kanton Aargau, eine - Kliby und Caroline langjährige Tradition. Diese reicht teils bis 400 Jahre oder mehr in die Vergangenheit zurück. Die Anfänge - Kinderhitparade mit Michel Villa dieser Feste sind nicht genau bekannt. In Othmarsin- gen findet das Jugendfest alle drei Jahre statt. Nebst diesen genannten Highlights kommen auch die kulinarischen Perlen nicht zu kurz. Der Fussballclub, Das 13-köpfige Organisationskomitee (OK) hat sich die Schützengesellschaft, die turnenden Vereine und vor einem Jahr gebildet und ist seither mit der Pla- der Feuerwehrverein wird Sie an verschiedenen nung beschäftigt. -

06/21 Der Gemeinderat Der Stadt Lenzburg an Den Einwohnerrat Abwasserverband Region Lenzburg; Beitritt Des Gemeindeverbandes
06/21 Der Gemeinderat der Stadt Lenzburg an den Einwohnerrat Abwasserverband Region Lenzburg; Beitritt des Gemeindeverbandes REWAS; Revision der Satzungen Sehr geehrter Herr Präsident Sehr geehrte Damen und Herren In dieser Sache unterbreiten wir Ihnen wie folgt Bericht und Antrag: I. Ausgangslage Die Gemeinden Egliswil, Lenzburg, Möriken-Wildegg, Niederlenz, Seon und Staufen schlossen sich 1965 zu einem Gemeindeverband als Körperschaft des öffentlichen Rechts mit dem Ziel zusammen, die Gewässerschutzaufgaben zu lösen und die erforderlichen Bauten - die Kläranlage „Langmatt“ sowie den Ver- bandskanal Seon bis Kläranlage - zu erstellen und zu betreiben. Später traten die Gemeinden Auenstein, Holderbank, Othmarsingen und Veltheim (für den Dorfteil „Au“) dem Verband bei. Die entsprechende Anpassung der Satzungen wurde vom Baudepartement des Kantons Aargau am 29. Oktober 1985 ge- nehmigt. Vor einiger Zeit bekundete der Abwasserverband Region Schenkenbergertal (ab 2007: Gemeindeverband Regionaler Wasser- und Abwasserbetrieb Schen- kenbergertal REWAS) Interesse am Beitritt zum Abwasserverband Region Lenzburg. Im Jahr 2005 wurde das offizielle Gesuch um Aufnahme in den Ab- wasserverband Region Lenzburg auf den 1. Januar 2007 gestellt. Dieses Vor- haben ist in sämtlichen Gemeinden der beiden Verbände durch die Gemeinde- versammlungen zu bestätigen, und die Satzungen müssen an diese neue Situ- ation angepasst werden. Dies bildet zugleich Anlass, die überholungsbedürfti- gen Satzungen aus dem Jahr 1985 gründlich zu überarbeiten und den zustän- digen Instanzen noch im Jahr 2006 zur Genehmigung zu unterbreiten. II. Notwendigkeit und frühere Bestrebungen der Revision der Satzungen Die bisherigen Satzungen aus dem Jahr 1985 sind in starkem Masse von der damals in Angriff genommenen umfangreichen Bauphase bzw. dem Um- und – 2 – Ausbauvorhaben mit einer Investitionssumme von 19,5 Mio. -

Funktionaerlisterr 16 17
Funktionärsliste FC Lenzburg Saison 2016/2017 Stand: 17. März 2017 FUNKTION NAME VORNAME ADRESSE PLZ ORT TEL P/G E-MAIL NATEL Vorstand Präsidium (Co-Präsident) Bruder Ueli Wiesenstrasse 4 5603 Staufen [email protected] 079 643 81 29 Präsidium (Co-Präsident) Barth Mike Nordweg 6 5603 Staufen [email protected] 079 708 34 60 Kasse vakant Juniorenobmann/Leiter Nachwuchs Di Prete Carlo Seetalweg 17 5702 Niederlenz [email protected] 076 777 87 21 Beisitzer/Material Häfliger Christian Ringstrasse Nord 2 5600 Lenzburg 062 891 40 56 [email protected] 079 342 72 25 Beisitzer/Projekte Kieser Martin Erlenweg 10 5603 Staufen [email protected] 078 704 97 13 Aktuar Kyburz Beni Gustav Henckellstrasse 14 5600 Lenzburg [email protected] 079 463 66 73 Spiko Aktive Rauber Walter Friederichstrasse 6 5603 Staufen [email protected] 079 648 38 01 Junioren (bis auf Weiteres) Di Prete Carlo Seetalweg 17 5702 Niederlenz [email protected] 076 777 87 21 Trainer Aktive 1. Mannschaft Drmic Igor Chimligasse 24 8603 Schwerzenbach [email protected] 076 304 94 46 1. Mannschaft Co-Trainer Viceconte Carmine Weizenweg 4 5610 Wohlen [email protected] 079 599 10 10 2. Mannschaft Oryachkov Nikolay Tunaupark 7 5734 Reinach [email protected] 079 660 82 84 2. Mannschaft Co-Trainer Viceconte Carmine Weizenweg 4 5610 Wohlen [email protected] 079 599 10 10 3. Mannschaft Conti Filippo Schneggenhübel 4 5103 Möriken [email protected] 079 344 82 80 Senioren (Aargau Mitte) Marchesin Andrea Zopfgasse 26 5603 Staufen [email protected] -

18.10. 2020, 14.30 Uhr Sportplatz Falkenmatt Singen Singen Singen FC Othmarsingen 1 FC Schönenwerd - Niedergösgen 1
FC Othmarsingen Sportplatz F 18.10. 2020, Niedergösgen 1 FC Schönenwerd- FC Othmarsingen1 2.Liga Meisterschaft alkenmatt 14.30Uhr R Matchballsponsoren Saison 2020/21 Wir danken den Matchballsponsoren für Ihre Unterstützung! Bowling Universum Dani Studer (Luzern, Zürich, Salzburg Wien) Urs Moser Hendschiken Kreuz Garage Dietikon AG Spreitenbach Susanna und Max Gisler Othmarsingen Clubhaus FCO Othmarsingen Margot und Hansruedi Surer Othmarsingen Pierluigi Ghitti Präsident FC Wettingen Enetbaden Marco Polo Grossküchen/Haushaltgeräte Birrhard Pamela Meier und Stebi Röthlisberger Othmarsingen Beat Gomes Mellingen Bea & Hugo Werder Othmarsingen Shell Tankstelle Niederlenz Fredy Richner Birmenstorf Christian Holzer Hendschiken Lilo & Marcel Gwerder Othmarsingen Therese und Vinko Kalamari Othmarsingen Hedi und Willi Häusler Othmarsingen Schibi Roth Waltenschwil Matthias Schatzmann Hendschiken ROstein AG Rotkreuz Massagepraxis Lenzburg Lenzburg Antonio Maiolo Zofingen Frohsinn Pup / Bar Mägenwil Lispo Sport AG Mägenwil Matchballsponsoren Saison 2020/21 Familie Zeqiraj Othmarsingen Silvia, Zacci, Luca und Elia Hendschiken Hanspeter Frauchiger Lenzburg Urs Schwager Lenzburg Gian Pietro Tartaruga Seengen Marcel Volger Tennwil Adrian Häusler Othmarsingen Urs und Kurt Werder Othmarsingen / Dottikon Fränzi und Dani Othmarsingen ITPrint Solutions GmbH Villmergen Mike Barth und Ueli Bruder Co -Präsidenten FC Lenzburg Familie Biswas Othmarsingen Lotto Spielmaterial Vermietung Obergösgen Dagmar Appenzeller Ernährungspsychologische Beratung Hermetschwil-Staffeln -

Willkommen Im Othmarsinger Wald
Willkommen im Othmarsinger Wald www.othmarsingen.ch www.lenzburg.ch Waldgebiet Othmarsingen Sehenswert Die Stationen sind mit Nummernpfählen im Wald markiert. 1 Hellmoos Schlachtfeld der Villmergerkriege Die südliche Gemeindegrenze von Othmarsingen ist zugleich Grenze zum Bezirk Bremgarten. Diese Grenze zwischen Berner Aargau und den Freien Ämtern hatte in der Alten Eidgenossenschaft (1415-1798) eine wichtige Bedeutung, an der auch Auseinandersetzungen stattfanden. Hier, vom Hellmoos aus, überblickt man die Ebene, wo sich die Eidgenossen zweimal bekämpften. Im offenen Gelände im unteren Bünztal bekriegten sich die katholischen Bei guter Fernsicht weitet Innerschweizer und reformierten Berner am 24. Januar 1656. Die von sich der Blick vom Hell- General von Pfyffer geführten Innerschweizer schlugen die Berner (unter moos über die friedliche General Sigmund von Erlach) bei der Schlacht bei Villmergen (1. Villmerger- Bünztalebene bis in die Innerschweizer Alpen. krieg). Die Berner beklagten 573 und die Innerschweizer 189 Tote. Im Umfeld dieser Schlacht brannte in den umliegenden Dörfer so manches Vor gut 350 und vor 300 Jahren jedoch ist in der Haus; Othmarsingen war belagert und von Verwüstungen nicht verschont Ebene vor Villmergen viel geblieben. Blut geflossen: in zwei Am 25. Juli 1712 standen sich das katholische Heer (11000 Mann, schlecht Schlachten zwischen ausgerüstet) und die Berner (10000 Mann, gut bewaffnet und geführt) reformierten Bernern und Zürchern und katholischen wieder in den Langelen nördlich Villmergen zur Schlacht gegenüber (s. Bild). Innerschweizern mussten Die Berner siegten überwältigend. Beim Kampf Eidgenossen gegen 4000 Soldaten ihr Leben Eidgenossen beklagte man viele Tote (2600 auf katholischer Seite und 600 lassen. bei den Bernern). Auch nach diesem 2. Villmergerkrieg gelang keine endgültige Befriedung der Situation, die erst durch die Schaffung des Bundesstaates 1848 in eine gemeinsame Zukunft führte. -

History of Heat Pumps
Department of Environment, Transport, Energy and Communications DETEC Swiss Federal Office of Energy SFOE Section Energy Efficiency and Renewable Energies History of Heat Pumps Swiss Contributions and International Milestones Martin Zogg Process and Energy Engineering CH-3414 Oberburg, Switzerland [email protected] May 2008 Introduction 2 Preface This report emerged from the desire of the Swiss Federal Office of Energy for a comprehensive history of the heat pump development focussing on the Swiss pioneers’ substantial contri- butions and to present it at the 9th International Energy Agency Heat Pump Conference on May 20-22, 2008 in Zurich. As regards the Swiss activities, many personal interviews were ar- ranged. The report is based on the best knowledge of the author; but there is no claim for com- pleteness and infallibility. The author’s sincere thanks go to the following people for their generous information, support and advice: Karin Äbi, Marco Andreoli, Peter Bailer, Heinz Baumann, Franz Beyeler, Pierre Binggeli, Rudolf Bolliger, Otto Bosshart, Carlo Brugnoli, Georg Dubacher, Fredy Eberhard, Max Ehrbar, Hans-Rudolf Fankhauser, Daniel Favrat, Peter Fluri, Pirmin Frei, Rolf Frischknecht, Herbert Giger, Martin Graf, Heinz Grimm, Gerald C. Groff, Emil Grüninger, Hans Grüter, Gün- ther Reiner, Daniel Gut, Karl-Heinz Handl, Franz Hansen, Filip Hauptmann, Hans-Peter Hemmi, Fredy Hoyer, Peter Hubacher, Hans Huber, Max Hutter, Beda Huwyler, Dieter Im- boden, Walter Janach, Bruno Jordi, Daniel Kalberer, Bruno Kemm, Christine Klinger,