Historisch- Geographisches Kurzporträt
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
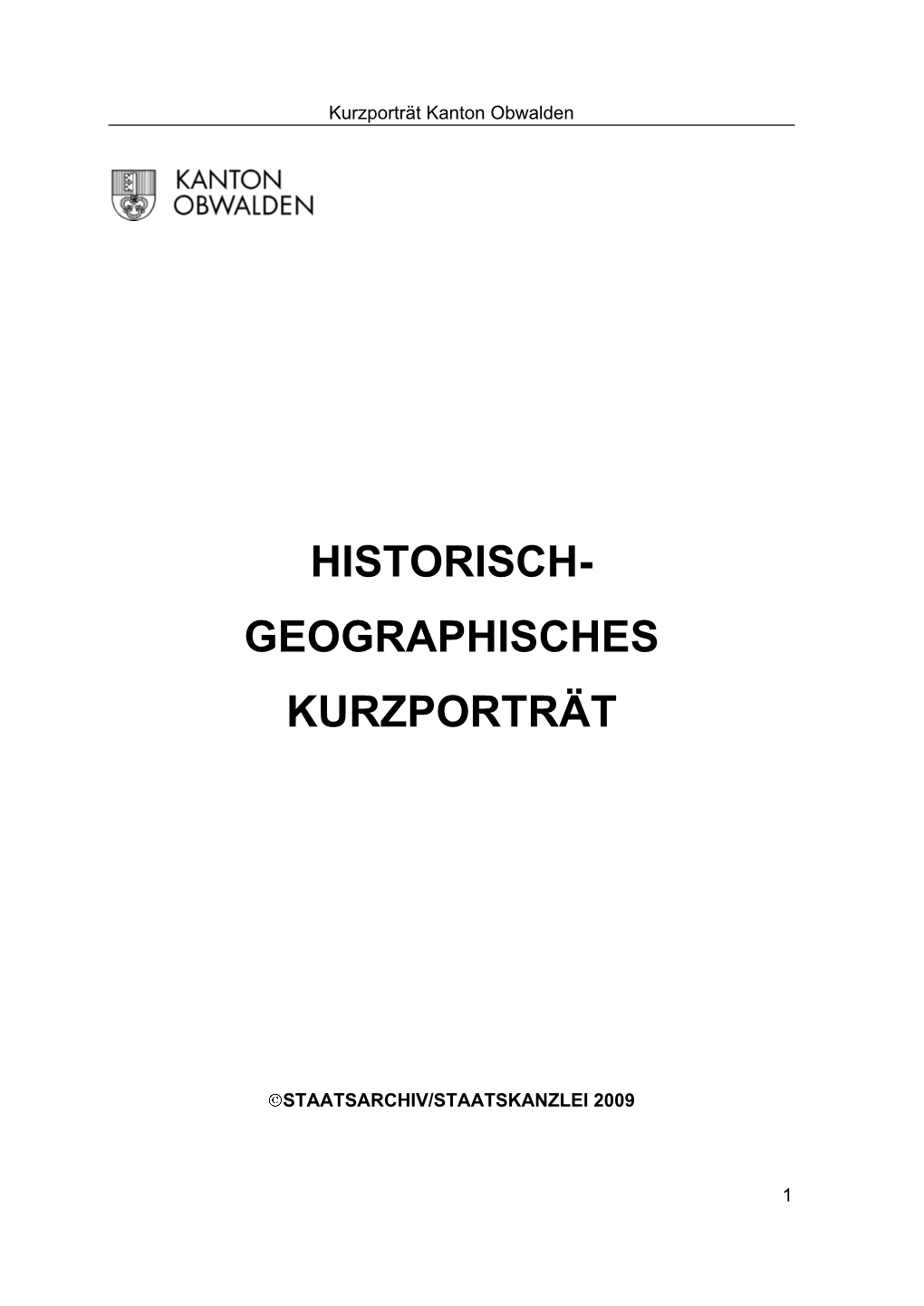
Load more
Recommended publications
-

Broschüre Geführte Wanderungen 2016
OOBBWWAALLDDNNEERR WANDERWEGE www.ow-wanderwege.ch Erfolg ist, neue Wege zu gehen. Weil Erfolg für alle etwas anderes ist, ist die beste Beratung die ganz persönliche. Wir sind für Sie da. Versprochen. www.owkb.ch Liebe Wanderin, lieber Wanderer «Das Wandern ist die vollkommenste Art der Fortbewegung, wenn man das wahre Leben entdecken will. Es ist der Weg in die Freiheit.» (Elizabeth von Arnim). Dieses Entdecken und Wohlfühlen in Freiheit wollen wir Ihnen auch im neuen Wanderjahr, nicht zuletzt ihrer Gesundheit zuliebe, wieder vermitteln. Wir laden Sie als Vereinsmitglieder und gerngesehene Gäste zu den entdeckungsreichen Wanderungen in die grossartige Natur und Kulturlandschaft des reizvollen Sarneraatals und des malerischen Hochtals Engelberg ein. Oder kommen Sie mit uns auch in die grenznahe Nachbarschaft auf Entdeckungswanderungen. Unsere Wanderleiterin und Wanderleiter freuen sich auf Ihre rege Teilnahme. Auch Nichtmitglieder sind an unsern geführten Wanderungen, die für alle unentgeltlich sind, herzlich Willkommen. Die vorliegende Wanderbroschüre regt darüber hinaus an, selbstständig im freien Nachvollzug des Programms unser attrakti - ves Wanderwegnetz zu entdecken. Es wird von den Gemeinden und Transportunternehmen bereitgestellt, von profes - sionellen und freiwilligen Organisationen unterhalten und durch einsatzfreudige Wanderweggöttis und Wanderweggotten in anerkennenswerter Weise sorgsam gepflegt. Mit wanderfreundlichen Grüssen wünsche ich Ihnen ein erlebnisreiches und unfallfreies Wanderjahr. Sarnen, im März 2016 OBWALDNER -

Feldschiessen Einzelrangliste Sektion(En): (Alle) Feldschiessen 300M 29.05.2011 KSG OW , 6060 Sarnen File:///C:/Dokumente
KSG OW , 6060 Sarnen file:///C:/Dokumente und Einstellungen/Kiser Wendelin/Desktop/Shot O... Feldschiessen Einzelrangliste Sektion(en): (alle) Feldschiessen 300m 29.05.2011 Rang Schütze Punkte Jahrgang A-Kat. Waffe Ausz. Sektion 1 Wallimann Klaus 72 1964 A Stgw 90 KA KK Kerns Schützengesellschaft Ker... 2 Vogler Josef 71 1957 A Stgw 90 KA KK Lungern SG 3 Steiner Markus 70 1967 A Stgw 90 KA KK Kerns Schützengesellschaft Ker... 4 Britschgi Karin 70 1974 A Stgw 90 KA KK Sachseln SG 5 Bürki Bernhard 69 1950 V Stgw 90 KA KK Lungern SG 6 Michel Hans-Peter 69 1959 A Stgw 90 KA KK Melchtal SG 7 Kiser Heinz 69 1964 A Stgw 90 KA KK Sarnen Schützen von Sarnen 8 Ming Michael 69 1977 A Stgw 90 KA KK Lungern SG 9 Barmettler Lars 69 1982 A Stgw 90 KA KK Kerns Schützengesellschaft Ker... 10 Lussi Remo 69 1989 A Stgw 90 KA KK Giswil SG 11 Vogler Melanie 68 1994 J Stgw 90 KA KK Sachseln SG 12 Pellet Michel 68 1955 A Stgw 90 KA KK Lungern SG 13 Wigger Marida 68 1959 A Stgw 90 KA KK Engelberg SG 14 Achermann Remo 68 1974 A Stgw 90 KA KK Lungern SG 15 Imfeld Albert 68 1976 A Stgw 90 KA KK Lungern SG 16 Wolf Adrian 68 1981 A Stgw 90 KA KK Giswil SG 17 Stütz Pascal 68 1986 A Stgw 90 KA KK Lungern SG 18 Bissig Karin 67 1992 J Stgw 90 KA KK Kägiswil SG 19 Häberli Paul 67 1936 SV Karabiner KA KK Kerns Schützengesellschaft Ker.. -

N°7 | 2010/2 Das Kulturblatt
Das Kulturblatt für N°7 | 2010/2 VORWORT Dieses Obacht Kultur heisst «Das Appen- zell». Greifen Sie jetzt nicht gleich zum Telefon, wir wissen, dass das politisch un- korrekt, sprachlich unpräzise ist, dass es viele ärgert, andere emotional aufwühlt. Das lernt man schnell, wenn man hier wirkt. Aber erklären Sie das einmal Aussenste- Thema rührt beide Kantone in einen Topf, henden! aber auch Uneingeweihte von ausserhalb Wir unternehmen den Versuch einer waren mit dabei. Sascha Tittmann hat dem Sprach sensibilisierung; auch im ureigenen verschriftlichten Gespräch eine gewitzte Interesse; in der Hoffnung, dass wir getrost Leichtigkeit in Bildern verliehen. den hierzulande ungeliebten Ausdruck Der Auftritt in der Heftmitte kommt vom «das Appenzell» stehen lassen können, appenzellisch-aargauischen wortsensiblen weil wir auf Ihre Nachsicht bauen dürfen. und sprachagierenden Künstler H.R. Fri- Im besten Fall gelingt es, das Feingefühl cker, die Bildbogen kommen von den bei- für einen differenzierten Sprachgebrauch den Künstlerinnen Luzia Broger und Regu- auch auswärts zu wecken; auch wenn die la Engeler, die Appenzell Biennale liefert Erfahrung zeigt, dass Sprache sich wan- einen Flecken Edelweiss auf der Ebenalp. delt. Wie hat doch Agathe Nisple an der Den fremden und eigenen Bildern, den Redaktionssitzung, als wir das Thema be- Grenzzäunen im Kopf, hat sich auch die stimmten, gesagt: «Ich habe das Korrigie- diesjährige kleine Kulturlandsgemeinde ren aufgegeben, es ist, wie wenn ich von (kKL) gewidmet. Sie stand unter dem Titel einem Fluss fordern würde, er müsse den «Im Land der Fremden» und fand am er- Berg hinauf fliessen.» Wir haben gelacht, sten Maiwochenende in Trogen statt. Das ohne den Ernst der Sache zu verkennen. -

Publikationen
PUBLIKATIONEN 1884: BGN 1, Sammelband Beiträge zur Geschichte Nidwaldens, Heft 1, brosch., IV, 104 S., Stans 1884: von De- schwanden Karl: Geschichte des Schulwesens von Nidwalden (I), S. 1-23. Niederberger Martin: Nidwalden in Acht und Bann. Ein Stück Geschichte Nidwaldens und der Urkan- tone (I), S. 24-51. von Deschwanden Karl: Geschichtliche Übersicht über die Entstehung und die Veränderungen der Landesfondationen von Nidwalden bis zum Jahre 1869, S. 52-64. Odermatt Anton: Die Frühmesserei in Stans, S. 65-76. Wyrsch Jakob: Regesten des «Rothen Büchleins» zu Beggenried, S. 77-86. Odermatt Remigius: Errichtung der Kapla- nei Emmetten, S. 87-92. Chronik von Nidwalden für 1882, S. 98-103. 1885: BGN 2, Sammelband Beiträge zur Geschichte Nidwaldens, Heft 2, brosch., IV, 151 S., Stans 1885: von De- schwanden Karl: Geschichte des Schulwesens von Nidwalden (II), S. 1-27. Odermatt An- ton: Gültengesetz in Nidwalden vom Jahre 1432, S. 28-36. Niederberger Martin: Nidwal- den in Acht und Bann. Ein Stück Geschichte Nidwaldens und der Urkantone (II), S. 37-82. Odermatt Anton: Kapelle und Pfründe in Büren, S. 83-104. Wyrsch Jakob: Alte Baureste zu Buochs, S. 105-123. Blättler Franz: Die ersten Ürthegesetze in Hergiswil, S. 124-138. Chronik von Nidwalden für 1883, S. 139-150. 1886: BGN 3, Sammelband Beiträge zur Geschichte Nidwaldens, Heft 3, brosch., II, 110 S., Stans 1886: von Deschwan- den Karl: Geschichte des Schulwesens von Nidwalden (III), S. 1-27. von Deschwanden Karl: Umriss der geschichtlichen Entwicklung von Nidwalden im 13. und 14. Jahrhundert, S. 28- 58. Odermatt Anton: Wolfenschiessen zins- und lehenpflichtig nach Engelberg, S. -

S-Bahn Ohne Grenzen
Forum www.pro-bahn.ch Pro Bahn Schweiz • Pro Rail Suisse • Pro Bahn Svizzera Info Interessenvertretung der Kundinnen und Kunden des öffentlichen Verkehrs 4/17 S-Bahn ohne Grenzen Endlich: Inbetriebnahme der neuen Bahnlinie FMV Mendrisio–Varese im Januar BAV braucht mehr Zeit: Start nationaler Fernbus-Linien verzögert sich Blick in die USA: Stadtbahnen boomen in städtischen Agglomerationen Schwerpunkt 2/2011 InfoForum 1 Editorial Inhalt Schwerpunkt „Fahrplanwechsel“ Neues im Süden: Im Januar 2018 geht Mendrisio-Varese in Betrieb �������������������3-5 Trinational: Frankfurt-Mailand ��������������������������6 Aktuell Ärger mit Sitzplatzblockierern ��������������������������7 Karin Blättler Mühe mit Sparbilletten ������������������������������������8 Nicht für alle: Ausbauschritt 2035 ���������������9-10 Präsidentin Pro Bahn Schweiz Fernbusse: Konkurrenz oder Ergänzung? ���11-12 Fernbusse: Position von Pro Bahn �������������������12 Neue Stadtbahn für das Luganese �������������13-14 Bern: Wichtiger Schritt für neues Tram �����������15 Nachrichten ��������������������������������������������������16 Tempo raus und Fokus auf das Kerngeschäft! Wenig bekannt: Bus alpin �������������������������������17 D Laufend werden Dienstleistungen abgebaut� Verkaufsstellen werden geschlossen, Vorbild: Elektrofähren in Skandinavien �����������18 Bahnreisezentren an unattraktive Orte zu Gunsten von Take Aways verlegt� Toiletten werden Güterverkehr: Europäischer Hürdenlauf ����������19 ebenfalls in die hintersten Ecken verbannt� Fernbusse sollen nun dazu -

[email protected]
Amtliches Publikationsorgan. Erscheint jeden Donnerstag Herausgegeben von der Staatskanzlei Obwalden, 6061 Sarnen Telefon 041 666 62 05, E-Mail: [email protected] 51 52 Amtsblatt 19 Donnerstag, 19. Dezember 2019 Regierungsrat und Staatskanzlei Schliessung der Büros über die Weihnachts- und Neujahrstage 1802 Gesamterneuerungswahlen der Gerichte für die Amtsdauer 2020 bis 2024 vom 9. Februar 2020: Stille Wahl der Präsidien des Obergerichts 1803 Stille Wahl der Mitglieder des Obergerichts und des Kantonsgerichts 1803 Gesamterneuerungswahlen der Gemeinderäte für die Amtsdauer 2020 bis 2024 vom 9. Februar 2020. Stille Wahl der Mitglieder der Gemeinderäte Sachseln, Lungern und Engelberg 1805 Gesetzessammlung Ausführungsbestimmungen über die Ausrichtung von Ausbildungs - beiträgen. Nachtrag 1807 Departemente Amt für Landwirtschaft und Umwelt: Schlachtviehmarkt 1809 Kantonale Abfall- und Deponieplanung. Neubearbeitung 2018 1810 Aufforderung zur amtlichen Öl- und Holzfeuerungskontrolle 1810 Holzzentralheizungen sind ab 2020 messpflichtig 1812 Amt für Arbeit. Registrierte arbeitslose Personen 1813 Jugend und Sport. Kantonales Schneesportlager Obwalden 2020 1814 Kantonsstrasse Kerns–Melchtal. Belagsarbeiten Melchtalerstrasse, Kerns. Arbeitsausschreibung 1819 Baugesuche und Sonderbewilligungen 1821 1801 Regierungsrat und Staatskanzlei Kantonale Verwaltung und Gemeindeverwaltungen. Schliessung der Büros über die Weihnachts- und Neujahrstage Kantonale Verwaltung Staatskanzlei (inklusive Passbüro) Finanzdepartement Sicherheits- und Justizdepartement Volkswirtschaftsdepartement -

The Hotel Victoria in Rome the History of a Hotel and a Swiss Hotelier Family
The Hotel Victoria in Rome The history of a hotel and a Swiss hotelier family Visitors to the Eternal City can choose from more than 1,000 hotels, and one of these is the Hotel Victoria. This traditional hotel has been putting out the welcome mat for its guests for more than 100 years – and this remarkable history is mainly due to the patience, perseverance and quality awareness of one Swiss family. In today's world it is hard to find large, grand hotels that are still family run and owned. Hotels with a rating of four stars or more with in excess of one hundred rooms are normally owned by global enterprises. This is also true of Rome – but in Rome there are still exceptions, although you can only count them on the fingers of one hand. One exception, one of these family-run, grand hotels in the city, is located directly next to the Aurelian Wall, a stone's throw away from the Villa Borghese. Two minutes walk away to the south west you will find the cosmopolitan Via Veneto, familiar to us all from Fellini's "La dolce vita". When you enter the foyer of the Hotel Victoria, you will notice immediately that something is different – the walls. Throughout the foyer, the bar and restaurant, in all corridors and rooms, the walls of the entire hotel are covered by an impressive collection of paintings dating from the 17th, 18th and 19th centuries. The manager of a hotel chain would never dream of making his premises a showcase for such works of art. -

2195. Erlebte Landschaft : Die Heimat Im Denken Und Dasein Der Schweizer : Eine Landeskundliche Anthologie / Von Emil Egli.-- Artemis; 1961.,943:E1:1
2195. Erlebte Landschaft : die Heimat im Denken und Dasein der Schweizer : eine landeskundliche Anthologie / von Emil Egli.-- Artemis; 1961.,943:E1:1 2196. Erlebter Aktivdienst, 1939-1945 : Auszuge aus dem Tagebuch eines Angehorigen der Fliegertruppen / Ernst Frei.-- 3. Aufl.-- Novalis; 2000, c1998.,2343:F12:1 2197. Erlenbuel : Roman / Meinrad Inglin.-- Atlantis; c1965.,946:I1:14 2198. Erlosungsvorstellungen und ihre psychologischen Aspekte / Hans Schar.-- Rascher; 1950.-- (Studien aus dem C.G. Jung- Institut ; 2).,140:S1:1 2199. Ernest Ansermet : 1883-1969 : [catalogue de l'exposition Ernest Ansermet / organisee a l'occasion du centenaire de la naissance du chef d'orchestre ; publie sous la direction de Jean-Louis Mathey ; texte de liaison de Jean-Jacques Rapin ; preface de Rene Schenker].-- Bibliotheque cantonale et universitaire, Association Ernest Ansermet; 1983.,760:M3:1 2200. Ernest Ansermet : une vie en images / dessinee par Gea Augsbourg ; commentee par Paul Budry et Romain Goldron . Suivie d'un texte original d'Ernest Ansermet, Le geste du chef d'orchestre.-- Delachaux et Nestle; c1965.,760:B4:1 2201. Erni vom Melchi : Roman / R. Kuchler-Ming.-- Eugen Rentsch; c1948.,946:K6:1 2202. Ernst Gagliardi 1882-1940 : sein Leben und Wirken / Georg Hoffmann.-- O. Fussli; c1943.,2345:H6:1 2203. Ernst Kreidorf : der Maler und Dichter / von Jakob Otto Kehrli.-- P. Haupt; c1949.-- (Schweizer Heimatbucher ; Nr. 28/29).,703:K1:1 2204. Ernst Nobs : vom Burgerschreck zum Bundesrat : ein politisches Leben / Tobias Kastli.-- Orell Fussli; c1995.,310:K13:1 2205. Eros, die subtile Energie : Studie zur anthropologischen Psychologie des zwischenmenschlichen Potentials / Annie Berner-Hurbin.-- Schwabe; 1989.,140:B7:1 2206. -

Jahrbuch 2003 Eröffnen Zwei Artikel, Die Sich Im Engeren Sinn Mit Der Geschichte Der Appenzellischen Jahrbücher Befas- Sen
Appenzellische Jahrbücher 2003 Herausgegeben von der Appenzellischen Gemeinnützigen Gesellschaft 131. Heft Gemeinde-Chronik Appenzellische Jahrbücher 2003 131. Heft Herausgegeben von der Appenzellischen Gemeinnützigen Gesellschaft Redigiert von Matthias Weishaupt 1 Gemeinde-Chronik Umschlaggestaltung von Rolf Egger und Patrick Lipp. Fotomontage unter Verwendung der Appenzellischen Jahrbücher 1854–2003 und eines Auszugs aus dem Protokollbuch der Appenzellischen Gemeinnützigen Gesellschaft, Bd. 2: 1848–1877, S. 46f. Konzept/Redaktion: Matthias Weishaupt Layout: Rolf Egger Druck: Appenzeller Medienhaus, Schläpfer AG, Herisau © 2004 Appenzellische Gemeinnützige Gesellschaft AGG ISBN 3-85882-405-4 2 Inhaltsverzeichnis 7 Vorwort 1. 150 Jahre Appenzellische Jahrbücher 12 150 Jahre Appenzellische Jahrbücher: «Zur Beförderung des Wohls des Vaterlandes und zur Verhütung der Armuth und Verdienstlosigkeit» Ivo Bischofberger 19 Die Appenzellischen Jahrbücher seit 1854: ein «Archiv für die appenzellische Landesgeschichte und Landeskunde» Matthias Weishaupt 32 Aufklärung und Öffentlichkeit beim kleinen Mann auf dem Lande – Die Anfänge der Lesegesellschaft in Schwänberg Thomas Fuchs 57 Der Komponist Heinrich von Herzogenberg und sein Haus Abendroth in Heiden – mehr als eine Episode Konrad Klek 72 Das Appenzellerland – Teil des Bistums St.Gallen Franz Xaver Bischof 3 Inhaltsverzeichnis 2. Chroniken und Nekrologe 92 Landeschronik von Appenzell A.Rh. für das Jahr 2003 Jürg Bühler Gemeindechronik von Appenzell A.Rh. für das Jahr 2003 111 Hinterland, René Bieri 111 Urnäsch 114 Herisau 122 Schwellbrunn 124 Hundwil 125 Stein 126 Schönengrund 127 Waldstatt 129 Mittelland, Martin Hüsler 129 Teufen 135 Bühler 140 Gais 147 Speicher 154 Trogen 162 Vorderland, Isabelle Kürsteiner 166 Rehetobel 170 Wald 174 Grub 177 Heiden 186 Wolfhalden 191 Lutzenberg 196 Walzenhausen 202 Reute 208 Landeschronik von Appenzell I.Rh. -

Switzerland – a Model for Solving Nationality Conflicts?
PEACE RESEARCH INSTITUTE FRANKFURT Bruno Schoch Switzerland – A Model for Solving Nationality Conflicts? Translation: Margaret Clarke PRIF-Report No. 54/2000 © Peace Research Institute Frankfurt (PRIF) II Summary Since the disintegration of the socialist camp and the Soviet Union, which triggered a new wave of state reorganization, nationalist mobilization, and minority conflict in Europe, possible alternatives to the homogeneous nation-state have once again become a major focus of attention for politicians and political scientists. Unquestionably, there are other instances of the successful "civilization" of linguistic strife and nationality conflicts; but the Swiss Confederation is rightly seen as an outstanding example of the successful politi- cal integration of differing ethnic affinities. In his oft-quoted address of 1882, "Qu’est-ce qu’une nation?", Ernest Renan had already cited the confederation as political proof that the nationality principle was far from being the quasi-natural primal ground of the modern nation, as a growing number of his contemporaries in Europe were beginning to believe: "Language", said Renan, "is an invitation to union, not a compulsion to it. Switzerland... which came into being by the consent of its different parts, has three or four languages. There is in man something that ranks above language, and that is will." Whether modern Switzerland is described as a multilingual "nation by will" or a multi- cultural polity, the fact is that suggestions about using the Swiss "model" to settle violent nationality-conflicts have been a recurrent phenomenon since 1848 – most recently, for example, in the proposals for bringing peace to Cyprus and Bosnia. However, remedies such as this are flawed by their erroneous belief that the confederate cantons are ethnic entities. -

Geschichte Verbindet Das Weisse Buch Von Sarnen Niklaus Von Flüe Eine Obwaldner Zeitreise
Geschichte verbindet Das Weisse Buch von Sarnen Niklaus von Flüe Eine Obwaldner Zeitreise Begleitinformationen und Kopiervorlagen © Bildungs- und Kulturdepartement des Kantons Obwalden, 2017, als Kopiervorlage freigegeben Seite 1 von 56 Inhaltsverzeichnis 1 Objekte und ihre Geschichte ................................................ 3 KV 1 Objekte erzählen Geschichte ............................................ 5 2 Die Eidgenossenschaft als Bündnisgeflecht ................................... 7 3 Vom Bündnisgeflecht zum Bündnisverbund .................................. 8 KV 2 Ein komplizierter Text .................................................. 10 4 Habsburg, die Eidgenossenschaft und Burgund ............................... 13 5 Eine Geschichte der Befreiung .............................................. 15 KV 3 Das Weisse Buch von Sarnen ........................................... 17 6 nah dran: Lesen und Schreiben .............................................. 20 7 Methode: Schriftliche Quellen auswerten .................................... 22 KV 4 Methode: Schriftliche Quellen auswerten ................................ 23 8 nah dran: Der «Hexenturm» von Sarnen ...................................... 25 9 nah dran: Das Weisse Buch im Archiv ........................................ 26 10 Konflikte zwischen Stadt und Land .......................................... 27 11 Das Stanser Verkommnis und Bruder Klaus ................................... 29 KV 5 Das Leben des Niklaus von Flüe ......................................... 31 12 nah -

Wilhelm Tell 1789 — 1895
THE RE-APPROPRIATION AND TRANSFORMATION OF A NATIONAL SYMBOL: WILHELM TELL 1789 — 1895 by RETO TSCHAN B.A., The University of Toronto, 1998 A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS in THE FACULTY OF GRADUATE STUDIES (Department of History) We accept this thesis as conforming to the required standard THE UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA April 2000 © Reto Tschan, 2000. In presenting this thesis in partial fulfilment of the requirements for an advanced degree at the University of British Columbia, I agree that the library shall make it freely available for reference and study. 1 further agree that permission for extensive copying of this thesis for scholarly purposes may be granted by the head of my department or by his or her representatives. It is understood that copying or publication of this thesis for financial gain shall not be allowed without my written permission. Department of 'HvS.'hK^ The University of British Columbia Vancouver, Canada Date l^.+. 2000. 11 Abstract Wilhelm Tell, the rugged mountain peasant armed with his crossbow, is the quintessential symbol of Switzerland. He personifies both Switzerland's ancient liberty and the concept of an armed Swiss citizenry. His likeness is everywhere in modern Switzerland and his symbolic value is clearly understood: patriotism, independence, self-defense. Tell's status as the preeminent national symbol of Switzerland is, however, relatively new. While enlightened reformers of the eighteenth century cultivated the image of Tell for patriotic purposes, it was, in fact, during the French occupation of Switzerland that Wilhelm Tell emerged as a national symbol.