Perspektiven Fur Die Hauptregionen
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
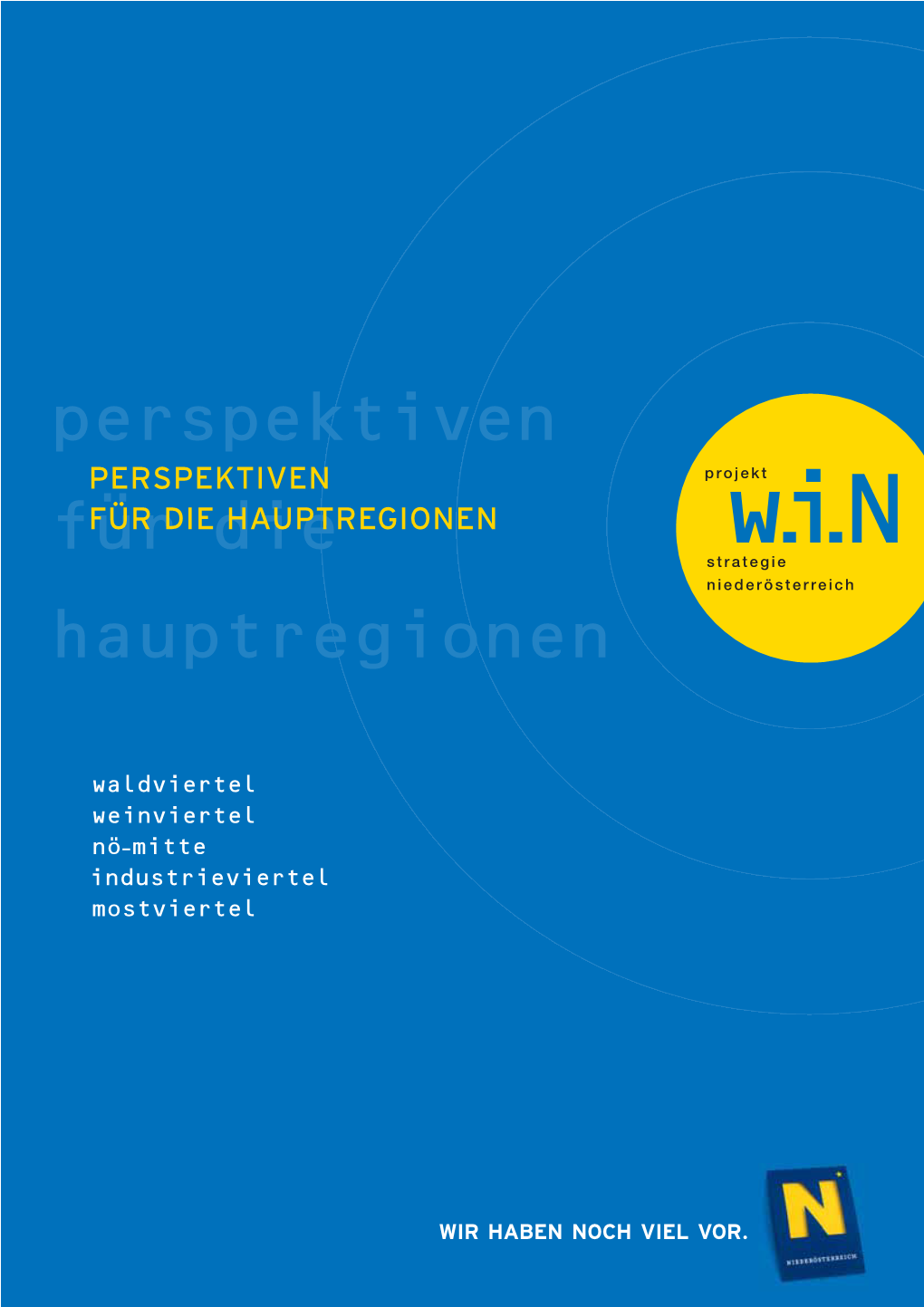
Load more
Recommended publications
-

Aufteilung Gemeinden Niederösterreich
Gemeinde Förderbetrag Krems an der Donau 499.005 St. Pölten 1.192.215 Waidhofen an der Ybbs 232.626 Wiener Neustadt 898.459 Allhartsberg 38.965 Amstetten 480.555 Ardagger 64.011 Aschbach-Markt 69.268 Behamberg 60.494 Biberbach 41.613 Ennsdorf 54.996 Ernsthofen 39.780 Ertl 23.342 Euratsfeld 48.110 Ferschnitz 31.765 Haag 101.903 Haidershofen 66.584 Hollenstein an der Ybbs 31.061 Kematen an der Ybbs 47.906 Neuhofen an der Ybbs 53.959 Neustadtl an der Donau 39.761 Oed-Oehling 35.097 Opponitz 18.048 St. Georgen am Reith 10.958 St. Georgen am Ybbsfelde 51.812 St. Pantaleon-Erla 47.703 St. Peter in der Au 94.276 St. Valentin 171.373 Seitenstetten 61.882 Sonntagberg 71.063 Strengberg 37.540 Viehdorf 25.230 Wallsee-Sindelburg 40.446 Weistrach 40.557 Winklarn 29.488 Wolfsbach 36.226 Ybbsitz 64.862 Zeillern 33.838 Alland 47.740 Altenmarkt an der Triesting 41.057 Bad Vöslau 219.013 Baden 525.579 Berndorf 167.262 Ebreichsdorf 199.686 Enzesfeld-Lindabrunn 78.579 Furth an der Triesting 15.660 Günselsdorf 32.320 Heiligenkreuz 28.766 Hernstein 28.192 Hirtenberg 47.036 Klausen-Leopoldsdorf 30.525 Kottingbrunn 137.092 Leobersdorf 91.055 Mitterndorf an der Fischa 45.259 Oberwaltersdorf 79.449 Pfaffstätten 64.825 Pottendorf 125.152 Pottenstein 54.330 Reisenberg 30.525 Schönau an der Triesting 38.799 Seibersdorf 26.619 Sooß 19.511 Tattendorf 26.674 Teesdorf 32.727 Traiskirchen 392.653 Trumau 67.509 Weissenbach an der Triesting 32.005 Blumau-Neurißhof 33.690 Au am Leithaberge 17.474 Bad Deutsch-Altenburg 29.599 Berg 15.938 Bruck an der Leitha 145.163 Enzersdorf an der Fischa 57.236 Göttlesbrunn-Arbesthal 25.915 Götzendorf an der Leitha 39.040 Hainburg a.d. -
Wiener Neustadt in MOTION!
Wiener Neustadt Discover. Experience. Live. CITY IN MOTION! ATTRACTIONS AND TOURS EVERYTHING IS NEW IN WIENER NEUSTADT The birthplace of Emperor Maximilian I, Wiener Neustadt is of great historical significance. The history of Wiener Neustadt, spanning centu- ries, is so exciting that it is quite surprising that the gates to the important sights were not opened much earlier. However, because of this, the Lower Austrian Provincial Exhibition 2019 sparked an CONTENTS initial, veritable rush to visit these, difficult to access, historical locations. Here you will find a complete overview of the Attractions ...........................................Page 4 sights and museums of Wiener Neustadt. Freely accessible highlights ................... Page 15 Culinary delights are not to be neglected either. Museums .............................................Page 18 Wiener Neustadt has an extraordinary variety of bars and restaurants to offer: from the rustic Getting there and parking ...................... Page 28 Stadtheurigen to the Beisl and Gasthaus with Useful contacts ....................................Page 32 everything to home-style cooking to top level cui- Town map .............................................Page 34 sine. Numerous coffee houses line the entire city center, inviting you to linger. 2 3 SIGHTSEEING THERESIAN MILITARY ACADEMY The castle was built about 50 years after the city was founded in 1192 as a military base for the last Babenberger, Friedrich II. Over the centuries the castle has been expanded and been given various new purposes. Emperor Friedrich III. had the castle fundamentally rebuilt, largely giving it its current appearance. Emperor Maximilian I was born and baptized in the castle in Wiener Neustadt and spent his youth here. From here the Holy Roman Empire was expanded. The empire grew so large that “the sun never set“. -

Investitionen Für Die Menschen Und Den Wirtschaftsstandort
VERFÜGBAR KEIT NUr mit modernen, leistUngsfähigen Und sicheren AUtobahnen Und Schnellstraßen ist es möglich, dem steigenden Mobilitätsbedürfnis gerecht zU werden Und die Basis für eine wirtschaftliche EntwicklUng zU legen. Der AUsbaU des Netzes erfolgt dem Bedarf entsprechend, SanierUngen müssen möglichst ohne große EinschränkUngen für den Verkehr dUrchgeführt werden. Fast staUfreie BaUstellen in Rekordzeit – wie zUm Beispiel beim NeUbaU der A 23 Hochstraße Inzersdorf – Und gUt informierte KUndinnen Und KUnden tragen zUr ErreichUng dieser Ziele bei. Investitionen für die Menschen Und den Wirtschaftsstandort Die ASFINAG investiert in das AUtobahnen- Und AUtobahn, die UmfahrUng Drasenhofen als Schnellstraßennetz jedes Jahr bis zU eine VerlängerUng der A 5 Nord AUtobahn Und aUch Milliarde EUro, 2018 waren es rUnd 935 Millionen die zweite Röhre des KarawankentUnnels an der EUro. A 11 Karawanken AUtobahn in Kärnten. Eine EntlastUng von Wohngebieten, eine Abgeschlossen ist der dreispUrige AUsbaU der A bessere ErschließUng von Regionen Und aUch 1 West AUtobahn von Matzleinsdorf bis Pöchlarn, mehr Kapazitäten dort, wo sie notwendig sind: womit diese zwischen SteinhäUsl vor Wien Und Die Investitionen in die InfrastrUktUr sollen den dem VoralpenkreUz in Oberösterreich Menschen Und der Wirtschaft in Österreich dUrchgehend verbreitert ist. nützen. Zahlreiche große Projekte wUrden im Weitere Informationen Vorjahr mit diesen ZielrichtUngen gestartet, darUnter in Linz zwei zUsätzliche Brücken zUr (https://www.asnag.at/verkehrssicherheit/bauen/) Voestbrücke an der A 7 Mühlkreis Wir haben 2018 zU gleichen Teilen in neUe Strecken Und in die ErhaltUng Unseres Netzes investiert. Damit garantieren wir eine langlebige InfrastrUktUr Und sorgen dafür, dass der Verkehr nicht mehr dUrch Städte Und Gemeinden, sondern aUf sicheren AUtobahnen- Und Schnellstraßen rollt. -

AGREEMENT Between the European Community and the Republic Of
L 28/4EN Official Journal of the European Communities 30.1.2002 AGREEMENT between the European Community and the Republic of South Africa on trade in wine THE EUROPEAN COMMUNITY, hereinafter referred to as the Community, and THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA, hereinafter referred to as South Africa, hereinafter referred to as the Contracting Parties, WHEREAS the Agreement on Trade, Development and Cooperation between the European Community and its Member States, of the one part, and the Republic of South Africa, of the other part, has been signed on 11 October 1999, hereinafter referred to as the TDC Agreement, and entered into force provisionally on 1 January 2000, DESIROUS of creating favourable conditions for the harmonious development of trade and the promotion of commercial cooperation in the wine sector on the basis of equality, mutual benefit and reciprocity, RECOGNISING that the Contracting Parties desire to establish closer links in this sector which will permit further development at a later stage, RECOGNISING that due to the long standing historical ties between South Africa and a number of Member States, South Africa and the Community use certain terms, names, geographical references and trade marks to describe their wines, farms and viticultural practices, many of which are similar, RECALLING their obligations as parties to the Agreement establishing the World Trade Organisation (here- inafter referred to as the WTO Agreement), and in particular the provisions of the Agreement on the Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (hereinafter referred to as the TRIPs Agreement), HAVE AGREED AS FOLLOWS: Article 1 Description and Coding System (Harmonised System), done at Brussels on 14 June 1983, which are produced in such a Objectives manner that they conform to the applicable legislation regu- lating the production of a particular type of wine in the 1. -

Neubau Bauliche Erhaltung Planung
ASFINAG Straßenbau Seite 1 von 2 Neubau Nr. Autobahn / Schnellstraße A 2 Süd Autobahn Bad St. Leonhard - Wolfsberg Nord A 2 Süd Autobahn Mooskirchen - Modriach A 3 Südost Autobahn Abschnitt Ebreichsdorf Nord - Pottendorf A 6 Nordost Autobahn Spange A 4 - Kittssee A 9 Pyhrn Autobahn Lainbergtunnel A 10 Tauern Autobahn 2. Röhre Katschbergtunnel A 10 Tauern Autobahn 2. Röhre Tauerntunnel A 10 Tauern Autobahn Umweltentlastungsmaßnahmen A 12 Inntal Autobahn Ast. Innsbruck Mitte A 12 Inntal Autobahn Roppener Tunnel - 2.Röhre A 22 Donauufer Autobahn Verlängerung Nordbrücke A 23 Südosttangente Bereich St.Marx S 1 Wiener Außenring Schnellstraße Vösendorf - Schwechat S 6 Semmering Schnellstraße Ganzsteintunnel S 16 Arlberg Schnellstraße Arlberg Strassentunnel S 35 Brucker Schnellstraße Stausee Zlatten - Röthelstein Bauliche Erhaltung Nr. Autobahn / Schnellstraße A 2 Süd Autobahn Vösendorf - Gruntramsdorf A 2 Süd Autobahn Klagenfurt See - Pörtschach Ost A 4 Ost Autobahn Bereich Neusiedl A 9 Pyhrn Autobahn Bereich Bosruck A 9 Pyhrn Autobahn Bereich Gleinalm A 9 Pyhrn Autobahn Graz Webling bis Knoten Graz West A 9 Pyhrn Autobahn Schoberpass A 10 Tauern Autobahn Gmünd - Knoten Spittal/Millstättersee A 13 Brenner Autobahn Luegbrücke A 22 Donauufer Autobahn Korneuburg - Stockerau S 6 Semmering Schnellstraße Knoten Seebenstein-Gloggnitz S 36 Murtal Schnellstraße Murbrücke Grünhübl Planung Nr. Autobahn / Schnellstraße A 3 Südost Autobahn Knoten Eisenstadt - Klingenbach A 5 Nord Autobahn Eibesbrunn - Schrick A 5 Nord Autobahn Schrick - Poysbrunn A 5 Nord -

DRUIDENWEG YSPERKLAMM Tour
Fischereimöglichkeit. samt Charme 551 m/820 m m/820 551 Punkt: Tiefster/Höchster Das alles erwartet Sie im Hallenbad Yspertal. Hallenbad im Sie erwartet alles Das Erwachsenen. Erwachsenen. Am Campus 1, 3683 Yspertal 3683 1, Campus Am www.hluwyspertal.ac.at DICH Römische Wärmekammer, Solarium und eine separate Saunawelt für die die für Saunawelt separate eine und Solarium Wärmekammer, Römische (teilweise anspruchsvolle Stufen, Stege) Stufen, anspruchsvolle (teilweise Ein frei zugänglicher Naturbadeteich mit Waldviertler Waldviertler mit Naturbadeteich zugänglicher frei Ein Die Umwelt braucht Umwelt Die 32 Grad warmes Wasser, eine Wasserrutsche für die Kinder, Dampfbad, Dampfbad, Kinder, die für Wasserrutsche eine Wasser, warmes Grad 32 Waldweg Streckencharakteristik: Puschacherteich zukunftsorientierten Ausbildung zukunftsorientierten Gehzeit: 1,5 – 2 Stunden 2 – 1,5 Gehzeit: Die Privatschule, mit der mit Privatschule, Die www.hallenbad-yspertal.at 4 km (Auf- und Abstieg); und (Auf- km 4 Streckenlänge: Ausbildungszentrums. Sauna Umwelt und Wirtschaft und Umwelt für für e. 41 473 74 / 15 74 0 Tel.: Gasthaus Forellenhof, Eingang zur Klamm zur Eingang Forellenhof, Gasthaus Ausgangspunkt: 3683 Yspertal 3683 Höhere Lehranstalt Höhere Austoben, Tennis- und Beachvolleyballplätzen – südlich des des südlich – Beachvolleyballplätzen und Tennis- Austoben, Ysperklamm Tour Badgasse 3 Badgasse Landschaftsteich zum Entspannen und Spielgeräten zum zum Spielgeräten und Entspannen zum Landschaftsteich Ein attraktiver Treffpunkt für Spiel, Spaß und Bewegung, mit mit Bewegung, und Spaß Spiel, für Treffpunkt attraktiver Ein Wir empfehlen Wanderschuhe mit rutschfester Sohle! rutschfester mit Wanderschuhe empfehlen Wir www.hallenbad-yspertal.at www.prannleithen.at Generationenpark [email protected] [email protected] rung und der Lichtverhältnisse. der und rung Tel.: +43 7415 7473 7415 +43 Tel.: Tel.: +43 680 302 27 88 27 302 680 +43 Tel.: - Wasserfüh der Jahreszeiten, der Wechselspiel im - Klamm biente erleben. -

SERVICEHEFT 2016 Wir Wünschen Gute Fahrt! Besuchen Sie Uns Auf
SERVICEHEFT 2016 Wir wünschen gute Fahrt! Besuchen Sie uns auf: und asfi nag.at Inhalt Infos auf einen Blick ................................... 4 Maut auf Autobahnen/Schnellstraßen Das aSFINAG Service Center .................... 6 Maut sichert ausbau und Betrieb .............24 Österreichs autobahnen/Schnellstraßen .. 7 Vignettenpflicht für Kfz bis 3,5 t hzG .........25 Das macht die aSFINAG ............................ 9 Vignettentypen ..........................................26 Für Sie rund um die Uhr im Einsatz ...........10 tarife für Kfz bis 3,5 t hzG ..........................28 anbringen der Vignette .............................29 Verkehrssicherheit auf Autobahnen/Schnellstraßen Vignettenverkaufsstellen .......................... 30 Verkehrssicherheit hat oberste Priorität ....12 Sondermaut für Kfz bis 3,5 t hzG ..............31 Passen Sie Ihre Geschwindigkeit an .........13 Bezahlen der Sondermaut.........................32 nebel, hagel, Regen und Schnee .............14 Unterwegs auf Autobahnen/Schnellstraßen Keine Chance dem Sekundenschlaf .........15 aSFINAG Verkehrsinformationen ............. 36 Reisen mit Kindern ....................................16 Rastmöglichkeiten .....................................37 Gurte und Kindersitze retten leben ..........17 aSFINAG Rastplätze ................................ 38 Verhalten bei Pannen, Unfällen, Bränden ..18 Raststationen ............................................41 Zu Ihrer Sicherheit im tunnel .....................19 Überwachung der Geschwindigkeit ......... 46 Sicherheitshinweise -

Bericht NR (Gescanntes Original) 1 Von 6
213 der Beilagen XVIII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 1 von 6 213 der Beilagen zu den Steno graphischen Protokollen des Nationalrates XVIII. GP Bericht des Finanzausschusses über den Antrag (192/A) der Abgeordneten notwenigen Maßnahmen dennoch durchzuführen, Brennsteiner, Auer und Genossen betreffend bedarf es einer außerbudgetären Finanzierung. In ein Bundesgesetz, mit dem das ASFINAG-Ge der vorliegenden ASFINAG-Gesetz-Novelle wird setz 1982, BGBl. Nr.591, zuletzt geändert eine ausgewogene Erhöhung des Haftungsrahmens durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 136/1989, des Bundes um 12 Milliarden Schilling auf 77,4 Mil geändert wird (ASFINAG-Gesetz-NoveUe liarden Schilling an Kapital und ebensoviel an 1991) Zinsen und Kosten vorgenommen. Mit dieser Erhöhung des Haftungsrahmens Die Abgeordneten Brennsteiner, Auer und können neben den bereits durch die ASFINAG-No Genossen haben am 20. Juni 1991 den gegenständli• velle 1988, BGBL Nr. 235, an die Tauernautobahn chen Antrag im Nationalrat eingebracht und wie AG zur Errichtung und damit an die ASFINAG zur folgt begründet: Finanzierung übertragenen Bundesstraßenstrecken, insbesondere die im wesentlichen noch nicht begonnenen Bundesstraßenstrecken Umfahrung "I. Straßenbau : Klagenfurt der A 2 Süd Autobahn, Umfahrung Zell/See der B 311 Pinzgauer Straße und Umfah 1. Nach den Erfordernissen des Vekehrs und zur rung Lofer der B 311/B 312 Loferer Straße, auch Ermöglichung einer entsprechenden Infrastruktur neue Strecken errichtet werden. Es handelt sich sind - entsprechend dem gesetzlichen Auftrag des hiebei um die A 4 OSt Autobahn zwischen Parndorf Bundesstraßengesetzes - wesentliche und drin (B 50) und der Staats grenze bei Nickelsdorf (Art. I gende Ausbauten im hochrangigen Straßennetz Z 7) und um die A 9 Pyhrn Autobahn zwischen durchzuführen, die bedeutende Mittel erfordern. -

Stellungskundmachung 2020 NÖ
M I L I T Ä R K O M M A N D O N I E D E R Ö S T E R R E I C H Ergänzungsabteilung: 3101 St. PÖLTEN, Kommandogebäude Feldmarschall Hess, Schießstattring 8 Parteienverkehr: Mo-Do von 0800 bis 1400 Uhr und Fr von 0800 bis 1200 Uhr Telefon: 050201/30, Fax: 050201/30-17410 E-Mail: [email protected] STELLUNGSKUNDMACHUNG 2020 Auf Grund des § 18 Abs. 1 des Wehrgesetzes 2001 (WG 2001), BGBl. I Nr. 146, haben sich alle österreichischen Staatsbürger männlichen Geschlechtes des G E B U R T S J A H R G A N G E S 2 0 0 2 sowie alle älteren wehrpflichtigen Jahrgänge, die bisher der Stellungspflicht noch nicht nachgekommen sind, gemäß dem unten angeführten Plan der Stellung zu unterziehen. Österreichische Staatsbürger des Geburtsjahrganges 2002 oder eines älteren Geburtsjahrganges, bei denen die Stellungspflicht erst nach dem in dieser Stellungskundma- chung festgelegten Stellungstag entsteht, haben am 16.12.2020 zur Stellung zu erscheinen, sofern sie nicht vorher vom Militärkommando persönlich geladen wurden. Für Stellungspflichtige, welche ihren Hauptwohnsitz nicht in Österreich haben, gilt diese Stellungskundmachung nicht. Sie werden gegebenenfalls gesondert zur Stellung auf- gefordert. Für die Stellung ist insbesondere Folgendes zu beachten: 1. Für den Bereich des Militärkommandos NIEDERÖSTERREICH werden die Stellungspflichtigen durch die 3. Bei Vorliegen besonders schwerwiegender Gründe besteht die Möglichkeit, dass Stellungspflichtige auf ihren An- Stellungskommission NIEDERÖSTERREICH der Stellung unterzogen. Das Stellungsverfahren nimmt in der Regel trag in einem anderen Bundesland oder zu einem anderen Termin der Stellung unterzogen werden. 1 1/2 Tage in Anspruch. -

Baustart Für Neue Autobahnmeisterei Bruck an Der Leitha
PRESSE Baustart für neue Autobahnmeisterei Bruck an der Leitha Im Fokus: Optimales Service für Nutzerinnen und Nutzer der A 4 Ost Autobahn und der A 6 Nordost Autobahn Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft | A-1011 Wien, Rotenturmstraße 5-9 Postfach 983 | Tel.: +43 (0) 50 108 10000 | Tel.: +43 (0) 50 108 10020 | [email protected] | www.asfinag.at Modernste Infrastruktur für High-Level Service • Ab 2019: neue Autobahnmeisterei in Bruck an der Leitha auf dem letzten Stand der Technik • Die 82 Autobahnkilometer der A 4 und der A 6 werden zukünftig zentral vom neuen Betriebsstandort betreut • Die derzeitigen Autobahnmeistereien Parndorf und Schwechat werden aufgelassen Ihre Gesprächspartnerin/Ihre Gesprächspartner: • Hans NIESSL, Landeshauptmann Burgenland • Ludwig SCHLERITZKO, Landesrat für Finanzen und Mobilität Niederösterreich – in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner • Mag. Hans Peter DOSKOZIL, Landesrat für Kultur, Infrastruktur und Finanzen Burgenland • Mag.a Karin ZIPPERER, Vorstandsdirektorin ASFINAG • Dr. Klaus SCHIERHACKL, Vorstandsdirektor ASFINAG • DI Andreas FROMM, Geschäftsführer ASFINAG Bau Management GmbH • Dr. Josef FIALA, Geschäftsführer ASFINAG Service GmbH • Mag. Helmut MIERNICKI, Geschäftsführer ecoplus • Richard HEMMER, Bürgermeister der Gemeinde Bruck an der Leitha ASFINAG Autobahnmeisterei in Bruck: zentraler Standort für Top- Betreuung der A 4 und der A 6 Noch vor der Wintersaison 2019/2020 eröffnet die ASFINAG für die A 4 Ost Autobahn und die A 6 Nordost Autobahn eine neue, hochmoderne Autobahnmeisterei bei Bruck an der Leitha. Damit werden auf knapp drei Hektar die beiden derzeit noch bestehenden Standorte Parndorf im Burgenland und Schwechat in Niederösterreich zusammengefasst. Die 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betreuen zukünftig die 82 Autobahnkilometer der A 4 ab der Landesgrenze Wien/Niederösterreich sowie der A 6 zentral, von nur einem Betriebsstützpunkt aus. -

Region Region
Lernende Bildungskalender Region Erwachsenenbildung in der Region Kursprogramm Herbst 2015 September 2015 – Jänner 2016 I QualifizierungI Sprachen I EDV I Senioren I Kinder und Familie Südliches Waldviertel I Kochen I Naturschule I Gesundheit und Bewegung I Körper Nibelungengau und Seele I Kreativ und Handwerk I Tanz und Musik I Vorträge Hofamt Priel Mühldorf Ybbs Marbach Yspertal Pöggstall Golling Nöchling St. Oswald Bärnkopf Krummnußbaum Persenbeug-Gottsdorf Münichreith / Laimbach Schönbach Ottenschlag Pöchlarn Raxendorf Maria Taferl Weiten Albrechtsberg Erlauf Hauptstraße 9, 3683 Yspertal E-mail: [email protected] Tel. 07415/6767-30 www.lernenderegion.at An einen Haushalt Post.at durch Zugestellt Lernen mit einem Lächeln SA 10.10.15, 20.00 Uhr Kultursaal Albrechtsberg Albrechtsberg pholc - Irish Night Kartenvorverkauf: Raika-Filialen und www.ticketgarden.com Bärnkopf 3. Waldviertler Museumstag SO 20.09.15, 14.00 – 18.00 Uhr Holzhackermuseum Tourismusbüro Bärnkopf, 0 28 74 / 84 01, [email protected] Brotbacken, Zugsägeschneiden, Rätselralley für Groß und Klein Maria Taferl Käsemarkt SO 25.10.15, ab 08.00 Uhr Ottenschlag Schlosscafé jeden DO, von 14.00 - 18.30 Uhr (ausgenommen Feiertage) Von den Schülerinnen und Schülern des 2. Jahrganges betreut. Fachschule Schloss Ottenschlag Tag der offenen Tür Infos über die Ausbildungsschwerpunkte der Fachschule. FR 06.11.15 Lehrabschluss Koch/Köchin und Restaurantfachmann/frau. Fachschule Schloss Ottenschlag Veranstaltungen Advent im Schloss Zum 11. Mal findet heuer der Adventmarkt -

Moving Wachau, © Robert Herbst
REFRESHINGLY moving Road map of Lower Austria, with tips for visitors WWW.LOWER-AUSTRIA.INFO Mostviertel, © Robert Herbst Mostviertel, Welcome! “With this map, we want to direct you to the most beautiful corners of Lower Austria. As you will see, Austria‘s largest federal state presents itself as a land of diversity, with a wide variety of landscapes for refreshing outdoor adventures, great cultural heritage, world-class wines and regional specialities. All that’s left to say is: I wish you a lovely stay, and hope that your time in Lower Austria will be unforgettable!” JOHANNA MIKL-LEITNER Lower Austrian Governor © NLK/Filzwieser “Here you will find inspiration for your next visit to, or stay in, Lower Austria. Exciting excursion destinations, varied cycling and mountain biking routes, and countless hiking trails await you. This map also includes lots of tips for that perfect stay in Lower Austria. Have fun exploring!” JOCHEN DANNINGER Lower Austrian Minister of Economics, Tourism and Sports © Philipp Monihart Wachau, © Robert Herbst Wachau, LOWER AUSTRIA 2 national parks in numbers Donau-Auen and Thaya Valley. 1 20 Vienna Woods nature parks years old is the age of the Biosphere Reserve. in all regions. Venus of Willendorf, the 29,500 world’s most famous figurine. fortresses, castles 70 and ruins are open to visitors. 93 centers for alpine abbeys and monasteries have “Natur im Garten” show gardens 9 adventure featuring 15 shaped the province and ranging from castle and monastic summer and winter its culture for centuries, gardens steeped in history sports. Melk Abbey being one to sweeping landscape gardens.