Lou Scheper-Berkenkamp
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
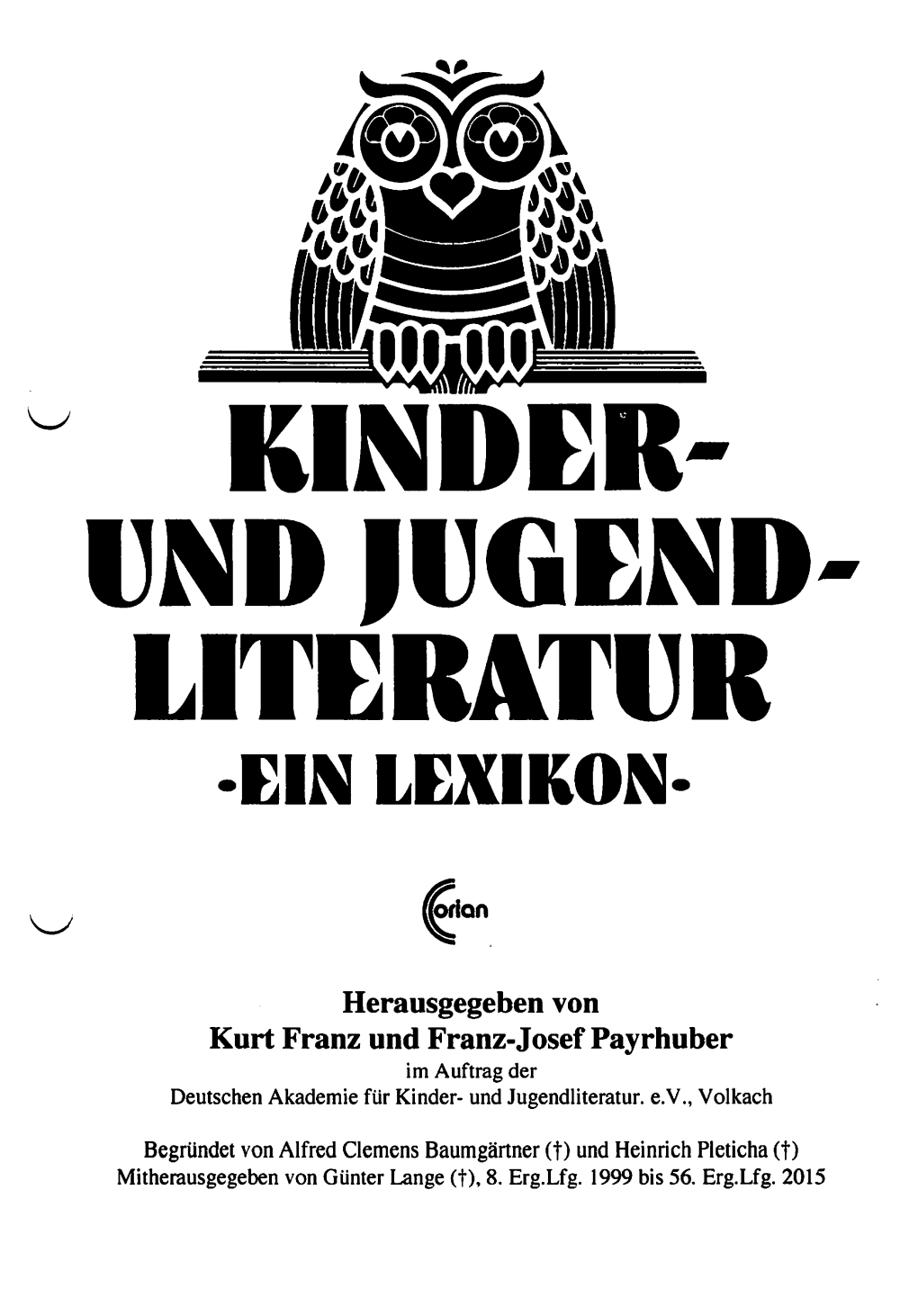
Load more
Recommended publications
-

Nachlass Der Bauhäusler Hinnerk Und Lou Scheper Für Berlin Gesichert
Pressemeldung Nachlass der Bauhäusler Hinnerk und Lou Scheper für Berlin gesichert Lotto-Stiftung Berlin ermöglicht Ankauf der Arbeiten und Dokumente von Hinnerk und Lou Scheper durch das Bauhaus-Archiv / Museum für Gestaltung Mit Unterstützung der Lotto-Stiftung kann der Nachlass des Künstlerehepaares Hinnerk und Lou Scheper in Berlin gehalten werden. Mit einer Förderung in Höhe von 1,185 Mio. Euro ermöglicht die Lotto-Stiftung dem Bauhaus-Archiv / Museum für Gestaltung in Berlin den Erwerb des umfassen- den Erbes von Hinnerk und Lou Scheper und sichert es für Berlin. In seiner dritten Sitzung 2016 hatte der Stiftungsrat der Lotto-Stiftung Berlin unter Vorsitz des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller am 5. Oktober 2016 insgesamt 18,5 Millionen Euro ausgeschüttet. Berlin, 06.10.16. Die Künstler Hinnerk und Lou Scheper haben das Bauhaus entscheidend geprägt. Darü- ber hinaus hatten sie einen entscheidenden Anteil an der künstlerischen und denkmalpflegerischen Ent- wicklung Berlins in den Nachkriegsjahren. Zum einzigartigen Nachlass des Paares gehören Farbgestal- tungen, Zeichnungen, Druckgrafiken, Fotografien, Möbel, Designobjekte, Dokumente und Korresponden- zen sowie eine umfassende Bibliothek mit seltenen Ausstellungskatalogen, Broschüren und Zeitschriften der 1920er-Jahre. „Dank der großzügigen Förderung der Lotto-Stiftung Berlin wird es uns möglich, den großartigen Nachlass von Hinnerk und Lou Scheper – zwei der bedeutendsten Vertreter des Bauhauses – dauerhaft für das Bauhaus-Archiv und damit für die Forschung und für die Öffentlichkeit zu sichern“, freut sich Dr. Annemarie Jaeggi, Direktorin des Bauhaus-Archiv / Museum für Gestaltung. „Wir danken allen Unterstützern für die große Wertschätzung unserer Arbeit.“ Der Nachlass Hinnerk und Lou Scheper Sowohl Hinnerk als auch Lou Scheper zählen zu zentralen Persönlichkeiten am Bauhaus. -

Dessau: Höhepunkt Der Ästhetik in Der Industrie-Epoche - Das Bauhaus Und Seine Bauten
• • Dessau: Höhepunkt der Ästhetik in der Industrie-Epoche - das Bauhaus und seine Bauten Weitreichender Zusammenhang. In Bei der Wiedereröffnung des Bau Dessau hatte in der zweiten Hälfte des hauses in den 80er Jahren wird der Zu 18. Jahrhundert ein aufgeklärter Klein sammenhang zwischen Gartenreich und fürst eine vielbewunderte Gesellschafts- Bauhaus erneut diskutiert. Der Begriff Utopie geschaffen: eine Synthese von „Industrielles Gartenreich“ entsteht. Empfindung und Vernunft, sozialem und In diesem Diskurs ergeben sich Ver kulturellem Verhalten, Nutzen und Schön bindungen zur IBA-Berlin / Strategien heit. für Kreuzberg (Hardt-Walther Hämer) Davon ist vieles mental lebendig, als und der IB A-Emscher Park im Ruhrgebiet das Bauhaus 1925 nach Dessau kommt. (Karl Ganser, Gerhard Seitmann). Der ge meinsame Faden ist die Begleitung des in dustriellen Struktur-Wandels: in einer Synthese von Potential-Denken und Ge stalten. In diesem Kontext entwickelt die Landesregierung 1996 eine Strategie: es entsteht eine Agentur zur Entwicklung der regionalen Struktur. Verknüpft mit dem Gedanken an die Expo Hannover heißt dieses umfangreiche Projekt-Paket (S. 596): Expo 2000 Sachsen-Anhalt. Das Drama der Vorge schichte: Aufstieg und Fall des Bauhauses in Weimar Walter Gropius gründet 1919 das Bau haus. Er ist seit 1910 Mitglied im Deut schen Werkbund - ebenso wie der künst lerische Berater der Zukunfts-Industrie, des Elektrizitäts-Konzerns AEG, Peter Behrens. Behrens entwickelte aus indu striellen Materialien und Prozessen eine Lyonei Feininger: Kathedrale des Sozialismus eigene Ästhetik der Industrie. 1908 bis (1919, Holzschnitt) 1910 war Gropius im Atelier von Beh- rens tätig, vor allem als Architekt. Er sog tag. Die „Weimarer Künstlerschaft“ for dort neue Ideen ein. -

The Bauhaus 1 / 70
GRAPHIC DESIGN HISTORY / THE BAUHAUS 1 / 70 The Bauhaus 1 Art and Technology, A New Unity 3 2 The Bauhaus Workshops 13 3 Origins 26 4 Weimar 45 5 Dessau 57 6 Berlin 68 © Kevin Woodland, 2020 GRAPHIC DESIGN HISTORY / THE BAUHAUS 2 / 70 © Kevin Woodland, 2020 GRAPHIC DESIGN HISTORY / THE ARTS & CRAFTS MOVEMENT 3 / 70 1919–1933 Art and Technology, A New Unity A German design school where ideas from all advanced art and design movements were explored, combined, and applied to the problems of functional design and machine production. © Kevin Woodland, 2020 Joost Schmidt, Exhibition Poster, 1923 GRAPHIC DESIGN HISTORY / THE BAUHAUS / Art and TechnoLogy, A New Unity 4 / 70 1919–1933 The Bauhaus Twentieth-century furniture, architecture, product design, and graphics were shaped by the work of its faculty and students, and a modern design aesthetic emerged. MEGGS © Kevin Woodland, 2020 GRAPHIC DESIGN HISTORY / THE BAUHAUS / Art and TechnoLogy, A New Unity 5 / 70 1919–1933 The Bauhaus Ideas from all advanced art and design movements were explored, combined, and applied to the problems of functional design and machine production. MEGGS • The Arts & Crafts: Applied arts, craftsmanship, workshops, apprenticeship • Art Nouveau: Removal of ornament, application of form • Futurism: Typographic freedom • Dadaism: Wit, spontaneity, theoretical exploration • Constructivism: Design for the greater good • De Stijl: Reduction, simplification, refinement © Kevin Woodland, 2020 GRAPHIC DESIGN HISTORY / THE BAUHAUS / Art and TechnoLogy, A New Unity 6 / 70 1919–1933 -

Photo Credits Chapter Illustrations
Photo Credits If not indicated otherwise, the pictures were provided by the authors. Bauhaus Archiv, Berlin: p. 154, p. 156 bottom, p. 157 Chan-Magomedov, Selim: Pioniere der sowjetischen Architektur, Dresden 1983, p. 267 Dill, Alex, Darmstadt: p. 24, p. 36, p. 48, p. 49, p. 62 Dushkina, Natalya, Moscow: p. 45, p. 74 bottom Ginzburg, Mosey, zhilische, Moscow 1934: p. 53, p. 144 middle Gozak, Andrey, Moscow: p. 68 Institut für Regional- und Strukturplanung IRS, Erkner, left bottom: p. 40 right top Kudryavtsev, Alexander, Dushkina Natalia (eds): 20th Century. Preservation of Cultural Heritage. Moscow 2006: p. 71, p. 151: Landesdenkmalamt Berlin / archive: p. 129, p. 132, p. 133 Landesdenkmalamt Berlin / Wolfgang Bittner / Wolfgang Reuss: p. 143 top, p. 172, p. 173, p. 174 Miskowiec, Jolanta; Warsaw: p. 40: left top Mosproject 2, Moscow: p. 142 top, p. 152 top Scheper, Dirk, Berlin: p. 138, p. 156 top Schusev State Museum of Architecture, Moscow: p. 26 bottom, p. 28, p. 43, p. 44, p. 69 bottom, p. 141, p. 162, p. 164 Seegers, Bernd, Shanghai: p. 40 left buttom Stadtarchiv Dessau: p. 104 bottom Stiftung Bauhaus Dessau: p. 104, p. 105, p. 106, p. 108 –111, Martin Brück: p. 103 Stiftung Welterbestätte Zeche Zollverein Essen/Walter Busch: p. 102 Stubbs, John, New York: p. 14, p. 52 Studentische Initiative Kabelfabrik FHTW Berlin: p. 175 Winfried Brenne Architekten, Berlin: p. 130, p.136, p.141 left, p. 147, p. 148, p. 149, p. 150 Zalivako, Anke, Berlin: p. 26 top, p. 37 bottom, p. 54, p. 55, p. 56, p. 57, p. -

Hinnerk Scheper Und Boris Ender Im Maljarstroj
Wissenschaftliche Zeitschrift der Hochschule für Architektur und Bauwesen Weimar 26. Jahrgang 1 1979 1 Heft 4/5 Larissa A. Shadowa Hinnerk Scheper und Boris Ender im Maljarstroj über Verbindungen von Mitarbeitern des Bauhauses und sowjetischen Künstlern In der Geschichte der wechselseitigen Verbindungen der Mit naher praktischer Aufgaben zu verbinden, indem sie in diesem arbeiter des Bauhauses und der Vertreter der sowjetischen Fall die Produktion hochwertiger Farben auf eine reale ma künstlerischen Kultur ist die Zusammenarbeit von H. Scheper terielle Basis stellten. Deshalb betrachteten sie die Aufgabe und B. Ender im Maljarstroj in Moskau (1930-31) nur eine der Farbgebung in der Architektur komplex, sowohl als künst• kleine Episode, die jedoch ihre Spur in den Menschen und lerische als auch als bautechnologische Aufgabe und als Pro ihrer schöpferischen Tätigkeit hinterlassen hat. blem der Farbenchemie. Die Wahl von Scheper als Berater Es trafen sich zwei Künstler: der eine - Schüler von Johan von Maljarstroj zu Problemen der Farbgestaltung erklärt sich nes Itten, der andere - von M. Matjuschin. Itten und Matju auch durch das Programm dieser Organisation, das auf eine schin waren Maler, die in die Geschichte der künstlerischen organische VerschmelZl\Jng künstlerischer und produktiver Tä• Kultur des 20. Jahrhunderts vor allem als Pädagogen und als ügkeit gerichtet war. Schöpfer origineller Farbsysteme eingegangen sind. Sowohl die Denn Scheper gehörte zu den ersten A!bsolventen des Bau Pädagogik Ittens als auch sein Farbsystem erhielten schon hauses (1919-22), und er erhielt gleichzeitig eine künstlerische längst internationale Anerkennung. Die ganze Bedeutung der und produktive Ausbildung. In seinem Gepäck befand sich die Pädagogik und des Farbsystems von Matjuschin ist nur im Ausbildung im Vorkurs Ittens, im Kurs Paul Klees, die Arbeit Laufe der Zeit voll und ganz zu erschließen. -

Art and Political Ideology : the Bauhaus As Victim
/ART AND POLITICAL IDEOLOGY: THE BAUHAUS AS VICTIM by LACY WOODS DICK A., Randolph-Macon Woman's College, 1959 A MASTER'S THESIS submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree MASTER OF ARTS Department of History KANSAS STATE UNIVERSITY Manhattan, Kansas 1984 Approved by: Donald J. ftrozek A113D5 bSllSfl T4 vM4- c. 3~ TABLE OF CONTENTS Page Preface iii Chapter I Introduction 1 Chapter II The Bauhaus Experience: In Pursuit of the Aesthetic Chapter III The Bauhaus Image: Views of the Outsiders 48 Chapter IV Nazi Culture: Art and Ideology 92 Chapter V Conclusion 119 Endnotes 134 Selected Bibliography 150 -PREFACE- The Bauhaus, as a vital entity of the Weimar Republic and as a concept of modernity and the avant-garde, has been the object of an ongoing study for me during the months I have spent in the History Depart- ment at Kansas State University. My appreciation and grateful thanks go to the faculty members who patiently encouraged me in the historical process: to Dr. Marion Gray, who fostered my enthusiasm for things German; to Dr. George Kren, who closely followed my investigations of both intellectual thought and National Socialism; to Dr. LouAnn Culley who brought to life the nineteenth and twentieth century art world; and to Dr. Donald Mrozek who guided this historical pursuit and through- out demanded explicit definition and precise expression. I am also indebted to the Interlibrary Loan Department of the Farrell Library who tirelessly and cheerfully searched out and acquired many of the materials necessary for this study. Chapter I Introduction John Ruskin and William Morris, artist-philosophers of raid-nine- teenth century England, recognized and deplored the social isolation of art with artists living and working apart from society. -

JUN 2 7 2013 JUNE 2013 LIBRAR ES 02013 Mariel A
Life behind ruins: Constructing documenta by Mariel A. Viller6 B.A. Architecture Barnard College, 2008 SUBMITTED TO THE DEPARTMENT OF ARCHITECTURE IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF ARCHVES MASTER OF SCIENCE IN ARCHITECTURE STUDIES MASSACHUSETTS INSTTE AT THE OF TECHNOLOGY MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY JUN 2 7 2013 JUNE 2013 LIBRAR ES 02013 Mariel A. Viller6. All rights reserved. The author hereby grants MIT permission to reproduce and distribute publicly paper and electronic copies of this thesis document in whole or in part in any medium now known or hereafter created. Signature of Author: Department of Architecture May 23,2013 Certified by: Mark Jarzombek, Professor of the Histo4y 7eory and Criticism of Architecture Accepted by: Takehiko Nagakura, Chair of the Department Committee on Graduate Students 1 Committee Mark Jarzombek,'Ihesis Supervisor Professor of the History, Theory and Criticism of Architecture Caroline Jones, Reader Professor of the History of Art 2 Life behind ruins: Constructing documenta by Mariel A. Viller6 B.A. Architecture Barnard College, 2008 Submitted to the Department of Architecture on May 23,2013 in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Science in Architecture Studies Abstract A transnational index of contemporary art, documenta in its current form is known in the art world for its scale, site-specificity and rotating Artistic Directors, each with their own theme and agenda. On a unique schedule, the expansive show is displayed in Kassel, Germany from June to September every five years. The origins of the exhibition-event are embedded in the postwar reconstruction of West Germany and a regenerative national Garden Show. -

Die Magische Bilderwelt Der Bauhauskünstlerin Lou Scheper-Berkenkamp Von Barbara Murken
Kinderliterarische Themen „Eigentlich sitze ich lieber auf Luftlinien als auf Sesseln ...“ Die magische Bilderwelt der Bauhauskünstlerin Lou Scheper-Berkenkamp von Barbara Murken Das Staatliche Bauhaus, 1919 von dem Archi- zu verlieren, sollten Phantasie und handwerkli- tekten Walter Gropius in Weimar gegründet, ches Experimentieren den Geist des Bauhauses entstand durch die Vereinigung der Hochschule prägen und den Weg in eine zukünftige humane für Bildende Kunst mit der Großherzoglichen Gesellschaft bahnen. Visionärer Schöpfergeist, ge- Kunstgewerbeschule von Sachsen-Weimar. Ab paart mit künstlerischer Funktionalität, sollte die 1926 wurde die Institution in Dessau als Hoch- trennenden sozialen Strukturen der Gesellschaft schule für Gestaltung weitergeführt. Nach einem überwinden und von Grund auf erneuern, war im erneuten Umzug 1932 nach Berlin wurde sie Bauhaus Manifest von 1919 zu lesen. So wurde von den Nationalsozialisten 1933 geschlossen. das Bauhaus in allen Bereichen der bildenden Die neue und revolutionäre Idee der Bauhauses Kunst wie der Architektur, der Malerei und der bestand in der Vision, durch ein gleichzeitiges Fotografie zum Spielfeld für neue Formen, Farben Angebot von Theorie und Praxis die verschiede- und Muster: Junge Künstler aus vielen Nationen nen Ausbildungsstätten für Bildkünstler, Architek- bewarben sich an der Schule und prägten gemein- ten und Handwerker zu vernetzen, Technik und sam mit ihren Meistern eine Kunstepoche, die Kunst in ihren Gegensätzen zu versöhnen und so bis in das 21. Jahrhundert mit ihren kreativen ein modernes „Gesamtkunstwerk“ zu schaffen. In Kräften impulsgebend geblieben ist. Anlehnung an die Bauhüttenideale des Mittel- alters sollten handwerkliche Meisterschaft und Lou Berkenkamp schrieb sich 1920, mit 19 Jah- künstlerische Kreativität im Unterricht gleich- ren, als Kunststudentin am Bauhaus in Weimar wertig vermittelt werden und sich in fruchtbarer ein und war der Institution bis zu seiner Schlie- Synthese ergänzen. -

Eat and Drink the Bauhaus Way. the Thrill of the Authentic
Eat and drink the Bauhaus way. The thrill of the authentic There is nothing quite like finding the “authentic”. That can be visiting places where important things happened and walking in the footsteps of men and women, who changed history. These experiences are special and, for fans of design and architecture, they are easy to find in BauhausLand in 2019. In the German federal states of Thuringia and Saxony-Anhalt, you can explore the cities, where the Bauhaus movement began a century ago. You can walk the lanes, see the buildings – and even eat and drink “the Bauhaus way.” Have a meal in a Bauhaus-designed restaurant; drink a beer on a terrace designed by a Bauhaus architect; bake Bauhaus bread! 50 days to go: The Bauhaus centenary celebrations. 2019 is just around the corner. In 50 days’ time, the “100 Years of Bauhaus” opening festival launches the centenary of the foundation of the Bauhaus (16th – 24th January, 2019; www.bauhausfestival.de/en/). There will be celeb- rations around the world, especially in BauhausLand. Here, in the twin hot- spots of Weimar and Dessau, 2019 is an excuse for one-of-a-kind events, imaginative exhibitions and fun festivals. A calendar of 2019 events is here. And, for anyone planning a special trip in 2019, we have the answers to two of the most popular questions: Where can we eat and where can we drink the Bauhaus way? Weimar: Start where the Bauhaus started. The cradle of modernism is just south of Berlin. At what is now the Bauhaus University, the social hub is the Bauhaus Atelier, the café-shop, where you can join students, sip espressos, munch cookies and chat about design. -

Архитектурное Наследие Авангарда Das Architektonische Erbe Der
А Д Архитектурное нАСЛеДие АВАнГАрДА р А Г Das architektonische erbe Der avantgarDe н АВА е и Д е СЛ А н Архитектурное Архитектурное III V L X S EE T MI O ALK N O I T A N N E CH S UT E D S EFTE DE H · ICOMOS · HEFTE DES DEUTSCHEN NATIONALKOMITEES XLVIII ICOMOS · JOURNALS OF THE GERMAN NATIONAL COMMITTEE XLVIII ICOMOS ICOMOS · CAHIERS DU COMITÉ NATIONAL ALLEMAND XLVIII Архитектурное нАСЛеДие АВАнГАрДА В РОССии и ГерМАнии Das architektonische erbe Der avantgarDe in russlanD unD DeutschlanD international council on MonuMents anD sites conseil international Des MonuMents et Des sites consejo internacional De MonuMentos y sitios Мен жДу АроДный СоВет По ВоПроСАМ ПАМятникоВ и ДоСтоПриМечАтеЛьных МеСт Архитектурное нАСЛеДие АВАнГАрДА В РОССИИ и ГерМАнии Das architektonische erbe Der avantgarDe in russlanD unD DeutschlanD Мероприятие рабочей группы по культуре Петербургского Диалога, комитета по государ-ственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Администрации Санкт- Петербурга и берлинского Земельного управления по охране памятников (ЛДА) в сотрудничестве с Государственным Эрмитажем Санкт-Петербурга, Государственными музеями Берлин – Фонд Прусского культурного наследия и Гёте-институтом, по случаю восьмого заседания Петербургского Диалога с 30 сентября по 3 октября 2008 года в Санкт-Петербурге. eine veranstaltung der arbeitsgruppe kultur des Petersburger Dialogs, des komitees für Denkmalschutz der stadtverwaltung st. Petersburg (kgioP) und des landesdenkmalamts berlin in Zusammenarbeit mit der staatlichen eremitage -

Die Bauwerke Und Kunstdenkmäler Von Berlin Beiheft 40
DIE BAUWERKE UND KUNSTDENKMÄLER VON BERLIN BEIHEFT 40 DIE BAUWERKE UND KUNSTDENKMÄLER VON BERLIN HERAUSGEGEBEN VOM LANDESDENKMALAMT BERLIN Gebr. Mann Verlag · Berlin AIDA ABADŽIĆ HODŽIĆ SELMAN SELMANAGIĆ UND DAS BAUHAUS Aus dem Bosnischen von Azra Džajić-Weber G ebr. Mann Verlag · Berlin Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. Copyright © 2018 by Gebr. Mann Verlag · Berlin www.gebrmannverlag.de Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form durch Fotokopie, Mikrofilm, CD- ROM usw. ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Bezüglich Fotokopien verweisen wir nachdrücklich auf §§ 53, 54 UrhG. Gedruckt auf säurefreiem Papier, das die US-ANSI-NORM über Haltbarkeit erfüllt. Umschlagabbildung: Eingang zur Kunsthochschule Weißensee, Foto: Wolfgang Bittner, Landesdenkmalamt Berlin Umschlagentwurf und Layout: M&S Hawemann · Berlin Satz: Gebr. Mann Verlag · Berlin Druck und Verarbeitung: druckhaus köthen GmbH · Köthen Schrift: Adobe Garamond; Papier: BVS matt Printed in Germany · ISBN 978-3-7861-2794-9 Inhaltsverzeichnis 5 Inhaltsverzeichnis Geleitwort 9 Vorwort zur deutschen Ausgabe 13 Vorwort zur bosnischen Ausgabe 17 DIE KINDHEIT -

Examining the German Ledigenheim
Examining the German Ledigenheim: Development of a Housing Type, Position in the Urban Fabric and Impact on Central European Housing Reform By Erin Eckhold Sassin B.A., The University of Michigan, Ann Arbor, 2000 M.A., The University of Massachusetts, Amherst, 2004 Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy in the Program in the History of Art and Architecture at Brown University Providence, Rhode Island May 2012 © Copyright Erin Eckhold Sassin, 2012 This dissertation by Erin Eckhold Sassin is accepted in its present form by the Department of History of Art and Architecture as satisfying the dissertation requirement for the degree of Doctor of Philosophy Date __________ ________________________ Dietrich Neumann, Advisor Recommended to the Graduate Council Date __________ ________________________ Carol Poore, Reader Date __________ ________________________ Eve Blau, Reader Approved by the Graduate Council Date __________ ________________________ Peter Weber, Dean of the Graduate School iii Erin Eckhold Sassin 6 Lincoln Avenue, Pawcatuck, CT 02790 [email protected] EDUCATION Ph.D. Filing Dec. 2011 History of Art and Architecture Department, Brown University Providence, Rhode Island Dissertation: Examining the German Ledigenheim: Development of a Housing Type, Position in the Urban Fabric and Impact on Central European Housing Reform Dissertation Director: Dietrich Neumann Colloquium Committee: Dietrich Neumann (Brown), Carol Poore (Brown), Eve Blau (Harvard/GSD) Oral Examination Fields: (Major) European and American Architecture and Urbanism, 1850-1950 (Minor) German Reform Architecture and Design, 1870-1914 (Minor) German History 1870-1993, with a Focus on the City and its Discontents A.M. 2004 University of Massachusetts, Amherst, Massachusetts Concentrations: (1) Nineteenth Century Architecture (2) Northern and Italian Renaissance Art B.A.