Anmerkungen Zum Vorwort
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
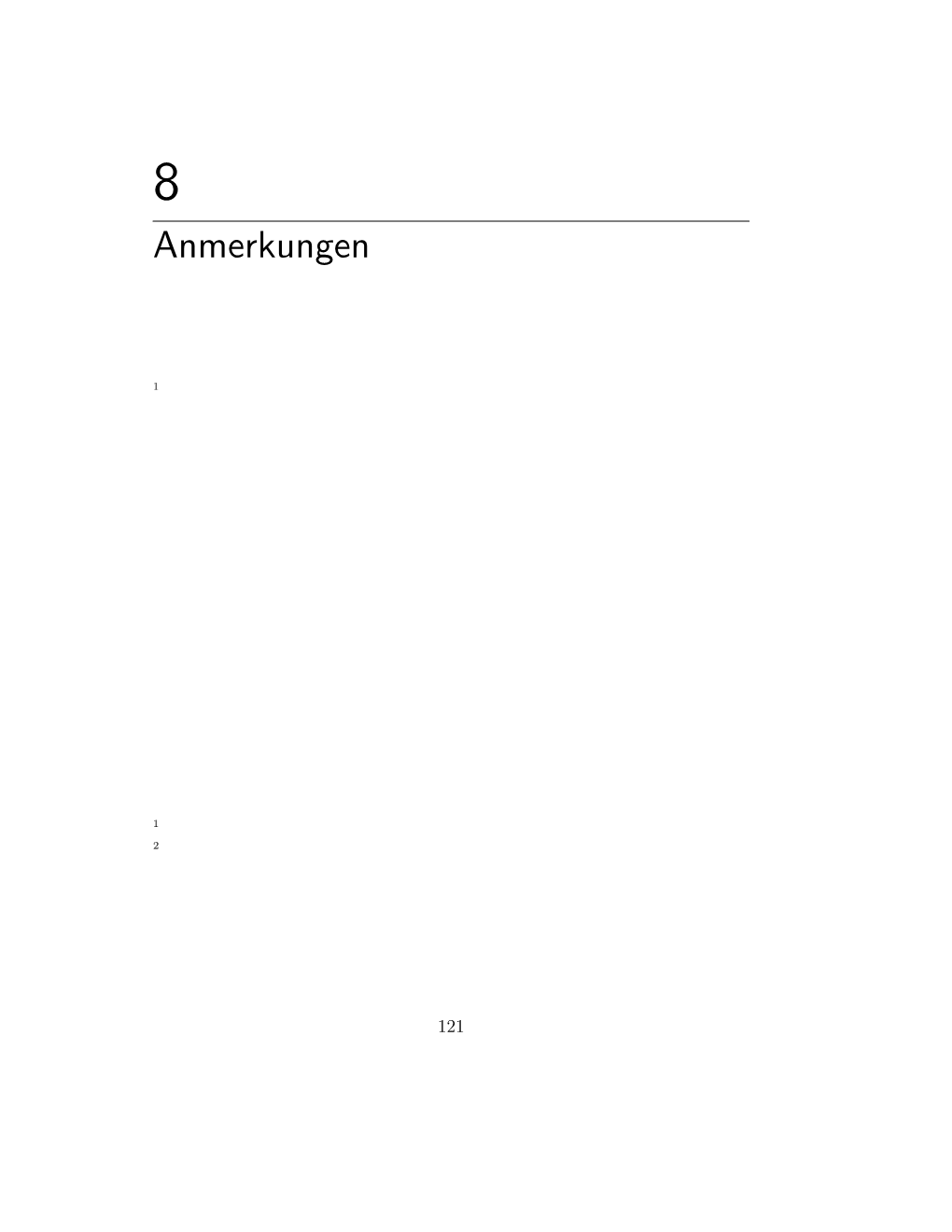
Load more
Recommended publications
-

Berliner Philharmoniker
Berliner Philharmoniker Sir Simon Rattle Artistic Director November 12–13, 2016 Hill Auditorium Ann Arbor CONTENT Concert I Saturday, November 12, 8:00 pm 3 Concert II Sunday, November 13, 4:00 pm 15 Artists 31 Berliner Philharmoniker Concert I Sir Simon Rattle Artistic Director Saturday Evening, November 12, 2016 at 8:00 Hill Auditorium Ann Arbor 14th Performance of the 138th Annual Season 138th Annual Choral Union Series This evening’s presenting sponsor is the Eugene and Emily Grant Family Foundation. This evening’s supporting sponsor is the Michigan Economic Development Corporation. This evening’s performance is funded in part by The Andrew W. Mellon Foundation and by the Michigan Council for Arts and Cultural Affairs. Media partnership provided by WGTE 91.3 FM and WRCJ 90.9 FM. The Steinway piano used in this evening’s performance is made possible by William and Mary Palmer. Special thanks to Tom Thompson of Tom Thompson Flowers, Ann Arbor, for his generous contribution of lobby floral art for this evening’s performance. Special thanks to Bill Lutes for speaking at this evening’s Prelude Dinner. Special thanks to Journeys International, sponsor of this evening’s Prelude Dinner. Special thanks to Aaron Dworkin, Melody Racine, Emily Avers, Paul Feeny, Jeffrey Lyman, Danielle Belen, Kenneth Kiesler, Nancy Ambrose King, Richard Aaron, and the U-M School of Music, Theatre & Dance for their support and participation in events surrounding this weekend’s performances. Deutsche Bank is proud to support the Berliner Philharmoniker. Please visit the Digital Concert Hall of the Berliner Philharmoniker at www.digitalconcerthall.com. -

'Botschafter Der Musik': the Berlin Philharmonic Orchestra and The
Working Papers in the Humanities 1 ‘Botschafter der Musik’: The Berlin Philharmonic Orchestra and the Role of Classical Music in Post-War German Identity Lauren Freede University of Edinburgh Abstract This working paper looks at the role of classical music in the establishment of modern German identity. My wider doctoral research project examines the importance of music in shaping differing senses of positive collective identity in both West Germany and Austria since the 1920s, and explores the exclusion of classical music from critical memory narratives, with particular reference to musical autobiographies. This paper focuses more narrowly on the situation in Germany immediately after World War II. While traditional accounts of the period tend to deal with individual musicians, I argue that musical institutions were central to a sense of being German. A brief case study of the Berlin Philharmonic Orchestra illustrates the tangled relationship between music and politics, and shows the ways in which musical identity was contested. Germans saw positive continuity in their mastery of the classical tradition, while the American occupiers saw the German belief in their musical superiority as a dangerous and unstable base for national restoration. My analysis of the Orchestra reveals that classical music was adopted as a politically neutral source of national pride despite being both highly susceptible to political manipulation and implicated in past militaristic and racist ideologies from which it was supposedly aloof. Thomas Mann once argued: ‘Soll Faust der Repräsentant der deutschen Seele sein, so müßte er musikalisch sein’.2 Since the middle of the nineteenth century, classical music has indeed been the art form most closely identified with the development of the German nation, and musicians and writers have argued that the art form itself belongs to Germany. -
Berliner Philharmoniker Kirill Petrenko
Philharmonie Premium 2 Berliner Philharmoniker Kirill Petrenko Mittwoch 19. Februar 2020 20:00 Bitte beachten Sie: Ihr Husten stört Besucher und Künstler. Wir halten daher für Sie an den Garderoben Ricola-Kräuterbonbons bereit. Sollten Sie elektronische Geräte, insbesondere Mobiltelefone, bei sich haben: Bitte schalten Sie diese zur Vermeidung akustischer Störungen unbedingt aus. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass Bild- und Tonaufnahmen aus urheberrechtlichen Gründen nicht gestattet sind. Wenn Sie einmal zu spät zum Konzert kommen sollten, bitten wir Sie um Verständnis, dass wir Sie nicht sofort einlassen können. Wir bemühen uns, Ihnen so schnell wie möglich Zugang zum Konzertsaal zu gewähren. Ihre Plätze können Sie spätestens in der Pause einnehmen. Bitte warten Sie den Schlussapplaus ab, bevor Sie den Konzertsaal verlassen. Es ist eine schöne und respektvolle Geste den Künstlern und den anderen Gästen gegenüber. Mit dem Kauf der Eintrittskarte erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihr Bild möglicherweise im Fernsehen oder in anderen Medien ausgestrahlt oder veröffentlicht wird. Vordruck/Lackform_1920.indd 2-3 17.07.19 10:18 Philharmonie Premium 2 Berliner Philharmoniker Kirill Petrenko Dirigent Mittwoch 19. Februar 2020 20:00 Pause gegen 20:50 Ende gegen 22:00 PROGRAMM Igor Strawinsky 1882 – 1971 Symphony in Three Movements (1942 – 45) Quarter Note = 160 Andante – Interlude Con moto Bernd Alois Zimmermann 1918- 1970 Alagoana (1950 – 55) Caprichos Brasileiros. Ballett-Suite für Orchester Ouvertüre Sertanejo Saudade Caboclo Finale Pause Sergej Rachmaninow 1873 – 1943 Sinfonische Tänze op. 45 (1940) für Orchester Non allegro – Lento – Tempo primo Andante con moto. Tempo di valse Lento assai – Allegro vivace 2 ZU DEN WERKEN Musik und Tanz sind – über das Element des Rhythmischen – eng miteinander verknüpft. -

DIG Veranstaltungen 1990-Mai 2021
Veranstaltungen der DIG in Bremen seit 1990 Einige Erläuterungen vorab: Im Folgenden sind alle Veranstaltungen und öffentlichen Auftritte der Arbeitsgemeinschaft Bremen/Bremerhaven, ab 2016 DIG Bremen/Unterweser e.V., aufgeführt. Auch die Veranstaltungen des Jungen Forum, seit 2018, sind aufgeführt, da sie zur „DIG-Familie“ gehören. Die Veranstaltungen „in Kooperation“ sind teils in Federführung der DIG, teils mit Unterstützung der DIG, durchgeführt worden. Sie werden hier immer aufgeführt, wenn der Anteil der DIG – als Idee, in der Vorbereitung oder finanziell – wesentlich war. Das gilt auch für die zentralen Gedenkveranstaltungen zum 27. Januar im Rathaus. Die Kooperation wird nicht genannt, wenn die Beteiligung rein organisatorischer Art war; das betrifft vor allem die Landeszentrale für politische Bildung, wenn sie „nur“ den Raum zur Verfügung stellte. Nicht aufgeführt sind die Veranstaltungen, die Mitglieder der DIG unter dem Dach anderer Organisationen entwickelt und geprägt haben. Das gilt vor allem für die „Nacht der Jugend“ durch Helmut Hafner, für die Gedenkveranstaltungen in Bremen-Nord durch Rolf Rübsam und in jüngster Zeit für die Gedenkveranstaltungen in Worpswede durch das Ehepaar Hanstein-Moldenhauer. (Für die ersten fünf Jahre bis 1995 sind nur wenige Unterlagen vorhanden. Die sicher nicht vollständige Quelle ist für diese Jahre das Online-Archiv des Weser-Kuriers) 1990 25. 6. Vorbereitungstreffen einer Israelfahrt 11. 7. Yair Hirschfeld (Israel): Israel, USA, UdSSR: Frieden im Nahen Osten Vortrag und Diskussion Kooperation mit Landeszentrale 24. 10. Die missglückte Emanzipation. Zur Tragödie des jüdisch-christlichen Verhältnisses Diskussion Kooperation mit Israelitischer Gemeinde, Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit 1991 26. 1. Solidaritätsanzeige im Weser-Kurier mit Israel wegen Golfkrieg 1 2. -

2016-17 Fall Program Book 138Th
2016-17 FALL PROGRAM BOOK138TH SEASON // UNIVERSITY OF MICHIGAN | ANN ARBOR You have a part to play. Uncommon Your gift will help in the following areas: and engaging ACCESS AND INCLUSIVENESS experiences. Helping make tickets more affordable. Helping create free educational events and A sense of community-building activities. Providing connection opportunities for all to experience the transformative power of the arts. between audience and artist. ENGAGED LEARNING THROUGH THE ARTS Integrating performing arts into the Moments of clarity, student experience. Creating meaningful connections between the arts and life. inspiration, and Encouraging creative thinking, collaboration, reflection. The and experimentation. performing arts BOLD ARTISTIC LEADERSHIP provide us with Commissioning work that reflects our commitment to tradition and innovation. these elemental Solidifying and elevating our position as experiences, a recognized national and international artistic leader. Unique and bold offering a shortcut programming. to our creative As a Leader and Best among arts presenters, selves. UMS wants anyone and everyone, students and community alike, to experience the transformative power of the performing arts. We seek generous partners who want to help us achieve our goal. UMS.ORG/SUPPORT Visit us online or call the UMS Development 734.764.8489 Office to make your gift today. BE PRESENT Be Present UMS unleashes the power of the 2016 FALL performing arts in order to engage, educate, transform, and connect individuals with uncommon experiences. The Fall 2016 season is full of exceptional, world-class, and truly inspiring performances. Welcome to the UMS experience. We’re glad you’re present. Enjoy the performance. 1 When you attend a UMS performance, you’re part of a larger equation: nonprofit ARTS +CULTURE = ECONOMIC PROSPERITYin the greater Ann Arbor Area $100 million annually Together, we invest in our local community’s vibrancy. -

The 1963 Berlin Philharmonie – a Breakthrough Architectural Vision
PRZEGLĄD ZACHODNI I, 2017 BEATA KORNATOWSKA Poznań THE 1963 BERLIN PHILHARMONIE – A BREAKTHROUGH ARCHITECTURAL VISION „I’m convinced that we need (…) an approach that would lead to an interpretation of the far-reaching changes that are happening right in front of us by the means of expression available to modern architecture.1 Walter Gropius The Berlin Philharmonie building opened in October of 1963 and designed by Hans Scharoun has become one of the symbols of both the city and European musical life. Its character and story are inextricably linked with the history of post-war Berlin. Construction was begun thanks to the determination and un- stinting efforts of a citizens initiative – the Friends of the Berliner Philharmo- nie (Gesellschaft der Freunde der Berliner Philharmonie). The competition for a new home for the Berlin Philharmonic Orchestra (Berliner Philharmonisches Orchester) was won by Hans Scharoun whose design was brave and innovative, tailored to a young republic and democratic society. The path to turn the design into reality, however, was anything but easy. Several years were taken up with political maneuvering, debate on issues such as the optimal location, financing and the suitability of the design which brought into question the traditions of concert halls including the old Philharmonie which was destroyed during bomb- ing raids in January 1944. A little over a year after the beginning of construction the Berlin Wall appeared next to it. Thus, instead of being in the heart of the city, as had been planned, with easy access for residents of the Eastern sector, the Philharmonie found itself on the outskirts of West Berlin in the close vicinity of a symbol of the division of the city and the world. -

1. Zielstellung 3 2. Einleitung 2.1. Das Arbeitsgebiet Des Tonmeisters 3 2.2
Gregor Schweiger Matr.-Nr.: 24002 FF07w1-b “Workflow bei Tonproduktionen in einem Konzerthaus am Beispiel der Philharmonie Berlin” 1. Zielstellung 3 2. Einleitung 2.1. Das Arbeitsgebiet des Tonmeisters 3 2.2. Die Philharmonie Berlin 4 2.3. Überblick der Geschichte der Berliner Philharmoni- ker 2.3.1. Hans von Bülow (1882-1984) 6 2.3.2. Arthur Nikisch (1895-1922) 13 2.3.3. Wilhelm Furtwängler (1922-1945) 19 2.3.4. Sergiu Celibidache (1945-1954) 25 2.3.5. Herbert von Karajan (1954-1989) 29 2.3.6. Claudio Abbado (1989-2002) 35 2.3.7. Sir Simon Rattle (seit 2002) 39 3. Tontechnische Gegebenheiten in der Philharmonie Berlin 3.1. Tonaufnahmen in der Philharmonie 40 3.2. Personal und Aufgabenverteilung 41 3.3. Technische Ausstattung 3.3.1. Studio 3 42 3.3.2. Konzertsaal 44 1 Gregor Schweiger Matr.-Nr.: 24002 FF07w1-b “Workflow bei Tonproduktionen in einem Konzerthaus am Beispiel der Philharmonie Berlin” 4. Produktionsvorbereitung 4.1. Feststellen von Besetzung und örtlicher Verteilung auf dem Podium 45 4.2. Zusammenstellung des Teams 47 4.3. Mikrofonieren in der Philharmonie am Beispiel ei- nes Klavierkonzerts 47 4.4. Technische Rahmenbedingungen 49 5. Aufnahme 5.1. Studioproduktion und Konzertmitschnitt 50 5.2. Digital Concert Hall 51 6. Postproduktion 6.1. Nachbereitung der Studioproduktionen in der Phil- harmonie 52 6.2. Konzertaufnahmen und Digital Concert Hall 53 7. Zusammenfassung 53 8. Literaturverzeichnis 55 2 Gregor Schweiger Matr.-Nr.: 24002 FF07w1-b “Workflow bei Tonproduktionen in einem Konzerthaus am Beispiel der Philharmonie Berlin” 1. Zielstellung Das Ziel der Arbeit ist es, die Arbeit des Tonmeisters darzustellen, sowie das Zusammenspiel mehrerer Komponenten bzw. -

Schriftenreihe Des Sophie Drinker Instituts Band 4
Schriftenreihe des Sophie Drinker Instituts Herausgegeben von Freia Hoffmann Band 4 Marion Gerards, Freia Hoffmann (Hrsg.) Musik – Frauen – Gender Bücherverzeichnis 1780–2004 BIS-Verlag der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 2006 Das Werk ist einschließlich aller seiner Teile urheberrechtlich ge- schützt. Jede Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechts bedarf der Zustimmung der Autorinnen. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Medien. © BIS-Verlag, Oldenburg 2006 Umschlaggestaltung: Marta Daul Layout und Satz: BIS-Verlag Verlag / Druck / BIS-Verlag Vertrieb: der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg Postfach 25 41, 26015 Oldenburg Tel.: 0441/798 2261, Telefax: 0441/798 4040 e-mail: [email protected] Internet: www.bis.uni-oldenburg.de ISBN 3-8142-0966-4 Inhaltsverzeichnis Vorwort 3 Hinweise zur Benutzung 5 1 Nachschlagewerke 9 1.1 Lexika und biographische Nachschlagewerke 9 1.2 Bibliographien 14 1.3 Notenverzeichnisse 17 1.4 Diskographien 22 2 Einführende Literatur 24 2.1 Kunstmusik 24 2.2 Populäre Musik (Jazz, Rock, Pop, Volksmusik, Chansons, Weltmusik u. ä.) 42 2.3 Stilübergreifend und Sonstige 50 3 Personenbezogene Darstellungen 54 3.1 Kunstmusik 54 3.2 Populäre Musik (Jazz, Rock, Pop, Volksmusik, Chansons, Weltmusik u. ä.) 320 3.3 Stilübergreifend und Sonstige 433 4 Spezielle Literatur 446 4.1 Kunstmusik 446 4.2 Populäre Musik (Jazz, Rock, Pop, Volksmusik, Chansons, Weltmusik u. ä.) 462 4.3 Stilübergreifend -

Das Orchester Auf Reisen
Nicht da ist man daheim, wo man seinen Wohnsitz hat, son- ” dern wo man verstanden wird.” (Christian Morgenstern) 4 Das Orchester auf Reisen Die Musiker sind unterwegs,” heißt es nicht selten, wenn Berlinbesucher ” nach den Philharmonikern fragen. Mit ihren Chefdirigenten trat das Orchester ¨ofter in anderen St¨adten und L¨andern auf als in Berlin, ganz zur Freude von Musikliebhabern in aller Welt.1 So k¨onnen sie live zeigen, was sie dem Publikum durch Aufzeichnungen verheißen haben. Wie in vielen F¨allen st¨arkt das Reisen Weltoffenheit und Gemeinschaftsgeist - und in diesem Fall auch die Leistungsmotivation vieler Orchestermitglieder. Abb. 4.1 Auslands- und Uberseereisen¨ der Berliner Philharmoniker von 1882 bis 2005. 51 52 4 Das Orchester auf Reisen Reisen in der ersten Zeit nach der Grundung¨ Konzertreisen stehen seit dem Grundungsjahr¨ 1882 auf dem Programm. An- fangs waren sie eine finanzielle Notwendigkeit, um ganzj¨ahrig die damals an sich schon bescheidenen Geh¨alter der Musiker zahlen zu k¨onnen. Allein im ersten Jahr ging es in 24 deutsche St¨adte. Ab 1885 fuhr man j¨ahrlich fur¨ vier Monate in das holl¨andischen Nordseebad Scheveningen - und dies 26 Jahre lang. Seit 1890 gastiert das Orchester auch an anderen europ¨aischen Orten, meist im Herbst und Fruhjahr.¨ Tourneen in weit entfernte St¨adte waren bis zur Mitte des 20. Jahr- hunderts mit großen Strapazen verbunden. H¨aufiger wurden sie erst nach der Erschließung des zivilen Luftverkehrs durchgefuhrt,¨ d.h. seit Ende der 1940er Jahre, in großem Stil seit dem Einsatz der Dusenflugzeuge¨ im Linienverkehr in den 1960er Jahren. Auch heute sind ausw¨artige Konzerte noch anstrengend, zumal meist ein dichtes Programm zu bew¨altigen ist. -

Classical Music, Propaganda, and the American Cultural Agenda in West Berlin (1945–1949)
Music among the Ruins: Classical Music, Propaganda, and the American Cultural Agenda in West Berlin (1945–1949) by Abby E. Anderton A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy (Music: Musicology) in the University of Michigan 2012 Doctoral Committee: Professor Jane Fair Fulcher, Chair Professor Steven M. Whiting Associate Professor Charles H. Garrett Associate Professor Silke-Maria Weineck To my family ii Acknowledgements While writing this dissertation, I have been so fortunate to have the encouragement of many teachers, friends, and relatives, whose support has been instrumental in this process. My first thanks must go to my wonderful advisor, Dr. Jane Fulcher, and to my committee members, Dr. Charles Garrett, Dean Steven Whiting, and Dr. Silke-Maria Weineck, for their engaging and helpful feedback. Your comments and suggestions were the lifeblood of this dissertation, and I am so grateful for your help. To the life-long friends I made while at Michigan, thank you for making my time in Ann Arbor so enriching, both academically and personally. A thank you to Dennis and to my family, whose constant encouragement has been invaluable. Lastly, I would like to thank my mom and dad, who always encouraged my love of music, even if it meant sitting through eleven community theater productions of The Wizard of Oz. I am more grateful for your help than I could ever express, so I will simply say, “thank you.” iii Table of Contents Dedication ....................................................................................................................... -

11/2012 4 JÜDISCHES BERLIN 148 11/2012 Oder Mohel Erfolgen
GEMEINDEBLATT JÜDISCHE GEMEINDE ZU BERLIN · NOVEMBER 2012 · 15. JAHRGANG NR. 148 · 2,50 € НОВОСТИ ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ БЕРЛИНА INHALT · СОДЕРЖАНИЕ Inhalt Содержание jüdisches berlin Gemeindeblatt 4 | Editorial des Herausgebers 4 | Колонка издателя 5 | Grußwort des Vorsitzenden 5 | Приветствие Председателя V.i.S.d.P. Oбщины Präsidium der Repräsentantenver- 7 Gedenken sammlung der Jüdischen Gemeinde 7 | Vorboten. Schon 1931 wurden 6 Память zu Berlin (Michael Rosenzweig, auf dem Kurfürstendamm in 6 | Предвестники. Уже 1931 году Philipp Siganur, Yaacov Shancer, einer pogromartige Randale на Курфюрстендамме Natalija Apt, Sofia Feldman-Can) Juden attackiert совершались погромные Redaktion 8 | Der Gedenkstein für die Opfer нападения на евреев Judith Kessler, Leitende Redakteurin des Nationalsozialismus am 8 | Mемориальный камень Oranienburger Straße 29 Steinplatz жертвам национал- 10117 Berlin 9 | Zur Bedeutung des Jiskorgebets социалистов на площади Telefon 880 28-269 10 | Zum 100. Geburtstag Штайнплац в Шарлоттенбурге Mail [email protected] von Heinz Galinski 9 | О значении молитвы Изкор Auflage 8 000 Titel 11 | К столетию со дня рождения Druck Medien Herstellungs- und Am 28. November 2012 wäre Heinz 13 Gesellschaft Хайнца Галинского Vertriebs GmbH Galinski 100 Jahre alt geworden. Wir 13 | Momme Brodersen: Klassenbild Prinzessinnenstraße 26, 10969 Berlin erinnern an den langjährigen mit Walter Benjamin 14 Общество Anzeigenverwaltung Gemeinde- und Zentralratsvorsitzen- 14 | Kurz notiert 14 | Новости коротко Runze & Casper Werbeagentur den (siehe auch -

Philharmoniker Und Philharmonie
Die Stunden in der Berliner Philharmonie sind und bleiben ” fur¨ mich Mitte der Welt.” (Richard von Weizs¨acker)1 1 Philharmoniker und Philharmonie Fragt ein Berlin-Besucher einen Passanten: ,Wie komme ich zur Philharmo- nie?’ Sagt dieser: ,Uben!¨ Uben!¨ Uben!’¨ Die bekannte Anekdote zeigt, daß das Orchester und sein Haus im Volksmund verwechselt werden k¨onnen. Die ver- schiedenen Bezeichnungen der Institution Berliner Philharmonie m¨ogen dazu beigetragen haben. Schon immer war das Geb¨aude Die Berliner Philharmo- nie, aber die Gemeinschaft der Musiker trat unter wechselnden Namen auf. Sie nannte sich bis zum Jahre 2001 bei Konzerten Berliner Philharmonisches Orchester, auf Tontr¨agern aber Berliner Philharmoniker. Bei Aufnahmen war man eine private und nicht eine ¨offentliche K¨orperschaft des Landes Berlin. Erst seit der organisatorischen Umwandlung in eine Stiftung im Januar 2002 hat das Orchester bei Konzerten und auf Tontr¨agern nur noch einen Namen: Berliner Philharmoniker. Das Zuhause Fur¨ ein Orchester ist ein Konzertsaal so wichtig wie fur¨ Maler Ateliers und Galerien zur Ausstellung ihrer Kunst. Eine neue Heimstatt war nach dem zweiten Weltkrieg n¨otig geworden, denn die vorherige, die alte Philharmonie in der Bernburger Straße, war den Bomben zum Opfer gefallen.2 Das Orche- ster trat zun¨achst in verschiedenen S¨alen der Stadt auf. Aber das war eine nur unbefriedigende L¨osung.3 Im Jahre 1960 wurde endlich ein Neubau bewilligt, der zun¨achst in der N¨ahe des Kurfurstendamm¨ auf dem Gel¨ande der heutigen Freien Volksbuhne¨ errichtet werden sollte, dann aber im Zentrum Berlins nahe des Potsdamer Platzes entstand. Unerwartet wurde w¨ahrend der Arbeiten nicht weit davon im August 1961 die Berliner Mauer errichtet, so daß sich das Geb¨aude bei Fertigstellung 1963 am ¨ostlichen Rande Westberlins befand.