Wer Waren Sie? Woher Kamen Sie? Wie Lebten Sie?
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
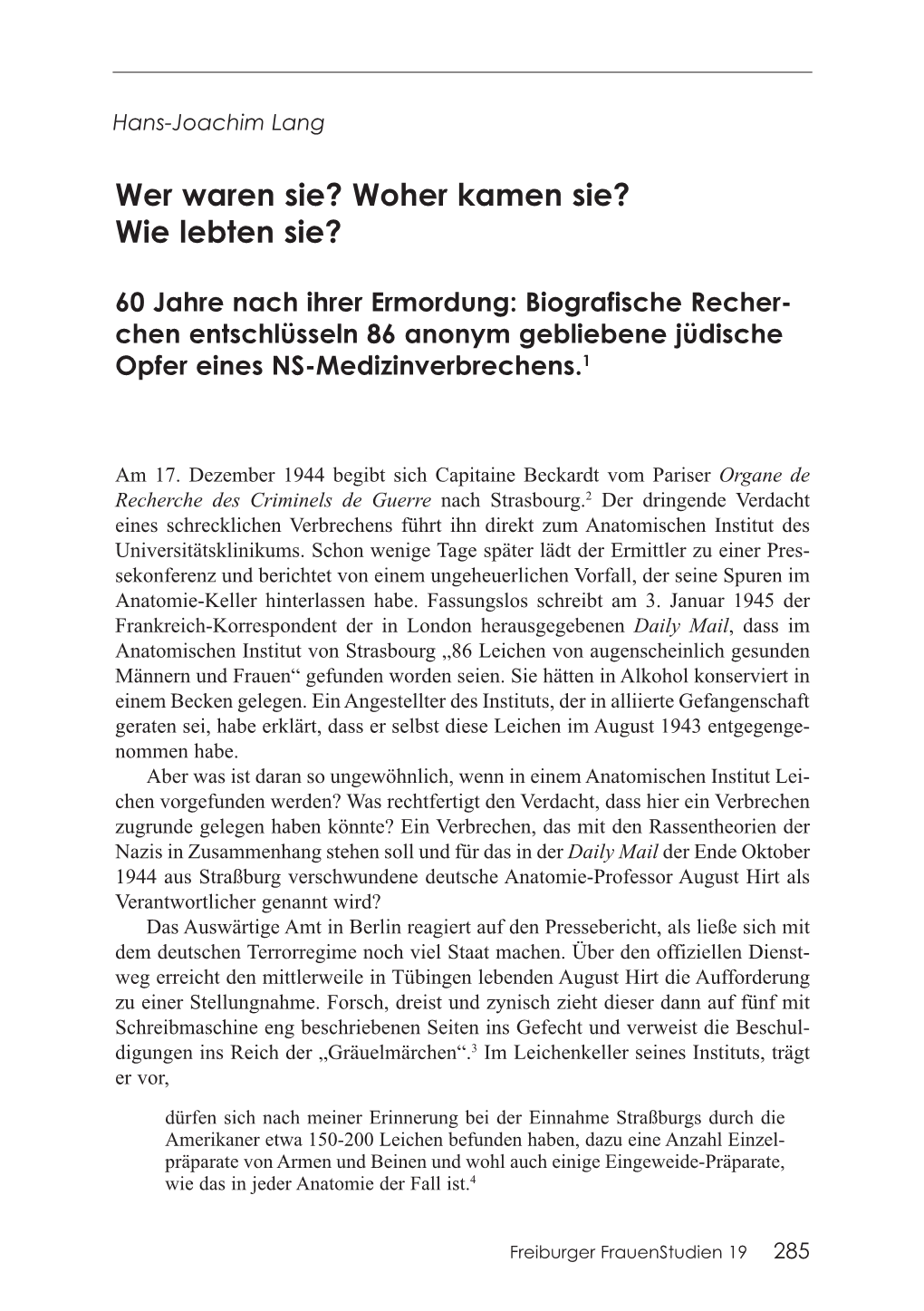
Load more
Recommended publications
-

The Failed Attempt to Prove Jewish Inferiority by a Skeleton Collection
Answers Research Journal 13 (2020): 331–335. www.answersingenesis.org/arj/v13/jewish_inferiority_skeleton.pdf The Failed Attempt to Prove Jewish Inferiority by a Skeleton Collection Jerry Bergman, Genesis Apologetics, PO Box 1326, Folsom, California 95763-1326. Abstract This is a review of the history of an attempt to prove Jewish racial inferiority by selecting Jews who fit the racial stereotype, then murdering them, and processing the bodies for display in a German university museum. In the end, the researchers were unable to find any evidence of Jewish racial inferiority as predicted by the anthropology and medical academic community of the time. The cost in terms of lives and suffering included over 100 innocent people who were murdered to prove a theory that turned out to be not only wrong but based on an erroneous secular philosophy, namely Darwinism. This display was one result of the rejection of the Genesis account that teaches all men are descendants of our first parents, Adam and Eve; thus all humans are of one race (the human race) and one kind (mankind). Keywords: Introduction to the Jewish Skeleton Collection History, Holocaust, Racism, Nazism, Darwin-based racism, Auschwitz, Social Darwinism, Ernst Haeckel, de Gobineau Introduction as taught by eugenicists, civilizations decline and A claim by some historians is that the Jewish fall when the superior race is generically mixed with Holocaust was caused purely by anti-Semitism. In inferior races, such as the Jews. Another professor fact, as has been well-documented, Darwinian-based who was very influential in the Nazi racial belief was racism was a central factor in causing the Holocaust the greatest avowed follower of Darwin in the world (Bergman 2010, 2012; Müller-Hill 1998; Weikart of German science, Ernst Haeckel, . -

Der Himmel. Wunschbild Und Weltverständnis
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Oxford Brookes University: RADAR RASSENKUNDLICHE FORSCHUNG ZWISCHEN DEM GETTO LITZMANNSTADT UND AUSCHWITZ: HANS FLEISCHHACKERS TÜBINGER HABILITATION, JUNI 1943 PAUL WEINDLING Am 8. Juni 1943 hielt der Rassenforscher Hans Fleischhacker vor der Medizinischen Fakultät der Universität Tübingen als letzten Schritt seines Habilitationsverfahrens die Probevorlesung über „Das Hautleistensystem auf Fingerbeeren und Handleisten bei Juden“. Seine erfolgreiche Ver- teidigung ermöglichte es ihm, den Status eines Privatdozenten am Rassenkundlichen Institut zu erlangen. Die dem Verfahren zugrundeliegende Habilitationsschrift galt als verschollen; im Universitätsarchiv Tübingen ist kein Manuskript überliefert.1 Der kürzlich erfolgte Fund von Handabdrücken, die in Litzmannstadt (Łódź) abgenommen und in der Habilitation analysiert wurden, wirft eine Reihe von Fragen auf: Wie sahen bei diesen Forschungen die genauen Umstände, die praktische Durchführung und die verfolgten Ziele aus? Wie war Fleischhacker 143 an diese Handabdrücke gekommen? Lässt sich Margit Berner ist überdies bekannt, dass möglicherweise noch der Habilitationstext Wiener Anthropologen an Juden aus den Gettos identifizieren? Und schließlich, dies ist wohl am Litzmannstadt und Tarnow Vermessungen durch- schwierigsten zu beantworten: Was lässt sich führten.2 Tatsächlich stellte sich heraus, dass im über die Identität der Probanden sagen? Naturhistorischen Museum Wien ein Beitrag Hans Fleischhackers -

Medical Ethics in the 70 Years After the Nuremberg Code, 1947 to the Present
wiener klinische wochenschrift The Central European Journal of Medicine 130. Jahrgang 2018, Supplement 3 Wien Klin Wochenschr (2018) 130 :S159–S253 https://doi.org/10.1007/s00508-018-1343-y Online publiziert: 8 June 2018 © The Author(s) 2018 Medical Ethics in the 70 Years after the Nuremberg Code, 1947 to the Present International Conference at the Medical University of Vienna, 2nd and 3rd March 2017 Editors: Herwig Czech, Christiane Druml, Paul Weindling With contributions from: Markus Müller, Paul Weindling, Herwig Czech, Aleksandra Loewenau, Miriam Offer, Arianne M. Lachapelle-Henry, Priyanka D. Jethwani, Michael Grodin, Volker Roelcke, Rakefet Zalashik, William E. Seidelman, Edith Raim, Gerrit Hohendorf, Christian Bonah, Florian Schmaltz, Kamila Uzarczyk, Etienne Lepicard, Elmar Doppelfeld, Stefano Semplici, Christiane Druml, Claire Whitaker, Michelle Singh, Nuraan Fakier, Michelle Nderu, Michael Makanga, Renzong Qiu, Sabine Hildebrandt, Andrew Weinstein, Rabbi Joseph A. Polak history of medicine Table of contents Editorial: Medical ethics in the 70 years after the Nuremberg Code, 1947 to the present S161 Markus Müller Post-war prosecutions of ‘medical war crimes’ S162 Paul Weindling: From the Nuremberg “Doctors Trial” to the “Nuremberg Code” S165 Herwig Czech: Post-war trials against perpetrators of Nazi medical crimes – the Austrian case S169 Aleksandra Loewenau: The failure of the West German judicial system in serving justice: the case of Dr. Horst Schumann Miriam Offer: Jewish medical ethics during the Holocaust: the unwritten ethical code From prosecutions to medical ethics S172 Arianne M. Lachapelle-Henry, Priyanka D. Jethwani, Michael Grodin: The complicated legacy of the Nuremberg Code in the United States S180 Volker Roelcke: Medical ethics in Post-War Germany: reconsidering some basic assumptions S183 Rakefet Zalashik: The shadow of the Holocaust and the emergence of bioethics in Israel S186 William E. -

The Kaiser Wilhelm Institute for Anthropology, Human Heredity and Eugenics During World War II, 1938/42–1945
Chapter 4 In the Realm of Opportunity: The Kaiser Wilhelm Institute for Anthropology, Human Heredity and Eugenics during World War II, 1938/42–1945 4.1 The “Reorganization” of the Institute under the Banner of Phenogenetics, 1938–1942 4.1.1 Preliminary Considerations in the Years 1938/42 On March 8, 1940, Eugen Fischer wrote a long, confidential letter to Otmar von Verschuer, director of the Institute for Genetic Biology and Race Hygiene at the University of Frankfurt at that time. In this letter Fischer expressed critique – and certainly also self-critique – about the scientific development of his institute since the mid-1930s. At first glance this critical assessment seems surprising. The KWI-A had prof- ited considerably from the genetic and race policy of the National Socialist regime. Money flowed abundantly, research projects received generous support, the expan- sion of the institute proceeded. As the deputy chairman of the Medical Biology Section of the “Academic Council” of the KWG, and even more so as a member of the Expert Committee for “Anthropology and Ethnology” of the Emergency Association of German Science and the Reich Research Council, respectively, the position Fischer held within his area of expertise was central in terms of research strategy.1 The political prestige and social recognition of the KWI-A, and the scientists working there increased constantly. Fischer himself received a number of honors and accolades in the Third Reich, of which his election to membership in the Prussian Academy of Sciences in 1937 was the most important. Just a year ear- lier, in 1939, Fischer had been awarded the Goethe Medal for Art and Science.2 Yet in March 1940 Fischer was not satisfied with the development of the insti- tute. -

August Hirt – Verbrecherische Menschenversuche Mit Giftgas Und „Terminale“ Anthropologie
August Hirt – Verbrecherische Menschenversuche mit Giftgas und „terminale“ Anthropologie Udo Benzenhöfer Einleitung Der Anatom August Hirt ist verantwortlich für entsetzliche Medizinver- brechen. Er ist verantwortlich für Kampfstoffversuche an KZ-Häftlingen in Natzweiler. Er ist auch verantwortlich für ein Projekt, das man „termi- nale Anthropologie“ nennen könnte: Vermessung von lebenden Lagerin- sassen in Auschwitz, anschließend Ermordung in Natzweiler, Konservie- rung und (geplant) Reduktion auf das Skelett zu Ausstellungszwecken in Straßburg. Diese Schandtaten fallen in die Straßburger Zeit (1941-1944) Hirts. Doch schon in seiner „Frankfurter“ Zeit 1938 bis 1941 (die Tätig- keit im Dienst der Wehrmacht in Berlin und im „Westen“ wird hier mit einbezogen) hatte er die Grenzen des medizinethisch Zulässigen über- schritten und sich mit Kampfstoffversuchen an Tieren und an mehr oder weniger „Freiwilligen“ unter Hypothesen beschäftigt, die mehr von Wahn als von einem seriösen Forschungsansatz zeugen. Zu Hirt gibt es schon einiges an Literatur: Den Lebenslauf beschrieben relativ genau Drabek, der u.a. die Personalakte Hirts in Frankfurt benutzte (Drabek 1988), und Kasten, ein Kater-Schüler, der u.a. die Personalakte Hirts in Heidelberg auswertete (Kasten 1991). Ein wichtiger älterer Beitrag zu Hirt findet sich in der Studie von Kater zum „Ahnenerbe“ (Kater 1974, S. 245-255). Kater legte den Schwerpunkt seiner Darstellung auf die „Ske- lettsammlung“, auf die Lost-Versuche in Natzweiler ging er nur knapp ein. Dies gilt auch für Kasten (1991) und Lang (2004), wobei es Lang gelang, die Namen der 86 von Auschwitz nach Natzweiler transportierten und hier für die „Skelettsammlung“ ermordeten Häftlinge zu identifizieren. Bemerkun- gen zum Komplex Hirt, Straßburg, Natzweiler finden sich bei Klee (1997, 21 hier vor allem S. -

LEBENSLAUF, PUBLIKATIONSLISTE, FORSCHUNGSPROFIL (April 2020)
LEBENSLAUF, PUBLIKATIONSLISTE, FORSCHUNGSPROFIL (April 2020) Prof. Dr. Isabel Heinemann Am Domplatz 20-22 Westf. Wilhelms-Universität 48143 Münster Tel. 0251-832-5458 [email protected] Derzeitige Tätigkeit: Seit 1.7.2019 Universitätsprofessorin (W 2) für Neueste Geschichte an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster (befristet bis 6/2023) 2009-2019: Juniorprofessorin (W 1) für Neuere und Neueste Geschichte an der Westfäli- schen Wilhelms-Universität Münster. 2015-2019: Principal Investigator (PI) im SFB 1150 der DFG „Kulturen des Entscheidens“, an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Leitung des Teilprojektes A 05: „Reproduktionsentscheidungen in Deutschland und den USA in der zwei- ten Hälfte des 20. Jahrhunderts“. 2017-2018: Vertretung des Lehrstuhls für Nordamerikanische Geschichte an der Universi- tät zu Köln (Sommersemester 2017 / Wintersemester 2017/18). Juni 2012: Positive Evaluation der Juniorprofessur basierend auf zwei externen Gutach- ten. 2009-2016: Leiterin der Emmy Noether-Nachwuchsgruppe der DFG: „Familienwerte im gesellschaftlichen Wandel: Die US-amerikanische Familie im 20. Jahrhundert“ Wissenschaftlicher Werdegang: 2002-2009: Wissenschaftliche Assistentin (C1) am Lehrstuhl für Neuere und Neueste Ge- schichte der Universität Freiburg (Elternzeiten 8/2003-9/2004, 12/2004- 9/2005, 3/2007-4/2009). 2001-2002: Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Historischen Seminar der Universität Frei- burg im DFG-Forschungsprojekt „Geschichte der Deutschen Forschungsge- meinschaft von 1920 bis 1970“. 1998-2001: Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Historischen Seminar der Universität Frei- burg, Bearbeitung des Projektes „Rasse, Siedlung, Volksgemeinschaft. Das Ras- se- und Siedlungshauptamt der SS, 1931-1945.“ im Schwerpunktprogramm „Weltanschauung und Diktatur“ der VW-Stiftung. 1994-1996: Wissenschaftliche Hilfskraft am Sonderforschungsbereich „Mündlichkeit und Schriftlichkeit im Mittelalter“ an der Universität Freiburg. 1990-dato: Mitwirkung in der universitären Selbstverwaltung. -

INFORMATION ISSUED by the ASSOCIATION of JEWISH REFUGEES in GREAT BRITAIN Office and Consulting Hours: 8 FAIRFAX IVIAN5IONS, FINCHLEY RD
VOL. XX No. 7 July, 1965 INFORMATION ISSUED BY THE ASSOCIATION OF JEWISH REFUGEES IN GREAT BRITAIN Office and Consulting Hours: 8 FAIRFAX IVIAN5IONS, FINCHLEY RD. (corner Fairlax Rd), London. N.W.S Monday to Thursday lOa.m.—lp.m. 3—6p.m. Teleptione : MAIda Vale 9096.7 (General OMce and Wellarc for the Aged), MAIda Vale 4449 (Employment Agency, annually licensed by the L.CC,, friday 10a.m.—I p.m. and Social Services Dept,) ^''alter Breslaner DAS ENTSCHAEDIGUNGSSCHLUSSGESETZ MARTIN BUBER While the work of Martin Buber, who Am 26. Mai ist das " Zweite Gesetz zur Luecken in dem bisherigen Gesetz gefun passed away in Jerusalem on June 13 in Aenderung des Bundesentschaedigungs den, dass der von ihr Mitte 1963 vorgelegte his 88th year, belongs to humanity and gesetzes " vom deutschen Bundestag ver Entwurf nicht weniger als 106 Abaen- to the Jewish people as a whole, Jews abschiedet worden. Dabei ist an diesem derungsvorschlaege enthielt, zu denen from Central Europe have added reason letzten Tage der Beratungen der Titel des weitere umfangreiche Bestimmungen ver- for mourning his departure. He spent Gesetzes in " Bundesentschaedigungs- schiedenster Art hinzukamen, z.B. ueber the major part of his life in German- Schlussgesetz " geaendert worden, um zum den Uebergang von der bisherigen zur speaking countries and exerted a deci Ausdruck zu bnngen, dass das Gesetz die kuenftigen Regelung und ueber die Sonder sive influence on German Jewry, Entschaedigung der Verfolgten des regelung fuer besondere Verfolgten especially among members of the Nazionalsozialismus abschliessend regeln gruppen. younger generation. solle. It testified to his loyalty that he stayed Die wichtigsten Bestimmungen des in Germany in 1933 to organise adult Der Inhalt des Schlussgesetzes ist, im Gesetzentwurfs wurden in AJR Information education at a time when the German grossen gesehen, auch von den Verfolgten im August 1963 dargestellt. -

Editorial 489..489
W. Niebling Den Nummern einen Namen geben ¼ Editorial Nicht weit entfernt von meinem das Anatomische Institut nach Straûburg transportiert. Bedingt Wohnort, in Schönenbach am durch die Kriegslage, Straûburg wurde im November 1944 von den Schluchsee wurde wenige Wo- Alliierten befreit, wurde der ursprüngliche Plan nicht weiter verfolgt chen nach Kriegsende der damals und die Abteilung von August Hirt nach Tübingen verlagert. Zuvor 47-jährige Arzt August Hirt in ei- begannen Hirts Helfer die verräterischen Leichen unkenntlich zu ma- nem Waldstück tot aufgefunden. chen. Nach dem Krieg wurden die sterblichen Überreste der Ermor- Er hatte sich mit einer Pistole ins deten in einem Massengrab beigesetzt ± namenlose Opfer eines un- Herzgeschossen. In den Wirren menschlichen Verbrechens. Sie wären namenlos geblieben, hätte der letzten Kriegsmonate war er, nicht der Apotheker Henry Henrypierre, ein damaliger Mitarbeiter aus Tübingen kommend auf ei- am Institut, die Nummern auf dem linken Unterarm der Opfer heim- nem Bauernhof untergetaucht. lich abgeschrieben und sie bei sich aufbewahrt. Es ist das Verdienst Die Besitzer fühlten sich ihm ver- des Tübinger Historikers und Journalisten Hans-Joachim Lang nach pflichtet, hatte er doch kurzzuvor jahrelangen und mühevollen Recherchen in den Archiven des deren Tochter mit einer Notope- Washingtoner Holocaust-Museum, von Auschwitzund Yad Vashem, ration vor dem vermeintlich si- die KZ-Nummern in Namen transponiert, den Opfern eine Identität, cheren Erstickungstod bewahrt. ihnen ein Gesicht gegeben zu haben: Frank Sachnowitz, ein 17-jähri- Wenige Tage später fand auf dem ger Junge aus Norwegen, Harri Bober, ein damals 20 Jahre alter Berli- benachbarten Friedhof von Grafenhausen das Begräbnis statt. Der ner oder die 1920 in Thessaloniki geborene Nina Sustiel, um nur eini- 489 Grabstein auf der Parzelle 27 ist längst abgeräumt und damit der ge zu nennen [1]. -

1 Bonjour Raphael Toledano, Pouvez-Vous Vous Présenter En
August Hirt et son projet de collection de crânes de commissaires judéo-bolchéviques. Entretien avec Raphael Toledano Yannik van Praag Mémoire d’Auschwitz ASBL Mémoire d’Auschwitz ASBL Rue aux Laines, 17 boîte 50 – 1000 Bruxelles Tél. : +32 (0)2 512 79 98 Mars 2019 www.auschwitz.be • [email protected] Bonjour Raphael Toledano, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? Je suis né à Strasbourg et suis médecin de formation. Je conduis depuis plus de 15 ans des recherches sur les dérives et crimes commis au nom de la médecine et de la science sous le national-socialisme, en me focalisant sur le cas de l'Alsace. Depuis 2012, je fais partie du conseil scientifique du Centre européen du résistant déporté qui est le musée de l'ancien camp de concentration de Natzweiler-Struthof, seul camp situé sur l'actuel territoire français. Comment en êtes-vous venu à vous intéresser à August Hirt ? Pouvez-vous rappeler brièvement son parcours, tant académique qu’au sein de l’appareil nazi ? August Hirt est un anatomiste allemand né en 1898, membre de la SS et du parti nazi, qui fut directeur de l'Institut d'anatomie de l'Université nazie de Strasbourg (la Reichsuniversität Strassburg) entre 1941 et 1944. Au cours de ces trois années, il se livra à de nombreux crimes : des expériences sur le gaz moutarde au Camp de Natzweiler en 1942, et la constitution d'une collection anatomique juive par gazage de 86 Juifs en août 1943 dans la chambre à gaz du Struthof. Il intervint également dans les recherches sur le gaz phosgène menées par Otto Bickenbach. -

Das SS-Ahnenerbe Und Die »Straßburger
Zeitgeschichtliche Forschungen 52 Forschungen Zeitgeschichtliche Das SS-Ahnenerbe und die „Straßburger Schädelsammlung“ – Fritz Bauers letzter Fall Von Julien Reitzenstein Zweite, durchgesehene Auflage Duncker & Humblot · Berlin JULIEN REITZENSTEIN Das SS-Ahnenerbe und die „Straßburger Schädelsammlung“ – Fritz Bauers letzter Fall Zeitgeschichtliche Forschungen Band 52 Das SS-Ahnenerbe und die „Straßburger Schädelsammlung“ – Fritz Bauers letzter Fall Von Julien Reitzenstein Zweite, durchgesehene Auflage Duncker & Humblot · Berlin Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. Umschlagbild: Tibet-Expedition – Bruno Beger mit Messschieber bei kraniometrischer Messung (© Bundesarchiv, Bild 135-KB-15-083 / Fotograf: Ernst Krause) 1. Auflage 2018 Alle Rechte vorbehalten © 2019 Duncker & Humblot GmbH, Berlin Fremddatenübernahme: L101 Mediengestaltung, Fürstenwalde Druck: CPI buchbücher.de gmbh, Birkach Printed in Germany ISSN 0582-0200 ISBN 978-3-428-15857-7 (Print) ISBN 978-3-428-55857-5 (E-Book) ISBN 978-3-428-85857-6 (Print & E-Book) Gedruckt auf alterungsbeständigem (säurefreiem) Papier entsprechend ISO 9706 Internet: http://www.duncker-humblot.de Dieses Buch widme ich den 115 Opfern eines beispiellosen Verbrechens, von denen 26 bis heute nicht identifiziert wurden und deren Schicksal ungeklärt blieb, sowie deren Angehörigen, allen Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft, den Gefallenen der Streitkräfte all jener Nationen, die ihr Leben und ihre Zukunft gegeben haben, um unser Land vom Terror zu befreien, das Leiden Unzähliger zu beenden und uns Freiheit und die Rückkehr zu den Werten der Menschenrechte zu bringen. Diese Dankbarkeit verpflichtet uns, die Stimme zu erheben, wann immer einige Wenige mit menschenverachtenden Ideologien das Leben anderer Menschen dominieren oder für wertlos erklären wollen. -

27. Arbeitstagung Der Anatomischen Gesellschaft in Würzburg 29.09
27. Arbeitstagung der Anatomischen Gesellschaft in Würzburg 29.09.2010 bis 01.10.2010 Vorträge des Satellitensymposiums „Anatomie im Nationalsozialismus“ Vortrag 1 Rubrik: 12. Anatomie im Nationalsozialismus Abstract Nr.: Titel: "Anatomy in the Third Reich: A review of the current status of research" Autoren: Hildebrandt S.(1), Adressen: (1)University of Michigan|Division of Anatomical Sciences|Ann Arbor|USA; email:[email protected] Abstract: Although it is known that anatomists working in Germany during the Third Reich used bodies of victims of the National Socialist (NS) regime for dissection and research, a comprehensive history of the anatomy in the Third Reich has not yet been written. Such a history has to address questions about the anatomists’ political activities and ideological support of NS policies as well as about the sources of the body supply for anatomical institutions. This review of the currently available literature gives a first outline of the field. The main conclusions are: 1. German anatomists were both, supporters and victims of NS policies. In a survey of 190 anatomists, political data were available for 128. Of those, 51 were dismissed, emigrated or suffered other career interruptions for racial and political reasons. Of the 77 remaining anatomists, 67 were members of at least one of the NS organizations, with varying political activity. 2. Without exception, all anatomy departments used the bodies of NS victims for dissection and research, including those of executed prisoners. This practice was independent of the political affiliation of individual anatomists. 3. Third, German anatomists under the leadership of Eugen Fischer were instrumental in developing the biological foundation of racial hygiene, which became the scientific justification of NS policies such as sterilization, extermination and mass murder. -

Straßburger Schädelsammlung« – Fritz Bauers Letzter Fall
Zeitgeschichtliche Forschungen 52 Forschungen Zeitgeschichtliche Das SS-Ahnenerbe und die „Straßburger Schädelsammlung“ – Fritz Bauers letzter Fall Von Julien Reitzenstein Duncker & Humblot · Berlin JULIEN REITZENSTEIN Das SS-Ahnenerbe und die „Straßburger Schädelsammlung“ – Fritz Bauers letzter Fall Zeitgeschichtliche Forschungen Band 52 Das SS-Ahnenerbe und die „Straßburger Schädelsammlung“ – Fritz Bauers letzter Fall Von Julien Reitzenstein Duncker & Humblot · Berlin Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. Umschlagbild: Tibet-Expedition – Bruno Beger mit Messschieber bei kraniometrischer Messung (© Bundesarchiv, Bild 135-KB-15-083 / Fotograf: Ernst Krause) Alle Rechte vorbehalten © 2018 Duncker & Humblot GmbH, Berlin Fremddatenübernahme: L101 Mediengestaltung, Fürstenwalde Druck: CPI buchbücher.de gmbh, Birkach Printed in Germany ISSN 0582-0200 ISBN 978-3-428-15313-8 (Print) ISBN 978-3-428-55313-6 (E-Book) ISBN 978-3-428-85313-7 (Print & E-Book) Gedruckt auf alterungsbeständigem (säurefreiem) Papier entsprechend ISO 9706 Internet: http://www.duncker-humblot.de Dieses Buch widme ich den 115 Opfern eines beispiellosen Verbrechens, von denen 26 bis heute nicht identifiziert wurden und deren Schicksal ungeklärt blieb, sowie deren Angehörigen, allen Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft, den Gefallenen der Streitkräfte all jener Nationen, die ihr Leben und ihre Zukunft gegeben haben, um unser Land vom Terror zu befreien, das Leiden Unzähliger zu beenden und uns Freiheit und die Rückkehr zu den Werten der Menschenrechte zu bringen. Diese Dankbarkeit verpflichtet uns, die Stimme zu erheben, wann immer einige Wenige mit menschenverachtenden Ideologien das Leben anderer Menschen dominieren oder für wertlos erklären wollen.