Fortschreibung Integrationskonzept Kreis Herford Zur Vorlage 117/2019
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
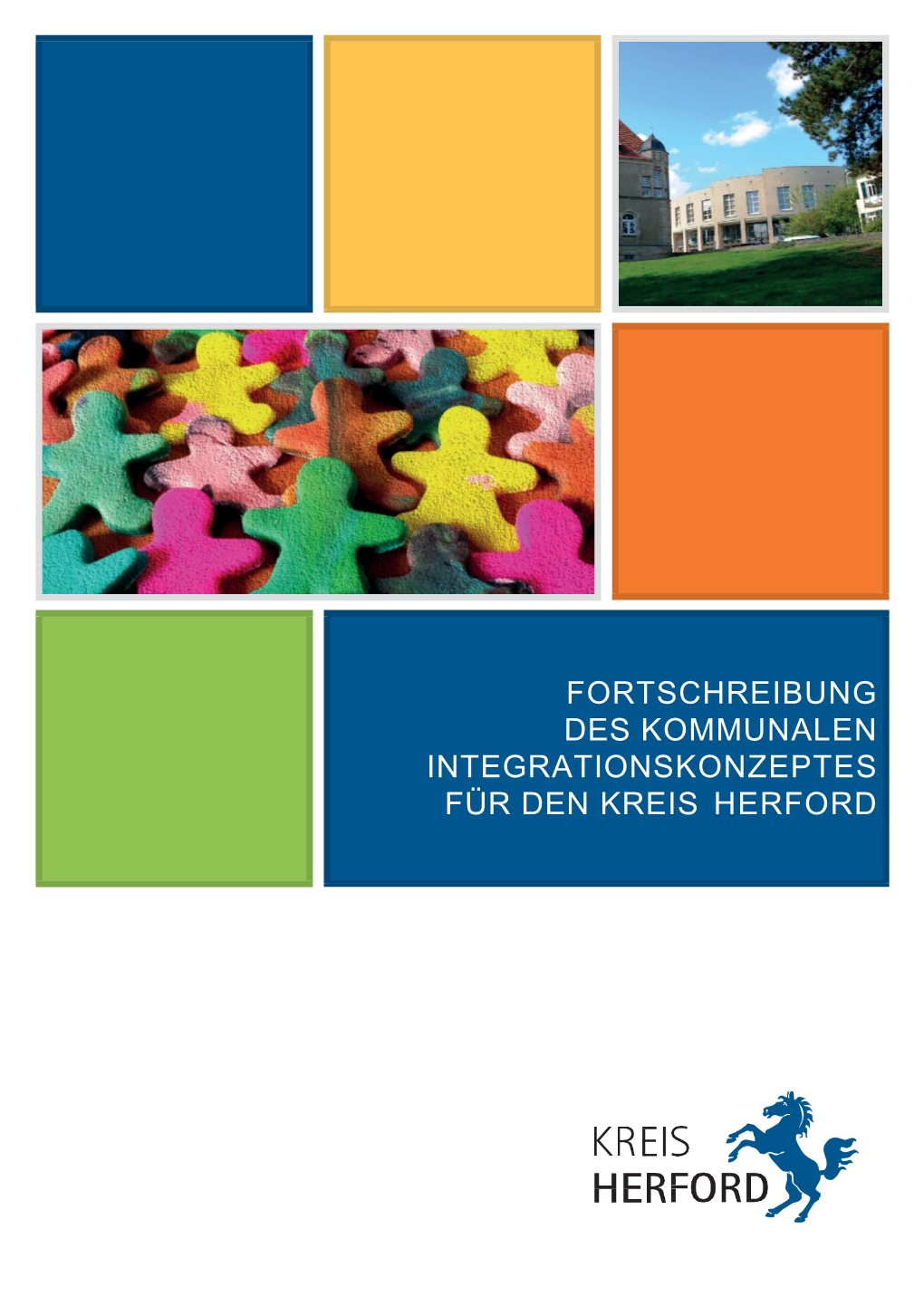
Load more
Recommended publications
-

Acquisition of a Portfolio of Eight Rest Homes in Germany, Subject to Outstanding Conditions
PRESS RELEASE Regulated information 3 November 2014 – After closing of markets Under embargo until 17:40 CET AEDIFICA Public limited liability company Public regulated real estate company under Belgian law Registered office: avenue Louise 331-333, 1050 Brussels Enterprise number: 0877.248.501 (RLE Brussels) (the “Company”) Press release Acquisition of a portfolio of eight rest homes in Germany, subject to outstanding conditions - 8 rest homes in North Rhine-Westphalia and in Lower Saxony, totalling 642 beds - Initial gross rental yield: approx. 7% - Tenant: Residenz-Gruppe Bremen - Once the outstanding conditions are fulfilled, Aedifica’s portfolio will comprise 13 rest homes in Germany - The total value of the German portfolio to rise above €100 million Stefaan Gielens, CEO of Aedifica, commented: "We look forward to taking another important step in the development of our German portfolio, with the addition of 8 rest homes. These rest homes are recent constructions of high quality and for which 25-year long-term leases have been established. Investing in German rest homes is the logical next step in Aedifica’s effort to diversify its assets within its main strategic segment, senior housing. Germany presents significant investment opportunities in this segment: it offers the largest European market and an even stronger demographic trend toward a population ageing than that observed in Belgium. Care operators continue to grow and consolidate and, as in all Western European countries, the need for financing solutions for real estate infrastructure in the healthcare sector will inevitably grow.” 1/5 PRESS RELEASE Regulated information 3 November 2014 – After closing of markets Under embargo until 17:40 CET Aedifica is pleased to announce the signing of a share purchase agreement for the acquisition of 3 companies based in Luxemburg, owners of 8 rest homes in Germany. -

The Lohmeyer Families !"#$%&'#()*+,+&#-+).*"*&#/01234050670
The Lohmeyer Families !"#$%&'#()*+,+&#-+).*"*&#/01234050670# Reflecting on the meaning of the surname, it is possible that different Lohmeyer families arose simultaneously and independently from each other in different places. “Loh” means ‘forest’, specifically ‘oak forest’. Lohmeyer is therefore the farmer whose farm is located in or at the forest edge. A thousand years ago, the land on the lower Weser river was all covered with forest. When the Saxons came to cultivate the land, they first needed to burn and clear the forest before the land could be made arable. In northern Westfalia, even today2, there are often no closed villages, but every farm is located centrally to its landholdings, often ! hour from his nearest neighbour. Certainly, the word “loh” is purely of lower saxon origin3. The families named Lohmeyer, Lohmeier and Lomeier must therefore all originate from the Provinces Westfalia and Hannover and I have been successful in localising most of the families to that area, eight families even to the region close to Minden on the Weser. It is therefore not impossible that, had church records survived the time of the 30 Years War and had they existed before the ‘Bauernkriege’4, one might be able to prove a closer linkage between some of these families. To date, I am aware of the following 16 Lohmeyer families:5 1. MY father was originally ‘königlich dänischer Landbauinspektor’ and later ‘königlich preussischer Baurat für das Herzogtum Lauenburg’6, not to be confused with Carl Lohmeier, who was ‘Landbauinspektor’ of the Grand-Duke of Mecklenburg-Strelitz, lived about 40 years earlier and who belonged to Family 7. -
Landerlebnisse Im Ravensberger Land
* ! " # $% & # ' $(# ) " * % * +,* ' * $ - ( * $( (. ( . /0 $1 ( . ( (#- ) ' 2 3 0 $( 1 -4 " )-5 $ - / - # ) $ % 6##-/" . ! 3 # $ ' *$' 7 % . / % . 0 - 8 - * - $ & * % & *5 $ 9 9 5 - 5 ) & ? ; @ ) , ! / < ' << 4 =>= *$) $ => : @ ) F ' -& '. (& * $ 5 0 ' 2 5 76 7 D * ! E ' 78 7 " ' C 7G )- ' 8H" 8 1'% 8% # * I ' 1 . ( - B' -$J ( - @ - * -$ B' */ (D# $ G( - G( D $ C K' " C $"$L M' * I'J$"$L C K K " 0 " KI5J $"$L # ' $ %- M% 1 K( / K ##K - I%'BJ C * M(# $ K $"$ , Betriebsübersicht mit Link Seite Obsthof und Bauerncafe Hentzschel Rödinghausen 6 Oberschulten Hof - Oberwahrenbrock Rödinghausen 7 Cabalance - Kuhlmann Rödinghausen-Bieren 8 Hof Ostermeyer Rödinghausen-Bieren 9 Ferienhof Quest Rödinghausen-Bieren 10 Brüngers Land-Wirtschaft - Jürging Rödinghausen-Bruchmühlen 11 Hof Grothaus Rödinghausen-Ostkilver 12 Bioland-Hof Springhorn Rödinghausen-Schwenningdorf 13 Hof Stühmeyer Rödinghausen-Westkilver 14 Pensionspferde Wellmann Bünde-Ahle 15 Helenen-Hof - Meise-Reckefuss Bünde-Dünne 16 Steckenpferd - Kreft Bünde-Muckum 17 Kartoffelhof Ottensmeier Bünde-Spradow 18 Hof Wibbeler Bünde-Spradow 19 fasziNATUR - Urschel / Köhn Löhne 20 Hof Stuke Löhne-Bischofshagen -

Enger-Spenge DIENSTAG 7
Enger-Spenge DIENSTAG 7. FEBRUAR 2017 ugegeben: Der Mann fuhr schweißnasse Hände beka- Zeinen ordentlichen Stie- men. „Wie der fährt!“, raunte fel. Doch Bolle war es recht, die eine hörbar. dass der Busfahrer tüchtig Gas An der nächsten Haltestelle gab. Immerhin hatte er Ver- drehte sich der Fahrer um: „Es spätung, als er ihn an der Hal- heißt ,Wie das Pferd‘, gnädige testelle aufgelesen hatte – soll- Frau.“ te Bolle seinen Zug doch noch Dann schloss er die Tür – bekommen,würdeersichnicht und gab wieder Gas. beschweren. Irgendwie passend, dass ei- Ganz im Gegensatz zu zwei ne großartige Retourkutsche älteren Damen, die hinter dem von einem Busfahrer kommt, Fahrer ob dessen Fahrstil dachte sich . Bolle CRe 6_XVc SVcÊe 9RfdYR]e ¥ Enger (acht). Die Einbringung und Beratung des Haushalts- planes sind ein Tagesordnungspunkt der nächsten Sitzung des Ra- tes in Enger am kommenden Montag, 13. Februar, ab 17.30 Uhr im Ratssaal. Außerdem wird der Antrag des Evangelischen Kran- kenhauses Enger wegen finanzieller Zuwendungen diskutiert. Außerdem stehen Änderungen der Bebauungspläne Nr. 48 „Am Kleinbahnhof“ und Nr. 45 „Bruchfeld“ an an. DZ_XV_ ^Ze UV^ 5f` 5cfdTYSR ¥ Enger (nw). Ein Treffen zum gemeinsamen Singen beginnt am kommenden Montag, 13. Februar, um 16 Uhr im Genera- tionentreff Enger (GTE), Wertherstraße 22, im Rahmen der Rei- he „Jung und Alt – Umgang mit Musik und Erinnerungspfle- ge“. Eingeladen sind alle Menschen, die Freude an Musik und 6i`eZdTYV <`deac`SV_+ Kumiko Ogawa-Müller lud im Anschluss an die Matinee zu japanischen Köstlichkeiten ein. FOTOS: BRITTA BOHNENKAMP-SCHMIDT am Singen haben. Der Eintritt ist frei. E`]]V GVcSZ_Uf_X g`_ <]R_X f_U 3VhVXf_X Blckli$ le[ M\ib\_ijm\i\`e c[k \`e1 Musikalische Matinee im Gemeindezentrum ¥ Enger/Spenge (nw). -

Grundstücksmarktbericht 2020 Für Den Kreis Herford
Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Kreis Herford und in der Stadt Herford Grundstücksmarktbericht 2020 für den Kreis Herford www.boris.nrw.de Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Kreis Herford und in der Stadt Herford Grundstücksmarktbericht 2020 Berichtszeitraum 01.01.2019 - 31.12.2019 Übersicht über den Grundstücksmarkt im Kreis Herford Herausgeber Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Kreis Herford und in der Stadt Herford Geschäftsstelle Amtshausstraße 2 32051 Herford Telefon 05221/13 2503 Fax 05221/13 17 2506 E-Mail: [email protected] Internet: www.gars.nrw/herford Gebühr Das Dokument kann unter www.boris.nrw.de gebührenfrei heruntergeladen werden. Bei einer Bereitstellung des Dokuments oder eines gedruckten Exemplars durch die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses be- trägt die Gebühr 46,- EUR je Exemplar (Nr. 5.3.2.2 des Kostentarifs der Kostenordnung für das amtliche Ver- messungswesen und die amtliche Grundstückswertermittlung in Nordrhein-Westfalen) Bildnachweis Geschäftsstelle Lizenz Für den Grundstücksmarktbericht gilt die "Datenlizenz Deutschland –Zero – Version 2.0“ (dl-de/zero-2-0). Sie können den Lizenztext unter www.govdata.de/dl-de/zero-2-0 einsehen. Vorwort Der Grundstücksmarktbericht 2020 stellt eine Übersicht über das Grundstücksmarktgeschehen im Gebiet des Kreises Herford dar. Die regionale Entwicklung des Grundstücksmarktes im hiesigen Raum wird durch eine zusammenfassende Darstellung von Grundstücksdaten aufgezeigt. Dabei dürfte der Marktbericht vor allem das Interesse derjenigen Stellen und Personen finden, die sich von Berufs wegen mit dem Geschehen auf dem Grundstücksmarkt beschäftigen. Aber auch für die kommunalen Verwaltungen mit den Aufgabenbereichen Städtebau, Bodenordnung, Wirt- schaftsförderung und Wohnungswirtschaft können die hier veröffentlichten Rahmendaten eine wertvolle Arbeitshilfe sein. Die nachfolgend veröffentlichten Marktdaten wurden überwiegend mit Hilfe statistischer Auswerte- methoden gewonnen. -

Bike-Heft-Tour8.Pdf
¯ Seite hier einkürzen tour Herford, Hiddenhausen, Enger start Bahnhof Herford länge 50 km 8 Einfach kunstvoll genießen ziel Liesbergmühle Enger dauer 5 h touristische ziele gastronomie Museum MARTa MARTa Café Die Route durch die Herforder Innenstadt zeigt die Se- Goebenstr. 4–10 · Herford Goebenstr. 4–10 · Herford henswürdigkeiten der rund 1.200 Jahre alten Hansestadt. Telefon 05221 9944300 Telefon 05221 9931290 Den Bogen zur Moderne schlägt das Museum Marta mit Daniel-Pöppelmann-Haus Elsbach Restaurant Deichtorwall 2 · Herford Goebenstr. 3 · Herford seiner spektakulären Architektur. Der sportliche Teil der Telefon 05221 189689 Telefon 05221 282828 Strecke führt Sie durch das hügelige Wittekindsland bis Herforder Münster u. Rathaus Gastronomie am Alten Markt nach Bad Salzuflen. Entlang des Werreufers fahren Sie Münsterkirchplatz · Herford Alter Markt · Herford zurück nach Herford. Auf dem Weser-Lippe-Radweg geht Safety Cones HudL Kreuzung Bergertor · Herford Unter den Linden 12 · Herford es dann nach Hiddenhausen und Enger. Erkunden Sie Telefon 05221 1891015 H2O Herford in Hiddenhausen die saftig grünen Wiesen des Natur- Wiesestr. 90 · Herford Hotel Waldesrand schutzgebietes Füllenbruch. Die Werre-Aue und der Telefon 05221 922277 Zum Forst 4 · Herford Telefon 05221 92320 Schweichelner Wald laden mit ihrer intakten Natur zum Tierpark Herford Stadtholzstr. 234 · Herford Waldrestaurant Steinmeyer Verweilen ein. Entlang des Bolldammbaches gelangen Telefon 05221 81284 Wüstener Weg 47 · Herford Sie nach Enger in den Stadtpark Maiwiese. Folgen Sie ab Telefon 05221 81004 Bismarckturm hier der ausgeschilderten »KulTour Enger« zu den Sehens- Herforder Wirtschaft Biologiezentrum Gut Bustedt Bünder Str. 38 · Hiddenhausen würdigkeiten der Widukindstadt. Gutsweg 35 · Hiddenhausen Telefon 05221 62224 Telefon 05223 87031 Zum Mittelpunkt Holzhandwerksmuseum Milchstr. -

Evangelisches Krankenhaus Enger Ggmbh Fachklinik Für Geriatrie
*Enger 20.01.1998 8:25 Uhr Seite 31 Evangelisches Krankenhaus Enger gGmbH Fachklinik für Geriatrie Kein Krankenhaus im Kreis Herford kann auf sprechende Räume wie Übungsküche und eine vergleichbar lange medizinische Tradition Übungsbad erleichtert. und Entwicklungsgeschichte zurückblicken wie Neurologische Erkrankungen mit Störungen das Ev. Krankenhaus Enger. des Sprach- und Schluckvermögens werden in 1873 erbaut zur Versorgung hilfsbedürftiger der Sprachtherapeutischen Abteilung behandelt. Menschen, erfüllte das Krankenhaus im Rahmen der Landesplanung über viele Jahre Eine enge Begleitung erfahren die Patienten seinen Auftrag zur Akutversorgung der durch das Pflegepersonal, das durch aktivieren- Bevölkerung der Stadt Enger und Umgebung. de Maßnahmen die Möglichkeiten zur Im Zuge einer flexiblen Anpassung an die medi- Selbstfürsorge fördert und therapeutische zinischen Bedürfnisse alter Menschen wurde Behandlungserfolge unterstützt. das Haus 1994 unter neuer Trägerschaft zu einer Fachklinik für Geriatrie (Altersheilkunde) Krankheit bringt oft Veränderung in vielen mit 63 vollstationären Betten umgewidmet. Lebensbereichen des alten Menschen mit sich. Hilfe bei der Lösung der daraus resultierenden lastungs-EKG, Langzeit-EKG, Langzeitblutdruck- Probleme im sozialen Umfeld bietet der messung und Lungenfunktionsdiagnostik. Sozialdienst an. Um jedoch den speziellen Problemen der Mittlerweile hat sich die geriatrische Fachklinik Alterspatienten gerecht zu werden, ist eine und das interdisziplinäre Therapiekonzept im enge Zusammenarbeit mit anderen -

W Egweiser Für Frauen Im Kreis Herford
Wegweiser für Frauen im Kreis Herford Wegweiser für Frauen im Kreis Herford 2 Vorwort Liebe Frauen, liebe Leserinnen und Leser, mit diesem Wegweiser für Frauen im Kreis Herford liegt in- zwischen die sechste Zusammenstellung von Informations- und Anlaufstellen, Institutionen und Initiativen vor, die Dienstleistungen und Angebote für Frauen vorhalten. Die Gleichstellungsstellen im Kreis Herford, die diese Aktua- lisierung erarbeitet haben, freuen sich, interessierten Frau- en und zahlreichen Multiplikatorinnen und Multiplikatoren erneut diese aktuelle Übersicht zur Verfügung zu stellen. Diese Broschüre soll sowohl im Alltagsleben unterstützen als auch in frauenpolitischen Diskussionen hilfreich und nützlich sein. Wir bedanken uns für die finanzielle Unterstützung der BKK Herford-Minden-Ravensberg und die Förderung des Minis- teriums für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter des Landes Nordrhein-Westfalen. Ohne die tatkräftige Mitarbeit der Praktikantinnen Christina Isatschenko und Ana Suta wäre diese neue Auflage nicht Realität geworden. Ihnen möchten wir besonders danken. Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Gleichstellungsstellen im Kreis Herford März 2015 3 Kommunale Gleichstellungsstellen und Frauenbüros im Kreis Herford Sich für die Gleichstellung und Chancengleichheit von Frauen und Männern einzusetzen – innerhalb und außerhalb der Kommunalverwal- tung – das ist seit über zwanzig Jahren die immer noch aktuelle Aufga- be der Kommunalen Gleichstellungsstellen/Frauenbüros. Gesetzliche Grundlage für die Arbeit sind das Grundgesetz Artikel 3, Absatz 2, die Gemeindeordnung NRW und das Landesgleichstellungs- gesetz. Die Gleichstellungs- und Frauenbeauftragten im Kreis Herford wirken als Interessenvertretung für Frauen, begleiten und gestalten – zusam- men mit der Verwaltung und anderen – kommunales Handeln. Sie ver- suchen dafür sensibel zu machen, wie sich kommunale Entscheidungen auf Frauen und Männer auswirken, um zu gerechten Lösungen für bei- de Geschlechter zu kommen. -

Im Kreis Herford
_____________________________________________________________________________ Bauernhof als Klassenzimmer Seite 1 _____________________________________________________________________________ Kreisverband Herford Projekt: „Bauernhof als Klassenzimmer“ Bauernhöfe im Kreis Herford _____________________________________________________________________________ Bauernhof als Klassenzimmer Seite 2 _____________________________________________________________________________ Einführung: Projekt „Bauernhof als Klassenzimmer“ Eine spannende Entdeckungsreise in die Welt der Tiere und Pflanzen bietet das Projekt „Lernen auf dem Bauernhof“, des Landwirtschaftlichen Kreisverbandes Herford: 20 Familienbetriebe im Kreis laden Schulklassen und Kindergartengruppen auf ihre Höfe ein. Im Rahmen des Unterrichtes können Kinder und Jugendliche mit allen Sinnen Natur, Umwelt sowie die Herkunft der Nahrungsmittel erleben. Landwirtschaft ist nicht nur lebenswichtig, sondern auch höchst interessant – und teilweise richtig spannend. Auf jeden Fall gibt es eine Menge zu entdecken, zu erfahren und zu erleben. Der Bauernhof als Klassenzimmer bietet einen umfassenden Einblick in die Erlebniswelt Landwirtschaft. Darüber hinaus werden das Zusammenspiel zwischen Mensch und Natur ganzheitlich sichtbar und erlebbar. Ökologie, Ökonomie, Soziologie, Landschaftsbild und Landwirtschaft fügen sich hier zu einer Einheit zusammen. Gleichzeitig wird auch das Spannungsfeld deutlich, in dem sich unsere Landwirtschaft heute befindet. Denn die Anforderungen an Nahrungsmittelqualität, -

MEMO 98 – Media Monitoring Findings, Final Summary Report 2 Dr
MEMO 98 – Media Monitoring Findings, Final Summary Report 2 Dr. Susanne Spahn - Thüringen – eine Region mit starken Bindungen zu Russland 47 Alan Posener - Wenn die AfD klingt wie die antiimperialistischen Linken, Welt 73 Boris Schumatsky - Ein Schweizer ist Putins fleißigster Internetkrieger, Die Welt 78 Boris Schumatsky – The Epoch Times 83 Democracy Digest - Ways to neutralize Russia’s disinformation (at least partially) 93 Henk Van Ess & Jane Lytvynenko - This Russian Hacker Says His Twitter Bots Are Spreading 97 Messages To Help Germany’s Far Right Party In The Election, Buzzfeed Henk Van Ess - Anleitung: Tipps um Fake Tweets zu entlarven, ZDF 102 Konstantin von Hammerstein, Roman Höfner and Marcel Rosenbach - March of the Trolls: 120 Right-Wing Activists Take Aim at German Election, Spiegel Online Nikolai Klimeniouk – Einmal Speck und Diesel, FAZ 127 Nikolai Klimeniouk - Eine Minderheit, die keine sein will, Welt 128 GERMANY Parliamentary Elections | 24 September 2017 Media Monitoring Findings FINAL Summary Report (8 July - 22 September 2017) 24 November 2017 MEMO 98 Martinengova 8, 811 02 Bratislava, Slovakia | www.memo98.sk, [email protected], +421 903 581 591 2 MEMO 98 1. INTRODUCTION MEMO 98, in cooperation with Internews Ukraine, monitored five Russian-speaking channels and three other outlets prior to the 24 September 2017 parliamentary elections in Germany.1 The monitoring was carried out in three different periods between 8 July and 22 September 2017. The methodology included quantitative and qualitative analysis developed by MEMO 98 that conducted similar projects in more than 50 countries over the course oF twenty years since 1998. Given its comprehensive and content-oriented approach, the methodology was specially designed to provide in-depth Feedback on pluralism in media reporting, including coverage of chosen subjects and topics. -
Denkmäler Im Kreis Herford Mit Dem Fahrrad Erkunden
DENKMAL StippVisiten Spezial Denkmäler im Kreis Herford mit dem Fahrrad erkunden HIDDENHAUSEN Herausgeber: Kreis Herford Denkmäler im Kreis Herford - mit dem Fahrrad erkunden! StippVisiten laden ein Über 2500 Denkmäler gibt es im Kreis Herford und viele davon lassen sich bequem per Fahrrad anfahren und be- sichtigen. Kreisheimatverein und Denkmalbehörde haben für jede Kommune besonders prägnante Denkmäler aus- gewählt. In drei neuen Heften werden diese zusammen mit weiteren Besonderheiten in der Nähe ausführlich vorgestellt. Um die ausgesuchten Denkmäler mit dem Rad entdecken zu können, hat die Biologische Station Ravensberg für jede Kommune im Kreisgebiet einen speziellen Denkmal-Rund- kurs entwickelt. Viele der Denkmäler, die wie Perlen an der Kette entlang des Weges liegen, verbinden die Geschichte der Landschaft mit den Geschicken der Menschen. Gerade mit dem Fahrrad lässt sich diese jahrhundertelange Beziehung z.B. bei alten Bauernhöfen, Industriebauten oder Gutsanlagen besonders »Wir wollen unsere Ehre darin suchen, die gut erleben. Schätze der Vergangenheit möglichst Dieser Flyer stellt Ihnen die Fahrradroute zu den Denkmä- unverkürzt der Zukunft zu überliefern.« lern in Hiddenhausen vor. Start und Ziel ist der Parkplatz am Holzhandwerksmuseum/Haus Hiddenhausen. Natürlich ist Georg Dehio, 1901 es auch möglich, von jedem anderen Ort auf der Route zu starten. Detailliertes Kartenmaterial hilft Ihnen bei der Ori- entierung. Zu jedem Denkmal gibt es eine kurze Information. Ausführliche Beschreibungen zu allen Denkmälern finden Sie im StippvisitenSpezial-Heft „Denkmäler im Kreis Herford: Enger – Hiddenhausen – Kirchlengern“. Tipp Lassen Sie sich bei Ihrer Tour vom Mobiltelefon oder ! Navigations-Gerät leiten! So finden Sie zuverlässig Ihren Weg und können sich entspannt auf Landschaft und Denkmäler konzentrieren. Die dazu nötige GPX-Datei der Denkmal-Fahrradroute Herford können Sie kostenlos von unserer Homepage www.fahr-im-kreis.de herunterladen. -

Clubs Missing a Club Officer 2011
Lions Clubs International Clubs Missing Club Officer for 2011-2012 (Only President, Secretary or Treasurer) (No District) Club Club Name Title (Missing) 27949 PAPEETE President 27949 PAPEETE Secretary 27949 PAPEETE Treasurer 27952 MONACO DOYEN President 27952 MONACO DOYEN Secretary 27952 MONACO DOYEN Treasurer 30809 NEW CALEDONIA NORTH President 30809 NEW CALEDONIA NORTH Secretary 30809 NEW CALEDONIA NORTH Treasurer 33988 GIBRALTAR President 33988 GIBRALTAR Secretary 33988 GIBRALTAR Treasurer 34460 BELMOPAN President 35917 BAHRAIN LC President 35917 BAHRAIN LC Secretary 35917 BAHRAIN LC Treasurer 41122 PORT AU PRINCE CENTRAL President 41122 PORT AU PRINCE CENTRAL Secretary 41122 PORT AU PRINCE CENTRAL Treasurer 44697 ANDORRA DE VELLA President 44697 ANDORRA DE VELLA Secretary 44697 ANDORRA DE VELLA Treasurer 45478 PORT AU PRINCE DELMAS President 45478 PORT AU PRINCE DELMAS Secretary 45478 PORT AU PRINCE DELMAS Treasurer 47478 DUMBEA President 47478 DUMBEA Secretary 47478 DUMBEA Treasurer 54276 BOURAIL LES ORCHIDEES President 54441 KONE President 54441 KONE Secretary 54441 KONE Treasurer OFF0021 Run Date: 7/3/2011 8:00:57PM Page 1 of 1229 Lions Clubs International Clubs Missing Club Officer for 2011-2012 (Only President, Secretary or Treasurer) (No District) Club Club Name Title (Missing) 55769 LA FOA President 55769 LA FOA Secretary 55769 LA FOA Treasurer 57378 MINSK CENTRAL President 57378 MINSK CENTRAL Secretary 57378 MINSK CENTRAL Treasurer 57412 ALUKSNE President 57412 ALUKSNE Secretary 57412 ALUKSNE Treasurer 58998 ST PETERSBURG