Einfluss Der Luftrettung
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
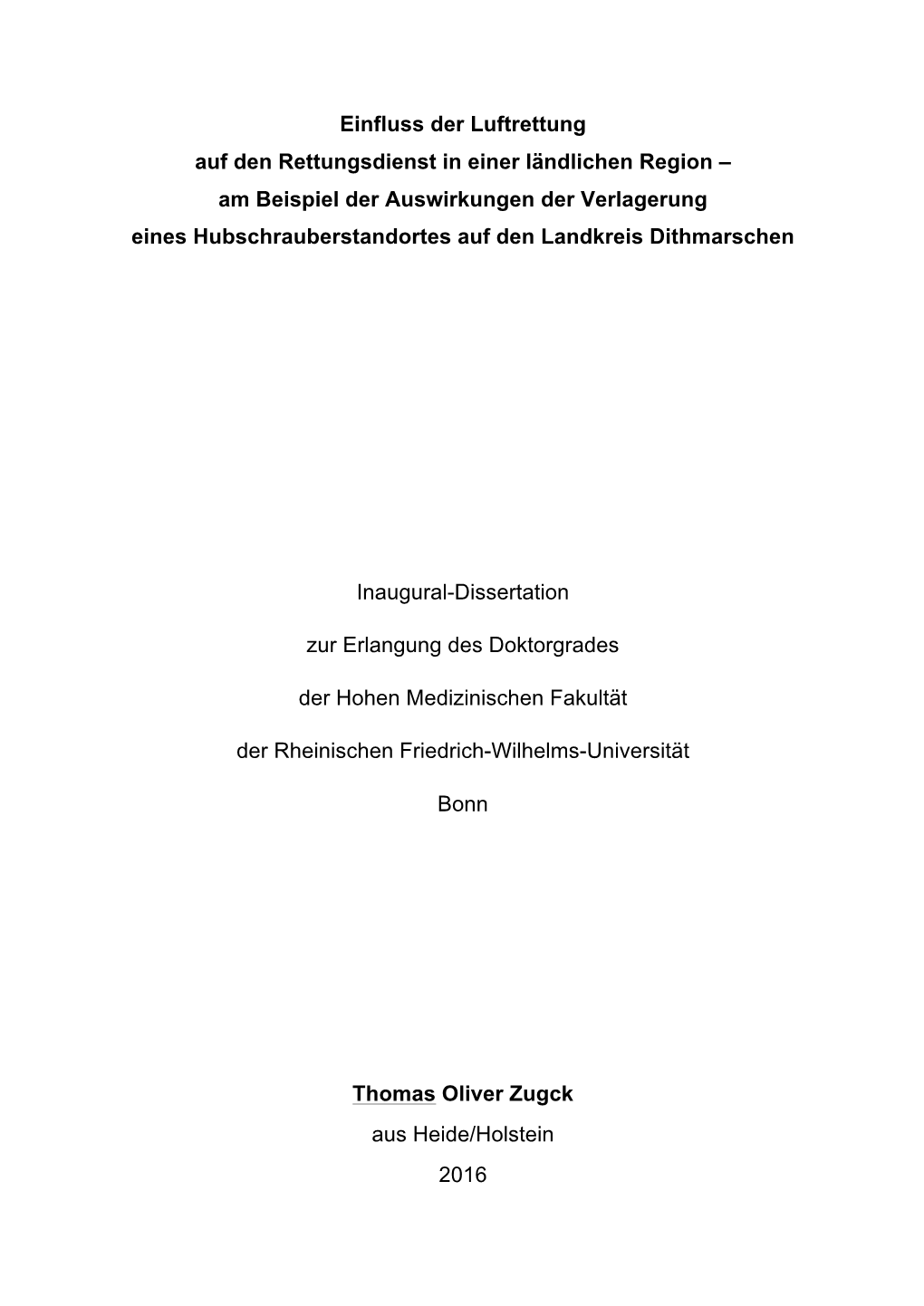
Load more
Recommended publications
-

103. Volksfest Tellingstedt Vom 14
Jahrgang 8 27. Juli 2015 Ausgabe 15 103. Volksfest Tellingstedt vom 14. - 16. August 2015 Bericht siehe Seite 28 Amt Eider – 2 – Nr. 15/2015 Tagesordnung: 1. Einwohnerfragestunde 2. Genehmigung der Niederschrift Nr. 11 vom 18.05.2015 3. Entlassung des bisherigen Amtsvorstehers durch den 1. stellvertretenden Amtsvorsteher 4. Wahl der Amtsvorsteherin/ des Amtsvorstehers unter der Leitung des 1. stellvertretenden Amtsvorstehers 5. Ernennung der neu gewählten Amtsvorsteherin/ des neu ge- wählten Amtsvorstehers, Vereidigung und Amtseinführung durch den 1. stellvertretenden Amtsvorsteher Gratulation zum Betriebsjubiläum 6. Übergabe des Vorsitzes an die neu gewählte Amtsvorstehe- rin/ den neu gewählten Amtsvorsteher Unserem Hausmeister der Eiderlandschule Hennstedt- 7. Wahl eines Mitgliedes in den Schulausschuss Lunden, Standort Lunden, Siegfried Petersen, gratulieren wir 8. Auftragsvergabe zur Möblierung des Grundschulanbaus der ganz herzlich zu seinem 25-jährigen Betriebsjubiläum, dass Eiderlandschule er am 14.07.2015 begehen konnte. 9. Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen am Sekundarstu- Wir bedanken uns auf diesem Wege für die jahrelange, sehr fengebäude der Eiderlandschule gute Zusammenarbeit mit ihm sowie seine Treue zum Amt 10. Eingaben und Anfragen Eider und wünschen ihm alles Gute und uns noch viele wei- Der nachfolgende Tagesordnungspunkt wird nach Maßgabe tere Jahre der gemeinsamen Arbeit! der Beschlussfassung durch den Amtsausschuss voraus- sichtlich nicht öffentlich behandelt: Die Verwaltungsleitung sowie die Kolleginnen und 11. Grundstücksangelegenheiten, Kollegen des Amtes KLG Eider hier: Veräußerung eines Grundstücks Mit freundlichen Grüßen gez. Tjark Schütt Gratulationen im August 2015 stv. Amtsvorsteher im Amtsbezirk Amt Kirchspielslandgemeinden Eider Wir haben im August 2015 4 Geburtstagskinder und vier gol- dene Hochzeiten. Hierzu gratulieren wir sehr herzlich und wünschen alles Gute! Datum Anlass Anschrift 07.08. -

Histour Karte Dithmarschen
T Witzwort Hude Süderhöft Osterhever Koldenbüttel Bergenhusen ÜbersichtskarteOldenswort Friedrichstadt Alt Bennebek Seeth Norderstapel HISTOURDithmarschen Tetenbüll Der Heider Markt Drage Harblek Süderstapel Alte Der Heider Markt entstand 1434 als Areal für die So Meggerdorf Landesversammlung der unabhängigen Dithmar- rg scher Kirchspiele. Wöchentliche Tre en der bäuer- Katharinenheerd Lehe St. Annen e lichen Landesregenten seit 1447 führten nicht nur zu einem florierenden Wochenmarkt und zum Bau der Kirche, sondern auch zur Ansiedlung rund um Lunden den Platz, ausgehend von dörflichen Anfängen um 1400 etwas weiter westlich. Der neu entstandene Hauptort der Bauernrepub- Horst Christiansholm lik entwickelte sich auch nach der Eroberung und Kating Krempel Aufteilung Dithmarschens zum bedeutendsten Ort Garding der Region mit dem (neben Freudenstadt) größten Marktplatz Deutschlands. Seit dem späten 15. Jahrhundert ist der Sonnabend Schlichting Friedichsholm Der Markt von Norden um 1740, noch mit der Vogelstange für den Schützenvogel. Links davon das Spritzenhaus für die Feuerbekämpfung und rechts die Schule. Markttag. Seit 1990 findet hier alle zwei bis drei Jah- Welt Tönning Berge- re das Fest „Heider Marktfrieden“ statt. Die heutige Delve Erfde Bebauung stammt aus dem 19. bis 21. Jahrhundert. L wöhrden Älter sind das alte Pastorat (1739) und das „Dree- Groven Rehm- Kleve Bargen tornhus“ Süderstraße 2 (1733). Vollerwiek Hohn Hennstedt Sonnabendmarkt in Heide, Lithogra e Hemme Flehde- Fedderingen E kurz vor oder um 1850 nach H. Klinck. Hollingstedt ider Bargen Wallen H26 Wiemerstedt Glüsing Pahlen Tielenhemme Verein für Dithmarscher r HN Dörpling Landeskunde e.V. E i d e Karolinen- Stelle- Bargstall koog Strübbel Wittenwurth Wesselburener- Linden HISTOUR Dithmarschen koog Norderheistedt Schalkholz Schülp Hövede Neuenkirchen Weddingstedt HISTOUR ist ein Informationssystem, das zu Hillgroven Barkenholm zahlreichen Natur- und Kulturdenkmalen im WD Dellstedt Tellingstedt Ferienland Dithmarschen an der Nordseeküste W Tiebensee Süderheistedt T Schleswig-Holsteins führt. -

Hauptlauf ( 10 Km )
35. Heider Abendstadtlauf 07. Juni 2019 Ergebnis M / W - Altersklassen Hauptlauf ( 10 Km ) Hauptlauf M - JU14 Pos StNr Gesamt Name Vorname Jg. Verein / Ort Nat. Pos Gesamtfeld 1 69100:44:24 Dümmer Linus 2006Werner - Heisenberg - GER-SH 63 Gymnasium Heide 2 51700:44:57 Berndt Delf 2008Schulen am Moor GER-SH 71 3 59800:45:19 Reinecke Dustin Taylor 2007Team Kunterbunt GER-SH 83 4 8400:46:24 Luck Arthur 2009Heide GER-SH 107 5 51500:48:27 Zieren Lovis 2006Schröder Bauzentrum GER-SH 147 6 38200:48:49 Jürgens Marvin 2009MTV Burg GER-SH 155 7 52600:50:48 Franke Janosch 2006SG Mitteldithmarschen GER-SH 197 8 30000:51:32 Balschuweit Milan 2007Gymnasium Heide-Ost GER-SH 216 9 30800:51:35 Paßehl Jannes 2006Gymnasium Heide-Ost GER-SH 218 10 11600:51:52 Scheel Henri Alexander 2009Windberrgen GER-SH 224 11 74400:52:41 Thomsen Torge 2008Grundschule Wesselburen GER-SH 238 12 33000:52:42 Wartenberg Willem 2006HSG Weddingstedt - MJC GER-SH 240 Handball 13 69500:53:44 Tiedemann Noah 2006Werner - Heisenberg - GER-SH 264 Gymnasium Heide 14 69300:54:45 Schilly Marten 2008Werner - Heisenberg - GER-SH 290 Gymnasium Heide 15 7000:55:57 Krasniqi Julian 2006Lunden GER-SH 312 16 31000:56:26 Schweda Jochen 2006Gymnasium Heide-Ost GER-SH 322 17 6900:57:22 Koll Oscar Tobias 2009Wesseln GER-SH 341 18 74200:58:12 Grünhagen Luca 2008Gymnasium Heide-Ost GER-SH 352 19 20700:58:39 Nagel Lovis 2006Eider-Nordsee-Schule GER-SH 358 Wesselburen 20 44200:59:02 Becker Arthur 2011Physio BeckerDörpling GER-SH 364 21 29401:00:01 Dahamchoki Reber 2010Grundschule Lüttenheid GER-SH 377 -

1/98 Germany (Country Code +49) Communication of 5.V.2020: The
Germany (country code +49) Communication of 5.V.2020: The Bundesnetzagentur (BNetzA), the Federal Network Agency for Electricity, Gas, Telecommunications, Post and Railway, Mainz, announces the National Numbering Plan for Germany: Presentation of E.164 National Numbering Plan for country code +49 (Germany): a) General Survey: Minimum number length (excluding country code): 3 digits Maximum number length (excluding country code): 13 digits (Exceptions: IVPN (NDC 181): 14 digits Paging Services (NDC 168, 169): 14 digits) b) Detailed National Numbering Plan: (1) (2) (3) (4) NDC – National N(S)N Number Length Destination Code or leading digits of Maximum Minimum Usage of E.164 number Additional Information N(S)N – National Length Length Significant Number 115 3 3 Public Service Number for German administration 1160 6 6 Harmonised European Services of Social Value 1161 6 6 Harmonised European Services of Social Value 137 10 10 Mass-traffic services 15020 11 11 Mobile services (M2M only) Interactive digital media GmbH 15050 11 11 Mobile services NAKA AG 15080 11 11 Mobile services Easy World Call GmbH 1511 11 11 Mobile services Telekom Deutschland GmbH 1512 11 11 Mobile services Telekom Deutschland GmbH 1514 11 11 Mobile services Telekom Deutschland GmbH 1515 11 11 Mobile services Telekom Deutschland GmbH 1516 11 11 Mobile services Telekom Deutschland GmbH 1517 11 11 Mobile services Telekom Deutschland GmbH 1520 11 11 Mobile services Vodafone GmbH 1521 11 11 Mobile services Vodafone GmbH / MVNO Lycamobile Germany 1522 11 11 Mobile services Vodafone -

Amt Burg-Süderhastedt
Amt Burg-Süderhastedt Herzlich willkommen in Burg-Süderhastedt Liebe Einwohnerinnen, liebe Einwohner, Im Namen des Amtes der Kirchspielslandgemeinde Burg-Süderhastedt begrüße ich Sie als neuen Bürger bzw. Gast und wünsche Ihnen, daß Sie sich hier in der neuen Umgebung gut einleben und wohl fühlen werden. Diese Broschüre soll eine Orientierungshilfe über die Einrichtungen im Bereich des Amtes Kirchspielslandgemeinde Burg-Süderhastedt sein. Ich hoffe, daß Sie zu einem schnelleren Kennenlernen Ihres neuen Wohnsitzes bzw. derzeitigen Aufenthaltsortes beiträgt. Für den Fall, daß Sie schon Bürger des Amtsbereiches Burg-Süderhastedt sind, meine ich, daß diese Broschüre auch manchem von Ihnen noch etwas neues über die zehn amtsangehörigen Gemeinden vermitteln kann. Mit freundlichen Grüßen (Claußen) Amtsvorsteher 1 Alphabetisches Inhaltsverzeichnis Seite Ärzte … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …13 Allgemeines … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …3 Begrüßungswort … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …1 Behördliche Einrichtungen … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …6 Gemeindeorgane … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …5 Kirchen und religiöse Gemeinschaften, Kindergärten … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …15 Kreditinstitute … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … -

Informationsblatt Amt Eider Ausgabe 04 2016.Pdf
Jahrgang 9 19. Februar 2016 Ausgabe 04 /MN[_N[NRW Ç-[Y\TRWWN[¶ X[PJWR\RN[]N *^\Ã^P RW MRN .R\QJUUN WJLQ +[XTMX[O Bitte lesen Sie den Text hierzu auf Seite 13! Postwurfsendung sämtliche Haushalte sämtliche Postwurfsendung Amt Eider – 2 – Nr. 04/2016 Fundsache Am 05.02.2016 wurde in Tellingstedt an der Bushaltestelle der Schule Tellingstedt unter einer Sitzbank ein Handy/Smartphone gefunden. Besitzansprüche können beim Amt KLG Eider bei Herrn Peters Tel. 04836 990-45 angemeldet werden. Amt Kirchspielslandgemeinden Eider Der Amtsvorsteher Dienststelle Hennstedt Gratulationen im März 2016 Einladung im Amtsbezirk Amt Kirchspielslandgemeinden Eider zu einer öffentlichen Sitzung des Bauausschusses des Amtes Kirchspielslandgemeinden Eider am Dienstag, 23. Februar 2016, um 19:00 Uhr Wir haben im März 2016 26 Geburtstagskinder, zwei goldene Sitzungsort: Amtsgebäude Hennstedt, Hochzeiten und eine eiserne Hochzeit! Hierzu gratulieren wir sehr Kirchspielsschreiber-Schmidt-Str. 1, herzlich und wünschen alles Gute! 25779 Hennstedt Datum Anlass Anschrift Tagesordnung: 01.03. 80. Geburtstag Herr Karl Helmig 1. Einwohnerfragestunde 25779 Kleve 2. Genehmigung der Niederschrift vom 01.12.2015 02.03. 85. Geburtstag Frau Johanna Dwenger 3. Mitteilungen des Vorsitzenden 25782 Tellingstedt 4. Brandschutzsanierung der Grundschule am Gehölz in Lunden 04.03. 90. Geburtstag Frau Betti Paulsen 4.1. Auftragsvergabe für eine Blitzschutzanlage für das Gebäude 25774 Karolinenkoog sowie für das Soccerfeld 04.03. 90. Geburtstag Frau Helene Hirsekorn 4.2. Beratung und Beschlussfassung über die Einrichtung von 25782 Schalkholz Notüberläufen auf dem Flachdach sowie über den Ausbau 06.03. 80. Geburtstag Frau Helga Carl von Lichtkuppeln 25774 Lunden 4.3. Beratung und Beschlussfassung über die Beseitigung der 07.03. -

Das Neueste Aus Der Gemeinde
Jahrgang: 19 10.12.2010 Ausgabe: 4/10 Das Neueste aus der Gemeinde Haushalt der Gemeinde Ostrohe für 2011 Einnahmen 2011 Ausgaben 2011 Grundschule 64.400,00 € Aufwend. für ehrenamtl. Tätigkeiten 13.200,00 € Schülerbeförderung 7.500,00 € Brandschutz 14.400,00 € Seniorenbetreuung 700,00 € Grundschule 76.800,00 € Konzessionsabgabe Strom 24.000,00 € Schulkostenbeiträge Grundschulen 4.900,00 € Konzessionsabgabe Gas 2.000,00 € Schulkostenbeiträge Regionalschulen 37.800,00 € Abwasserbeseitigung 50.000,00 € Schulkostenbeiträge Gymnasien 44.500,00 € Pachten 700,00 € Schulkostenbeiträge Sonderschulen 2.400,00 € Grundsteuer A (270 v. Hundert) 4.900,00 € Schülerbeförderung 10.100,00 € Grundsteuer B (270 v. Hundert) 92.500,00 € Grundsicherung für Arbeitssuchende 10.000,00 € Gewerbesteuer (340 v. Hundert) 110.000,00 € Seniorenbetreuung 3.300,00 € Gemeindeanteil Einkommenssteuer 285.100,00 € Ferienspaß 500,00 € Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 12.500,00 € Kostenausgleich (*) 8.000,00 € Hundesteuer 1.700,00 € Kindertagesstätten 39.100,00 € Schlüsselzuweisungen 114.000,00 € Kinderspielstunde Ostrohe 6.000,00 € Ausgleich nach dem Familienausgleich 41.200,00 € Kinderspielplätze 6.000,00 € Umsatzerlös "Dachs" 1.200,00 € Sportstätten 1.500,00 € weitere Einnahmen 6.900,00 € Planungskosten GEP/SUK 1.100,00 € Abwasserbeseitigung 63.100,00 € Gemeindestraßen und Wege 55.600,00 € Straßenbeleuchtung 5.000,00 € ÖPNV Stadtverkehr 10.300,00 € Tilgung von Krediten 14.300,00 € Kreisumlage 248.700,00 € Amtsumlage 114.300,00 € Gewerbesteuerumlage 22.700,00 € weitere -

Schleswig-Holsteinischer Landtag Umdruck 19/660
Elterninitiative Gesche Holst – Dirk Richter: Anhörung zur Drucksache 19/372 Nach dem Zusammenschluss der Schulstandorte Hennstedt, Lunden und Lehe, mit Hauptstandort Hennstedt und den beiden Außenstellen Lunden und Lehe, ist es nicht zur erhofften Verbesserung der Schulsituation vor Ort gekommen, sondern hat sich durch die Jahre eher entgegengesetzt entwickelt. Aus diesem Grund kam es bereits vor Schließung der Grundschule in Lehe und der Gemeinschaftsschule in Lunden zu sinkenden Schülerzahlen, durch Ummeldung von aktuellen Schülern bzw. fehlenden Anmeldungen von potentiellen Schülern. Immer mehr Schüler haben sich für den Schulbesuch an der Eider-Treene-Schule (ETS) mit Oberstufe in Tönning und der Außenstelle in Friedrichstadt entschieden. Leider wurde nicht zeitnah und konsequent von dem zuständigen Schulträger und der Schulleitung auf die Entwicklung reagiert und im Mai 2015 wurde zum Schuljahr 2015/2016 die Grundschule in Lehe und die Gemeinschaftsschule in Lunden geschlossen und die betroffenen Schüler waren gezwungen sich innerhalb einer kurzen Zeit eine neue Schule zu suchen. Wie bereits erwähnt haben sich vor Schließung der weiterführenden Schule in Lunden Schüler aus dem Raum Lunden die ETS in Tönning und in Friedrichstadt entschieden, jedoch keinen Anspruch auf Übernahme der Schülerbeförderungskosten gestellt, da die nächstgelegene weiterführende Schule in Lunden lag. Diese Situation hat sich nach der o. a. Schließung jedoch wesentlich geändert. Aktuell erfolgt eine gesamte bzw. anteilige Zahlung der Schülerbeförderungskosten an die Gymnasien in Heide und Husum, zur Gemeinschaftsschule Hennstedt, Wesselburen und Heide sowie zur ETS Friedrichtstadt, Außenstelle der ETS Tönning aufgrund der bestehenden ÖPNV-Verbindung zu schulgünstigen Zeiten. Seite 1 von 6 Elterninitiative Gesche Holst – Dirk Richter: Anhörung zur Drucksache 19/372 Des Weiteren werden die dementsprechenden Schülerbeförderungskosten für Schüler aus dem Raum Lunden zum Gymnasium nach St. -

Postsportverein Heide
Verbandstag 2019 am Dienstag, 26. März 2019, um 19.00 Uhr in Lohe-Rickelshof „Dörpshus“ Loher Weg 124, Lohe-Rickelshof Ausrichter: Postsportverein Heide 1 2 Sehr geehrte Vorsitzende der Fachverbände und Sportvereine im Kreissportverband Dithmarschen! Liebe Sportfreundinnen und liebe Sportfreunde! Sehr geehrte Damen und Herren! Zum Verbandstag am Dienstag, 26. März 2019, in der Gaststätte „Dörpshus“ in Lohe-Rickelshof, legt Ihnen der Vor- stand des Kreissportverbandes Dithmarschen (KSV) dieses Berichtsheft vor, um Ihnen die Möglichkeit zu geben, ei- nen Einblick in die Arbeit des Verbandes zu nehmen. Gleichzeitig mag die Lektüre der Beiträge Ihnen Anregungen für die eigene Vereinsarbeit geben. Für Nachfragen und Vorschläge dürfen Sie sich gern an den Vorstand oder die Ge- schäftsstelle wenden. Umfangreiche Nachfragen sind bitte schriftlich bis zum 5. März 2019 an die Geschäftsstelle des KSV zu richten, um Ihnen während des Verbandstages ausführlich Rede und Antwort stehen zu können. Die Einladung zum Verbandstag 2019 erfolgt gesondert. Mit der Einladung erhalten Sie das Verbandsheft 2019 in elektronischer Form, um es intern weiter zu verteilen. Wäh- rend des Verbandstages sind Verbandshefte in Papierform ausgelegt. Nachstehend finden Sie Beiträge zu folgenden Themen: Tagesordnung Verbandstag 2019 Bericht des 1. Vorsitzenden 2018/2019 Sport(stätten)entwicklungsplanung und Sportentwicklungsplanung kreisübergreifend Zuschüsse für langlebige Sportgeräte 2018 Zuschüsse für ehrenamtlich tätige Übungsleiter 2018 Ehrungen durch den KSV/LSV 2018 -

Beschluss Des Präsidiums Des Amtsgerichts Meldorf Betreffend Die Richterliche Geschäftsverteilung Ab Dem 01.09.2021
L 320 E Beschluss des Präsidiums des Amtsgerichts Meldorf betreffend die richterliche Geschäftsverteilung ab dem 01.09.2021 Der Richter Waege verlässt aufgrund einer temporären Abordnung das Gericht, ohne dass zunächst eine Ersatzkraft zur Verfügung steht. Deshalb sind die Vertretungsregelungen zum 01.09.2021 anzupassen. Dezernat I Direktor des Amtsoeric hts Prof. Dr. Schulz 1. Entschuldungssachen 2. Der Bestand des Dezernats I an Zivilsachen einschließlich der als Zivilsachen zu behandelnden AR- und H-Sachen zum 31 .12.2O2O sowie Zivilsachen nach dem jeweils geltenden Turnusplan - mit Ausnahme der WEG-Sachen - sowie von den als Zivilsachen zu behandelnden AR- und H-Sachen die Endziffern 6 u. 7 3. Güterichter nach §§ 278 Abs. 5 ZPO, 36 Abs. 5 FamFG 4. Richterablehnungen gemäß § 24 StPO. 5. Ablehnungen von Rechtspflegerinnen und Rechtspflegern Vertreterin zu Ziff. 2, 3: Richter am Amtsgericht Meppen Vertreter zu Ziff. 4 und 5: Richter am Amtsgericht - als stellvertretender Direktor - Dr. Hansen-Nootbaar Ersatzv erlreler zu Ziff .2 3 und 4 Richter am Amtsgericht Zacharias Dezernat ll Richter am Amtsoericht - als stell nder Direktor - Dr. Hansen-Nootbaar '1. Güterichter nach §§ 278 Abs. 5 ZPO, 36 Abs. 5 FamFG 2. Bereitschaftsrichter 2 3. Vorsitzender des Jugendschöffengerichts einschließlich der VRJs-Sachen, die sich aus diesen ergeben und von auswärtigen Gerichten und die sich aus den Jugendschöffensachen ergebenden Bewährungsaufsichten 4. Vorsitzender des Ausschusses zur Wahl der Jugendschöffen gemäß §§ 40 GVG, 35 JGG 5. Gs - Sachen gegen Eruvachsene Vertreter zu Ziffer 1 : Direktor des Amtsgerichts Prof. Dr. Schulz Vertreterin zu Ziffer 3 bis 5 Richterin am Amtsgericht Petersen Die Vertretung hinsichtlach Zifi. 2. wtd durch den gemeinsamen Beschluss der Präsidien des Landgerichts ltzehoe und der Amtsgerichte ltzehoe und Meldorf zum gemeinsamen Bereitschaft sdienst besonders geregelt. -

2. Quartal 2020 Bevölkerung Der Gemeinden in Schleswig-Holstein
Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein STATISTISCHE BERICHTE Kennziffer: A I 2 - vj 2/20 SH Bevölkerung der Gemeinden in Schleswig-Holstein 2. Quartal 2020 Ergebnisse der Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011 Herausgegeben am: 30. September 2020 Impressum Statistische Berichte Herausgeber: Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein – Anstalt des öffentlichen Rechts – Steckelhörn 12 20457 Hamburg Auskunft zu dieser Veröffentlichung: Thomas Gregor Telefon: 040 42831-2189 E-Mail: [email protected] Auskunftsdienst: E-Mail: [email protected] Auskünfte: 040 42831-1766 Internet: www.statistik-nord.de © Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein, Hamburg 2020 Auszugsweise Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet. Sofern in den Produkten auf das Vorhandensein von Copyrightrechten Dritter hingewiesen wird, sind die in deren Produkten ausgewiesenen Copyrightbestimmungen zu wahren. Alle übrigen Rechte bleiben vorbehalten. Zeichenerklärung: 0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts – nichts vorhanden (genau Null) ··· Angabe fällt später an · Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten x Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll p vorläufiges Ergebnis r berichtigtes Ergebnis s geschätztes Ergebnis a. n. g. anderweitig nicht genannt u. dgl. und dergleichen Statistikamt Nord 2 Statistischer Bericht A I 2 - vj 2/20 SH Rechtsgrundlage Hinweis Gesetz über die Statistik der Bevölkerungs- Bevölkerungszahlen nach dem 9. Mai 2011 bewegung und die Fortschreibung des werden durch Fortschreibung des festgestellten Bevölkerungsbestandes in der Fassung vom 20. Zensusergebnisses vom 9. Mai 2011 mit den April 2013 (BGBl. I S. 826) zuletzt geändert durch Zu- und Fortzügen (Statistik der räumlichen Artikel 9 des Gesetzes vom 18. -

1986L0465 — Nl — 13.03.1997 — 003.001 — 1
1986L0465 — NL — 13.03.1997 — 003.001 — 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen ►B RICHTLIJN VAN DE RAAD van 14 juli 1986 betreffende de communautaire lijst van agrarische probleemgebieden in de zin van Richtlijn 75/ 268/EEG (Duitsland) (86/465/EEG) (PB L 273 van 24.9.1986, blz. 1) Gewijzigd bij: Publicatieblad nr. blz. datum ►M1 Richtlijn 89/586/EEG van de Raad van 23 oktober 1989 L 330 1 15.11.1989 ►M2 Beschikking 91/26/EEG van de Commissie van 18 december 1990 L 16 27 22.1.1991 ►M3 Richtlijn 92/92/EEG van de Raad van 9 november 1992 L 338 1 23.11.1992 ►M4 gewijzigd bij Beschikking 93/226/EEG van de Commissie van 22 april L 99 1 26.4.1993 1993 ►M5 gewijzigd bij Beschikking 97/172/EG van de Commissie van 10 L 72 1 13.3.1997 februari 1997 ►M6 gewijzigd bij Beschikking 95/6/EG van de Commissie van 13 januari L 11 26 17.1.1995 1995 1986L0465 — NL — 13.03.1997 — 003.001 — 2 ▼B RICHTLIJN VAN DE RAAD van 14 juli 1986 betreffende de communautaire lijst van agrarische probleemge- bieden in de zin van Richtlijn 75/268/EEG (Duitsland) (86/465/EEG) DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, Gelet opRichtlijn 75/268/EEG van de Raad van 28 april1975 betref- fende de landbouw in bergstreken en in sommige probleemgebieden (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr.