Deutschsprachig
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

AB Kolkwitz Ab 6-2018
25. JG 08|18 25. AUGUST 2018 FÜR DIE BLAGEMEI NTTDE KO LKWI TZ mit den Ortsteilen Babow, Brodtkowitz, Dahlitz, Eichow, Glinzig, Gulben, Hänchen, Kackrow, AKAlein Gaglomw, Kolkwitz, Krtieschos w, Kunersdorf, Limberg, Milkersdorf, Papitz, Wiesendorf, Zahsow Inhalt nicht Amtlicher Teil Seite 1 bis 10 Seite 9 Seite 16 bis 22 - Informationen aus dem Rathaus - Städtewettbewerb von enviaM zum 25. - Informationen aus den Ortsteilen Kolkwitzer Oktoberfest Seite 2 Seite 24 bis 25 - Grußwort des Bürgermeisters Seite 11 bis 13 - Informationen aus den evangelischen Seite 4 - Informationen für Eltern Kirchengemeinden - Veräußerung von Baugrundstücken im Orts - Seite 14 bis 15 teil Limberg Seite 26 bis 28 - Neues aus Kita / Schule / Hort - Informationen vom Sport ZUCKERTÜTENFEST UND SOMMERFEST IN DER KITA „BENJAMIN BLÜMCHEN“ Am 29.06.2018 fand unser alljährliches Sommerfest statt. Diesen Rahmen nutzten wir, um unsere Vorschulkinder aus der Kita zu verabschieden. mehr auf Seite 12 August 2018 Seite 1 Informationen aus dem Rathaus Liebe Bürgerinnen, liebe Bürger, Rat und Hilfe im Notfall Auszugsweise dieser Sommer hat seinen Namen wahrlich Notrufe kostenlos und rund um die Uhr verdient. So brauchen wir in diesem Jahr nicht bis ans Mittelmeer fahren, um Wassertempe - Polizei 110 raturen von 25 Grad im Wasser zu haben. Feuerwehr 112 Nein, die Ostsee ist das Nahziel mit mediter - Rettungsdienst 112 ranem Flair. Was für die Urlauber und Kinder Kinder- und toll ist, bringt andernorts massive Probleme Jugendnotdienst 0800 - 4786111 mit sich. So sind die ausbleibenden Nieder - Giftnotruf 030 - 19240 schläge nicht nur ein großes Problem bei der Sperr-Notruf 116116 Elbschifffahrt, auch der Spreewald ist betrof - z. B. EC-Karte, Handykarte, elektron. -

Common Core Document of the Federal Republic of Germany
Common Core Document of the Federal Republic of Germany (as per: 15 May 2009) II Contents CONTENTS.........................................................................................................................................................III A. GENERAL INFORMATION ABOUT THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY................................ 1 I. GEOGRAPHICAL , HISTORICAL , DEMOGRAPHIC , SOCIAL , CULTURAL , ECONOMIC AND JUDICIAL CHARACTERISTICS .. 1 1. Geographical category................................................................................................................................ 1 2. Historical background................................................................................................................................. 1 3. Demographic characteristics....................................................................................................................... 3 a. General information.................................................................................................................................................. 3 b. Shares of the population with foreign nationality........................................................................................................ 5 c. Religious affiliation .................................................................................................................................................. 6 4. Social and cultural characteristics.............................................................................................................. -

Konzessionsgemeinden Spree-Niederlausitz
Stand: 01.01.2018 Konzessionsgemeinden im Netzgebiet der NBB - Teilnetz Spree-Niederlausitz - Lfd. Nr. Stadt/Gemeinde Gemeindeschlüssel Ortsteil 1 Altdöbern 12066008 Ortsteil Altdöbern 2 Annaburg 15091010 3 Bad Liebenwerda 12062024 Ortsteil Prieschka 4 Bad Liebenwerda 12062024 5 Bernsdorf/O.L. 14625030 Ortsteil Straßgräbchen 6 Bernsdorf/O.L. 14625030 7 Boxberg/O.L. 14626060 Ortsteil Boxberg/O.L. 8 Boxberg/O.L. 14626060 Ortsteil Kringelsdorf 9 Boxberg/O.L. 14626060 Ortsteil Nochten 10 Briesen 12071028 11 Burg (Spreewald) 12071032 12 Calau 12066052 Ortsteil Werchow 13 Calau 12066052 14 Cottbus 12052000 Ortsteil Gallinchen 15 Cottbus 12052000 Ortsteil Groß Gaglow 16 Crinitz 12062088 17 Crinitz 12062088 Ortsteil Gahro 18 Dissen-Striesow 12071041 Ortsteil Dissen 19 Dissen-Striesow 12071041 Ortsteil Striesow 20 Döbern 12071044 21 Drebkau 12071057 Ortsteil Drebkau 22 Drebkau 12071057 Ortsteil Leuthen 23 Drebkau 12071057 Ortsteil Schorbus/ Wohngebiet Klein Oßnig 24 Drebkau 12071057 Ortsteil Schorbus/ Wohngebiet Oelsnig 25 Elsterwerda 12062124 26 Falkenberg/Elster 12062128 27 Felixsee 12071074 Ortsteil Friedrichshain 28 Frauendorf 12066064 29 Gablenz 14626100 Ortsteil Gablenz 30 Groß Düben 14626120 Ortsteil Groß Düben 31 Groß Naundorf 15091125 32 Groß Schacksdorf-Simmersdorf 12071153 Ortsteil Groß Schacksdorf 33 Groß Schacksdorf-Simmersdorf 12071153 Ortsteil Simmersdorf 34 Großkmehlen 12066104 Ortsteil Frauwalde 35 Großkmehlen 12066104 Ortsteil Großkmehlen 36 Großkmehlen 12066104 Ortsteil Kleinkmehlen 37 Großräschen 12066112 38 Großthiemig 12062208 -

16-03-03 Anlage Waldbrandalarmplan 2016
Forst Anlage zum Waldbrandalarmplan 2016 Landesbetrieb Forst Brandenburg Oberförsterei Cottbus Oberförsterei Drebkau Waldbrandzentrale Peitz Landeswaldoberförsterei Peitz Waldbrandgefahrenstufe 1 sehr geringe Gefahr 2 geringe Gefahr 3 mittlere Gefahr 4 hohe Gefahr 5 sehr hohe Gefahr Stand: 03.03.2016 2 Oberförsterei Cottbus August-Bebel-Straße 27 03185 Peitz Waldbranddiensthandy: 0173/ 99 76 429 Telefon: 035601/ 37130 Fax: 035601/ 37133 e-mail: [email protected] [email protected] Oberförsterei Drebkau Drebkauer Hauptstraße 12 03116 Drebkau Waldbranddiensthandy: 0173/ 99 76 430 Telefon: 035602/ 5191823 Fax: 035602/ 5191820 e-mail: [email protected] Landeswaldoberförsterei Peitz August-Bebel-Straße 27 03185 Peitz Diensthandy: 0172/ 30 64 218 Telefon: 035601/ 37132 Fax: 035601/37113 e-mail: [email protected] 3 Waldbrandzentrale Peitz Arbeitsplätze Kamera 035601 / 371-19 Diensthandy: 0173/ 99 76 433 FAX Waldbrandzentrale: 035601 / 371-25 Dienstzeiten: Besetzung der Waldbrandzentrale vom 01. März bis 30. September Montag bis Sonntag MEZ MESZ Waldbrandgefahrenstufe 3 9 - 17 Uhr 10 - 18 Uhr 4 9 - 18 Uhr 10 - 19 Uhr 5 9 - 19 Uhr 10 - 20 Uhr Bei Gefahrenstufe 1 und 2 erfolgt keine Besetzung. Notruf: 112 Telefon Fax Leitstelle Lausitz 0355/6320 0355/632-138 Dresdener Straße 46 03050 Cottbus [email protected] Zuständig für: Stadt Cottbus, Landkreis Spree-Neiße, Landkreis Oberspreewald- Lausitz, Landkreis Dahme-Spreewald, Landkreis Elbe-Elster 4 Dienstzeiten: Diensthabender je Oberförsterei vom 01. März bis 30. September Montag bis Sonntag MEZ MESZ Waldbrandgefahrenstufe 2 und 3 9 - 17 Uhr 10 - 18 Uhr 4 9 - 18 Uhr 10 - 19 Uhr 5 9 - 19 Uhr 10 - 20 Uhr Bei Gefahrenstufe 1 erfolgt kein Dienst. -

Amtlicher Teil Amtlicher Teil Öffentliche Bekanntmachungen Öffentliche Bekanntmachungen
Februar_Amtsblatt_Muster SPN-Kurier.qxd 11.02.2019 13:42 Seite 1 Jahrgang 12 • Forst (Lausitz), den 15. Februar 2019 • Nummer 2 Inhaltsverzeichnis AMTLICHER TEIL AMTLICHER TEIL ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN 1. Nachtrag zum Sechsten Vertrag zur Änderung des 1. Nachtrag zum Sechsten Vertrag öffentlichen-rechtlichen Vertrages zur Durchführung der Aufgaben nach § 12 Abs. 1 Satz 2 Kindertages- zur Änderung des öffentlichen-rechtlichen Vertrages stättengesetz Land Brandenburg vom 24.11.2009 zwischen dem Landkreis Spree-Neiße und zur Durchführung der Aufgaben nach § 12 Abs. 1 Satz 2 - der Gemeinde Kolkwitz Seite 1 Kindertagesstättengesetz Land Brandenburg - dem Amt Burg (Spreewald) Seite 1 - dem Amt Peitz Seite 2 vom 24.11.2009 1. Nachtrag zum Neunten Vertrag zur Änderung des Der Landkreis Spree-Neiße, vertreten durch den Landrat, öffentlichen-rechtlichen Vertrages zur Durchführung der Aufgaben nach § 12 Abs. 1 Satz 2 Kindertages - im Folgenden: Landkreis - stättengesetz Land Brandenburg vom 06.07.2004 und die Gemeinde Kolkwitz, vertreten durch den Bürgermeister, zwischen dem Landkreis Spree-Neiße und - im Folgenden: Gemeinde- - der Stadt Forst (Lausitz) Seite 2 vereinbaren: - der Stadt Guben Seite 2 - der Stadt Spremberg Seite 2 1. Nach § 1 Ziffer 2 Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: - der Stadt Drebkau Seite 3 „Auf Grund nachträglich eingetretener tariflicher Veränderungen im Jahr 2018 beim - der Stadt Welzow Seite 3 - dem Amt Döbern-Land Seite 3 notwendigen pädagogischen Personal erfolgt eine einmalige Nachzahlung in Höhe - der Gemeinde Neuhausen/Spree Seite 3 von 54,00 EUR auf die Kinderkostenpauschale gem. Satz 1.“ - der Gemeinde Schenkendöbern Seite 4 2. Der bisherige Satz 2 wird zu Satz 3. 3. -

Amtsblatt 26.25
rosenstadt forst lausitz AMTSBLATT 26.25. Jahrgang Jahrgang | |Nr. Nr. 3/2017 2/2016 für die Stadt Forst (Lausitz) | Rathausfenster ForstForst (Lausitz), (Lausitz), den den 27. 28. Mai Mai 2017 2016 Inhaltsverzeichnis Amtlicher Teil ALLGEMEINVERFÜGUNG - Öffentliche Bekanntmachung Satzungen über die Widmung von Verkehrsflächen in der Feldstraße Öffentliche Bekanntmachung zur Inkraftsetzung (von Am Hirschsprung bis Ende Bebauung bei des Bebauungsplanes der Innenentwicklung nach § 13a Hausnummer 26) Seite 10 BauGB mit der Bezeichnung „Bebauungsplan ALLGEMEINVERFÜGUNG - Öffentliche Bekanntmachung Neuansiedlung Horno, 2. Änderung“ Seite 2 über die Widmung von Verkehrsflächen in der Straße Beschlüsse Corporate DesignAm Busch, der W.-A.-Mozart-Straße Manual und der Straße Beschlüsse der 16. Sitzung des Haupt-Rosenstadt und und RosengartenCäcilienweg Forst (Lausitz) Seite 11 Wirtschaftsausschusses der Stadt Forst (Lausitz) Bekanntmachung - über die öffentliche Auslegung der am 26.04.2017 Seite 3 vorläufigen Ausführungsplanung zum Bauvorhaben Beschlüsse der 17. Sitzung der Stadtverordneten- Am Hirschsprung Seite 12 versammlung der Stadt Forst (Lausitz) am 12.05.2017 Seite 4 Bekanntmachung - über die öffentliche Auslegung der Andere Bekanntmachungen vorläufigen Ausführungsplanung zum Bauvorhaben Ausbau Beschluss der Stadtverordnetenversammlung über der Kreisstraße 7109, von Domsdorfer Kirchweg bis die Feststellung des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes Skurumer Straße Seite 12 der Stadt Forst (Lausitz) „Städtische Abwasserbeseitigung Bekanntmachung - Sprachstandsfeststellung in Forst (Lausitz)“ für das Wirtschaftsjahr 2017 Seite 6 Kindertagesstätten Seite 12 Beschluss zur Einleitung eines vorbereitenden Bauleitplan- verfahrens gem. § 2 Abs. 1 BauGB mit der Bezeichnung Nichtamtlicher Teil 7. Änderungsverfahren des Flächennutzungsplanes Aus dem Rathaus der Stadt Forst (Lausitz) und Beschluss über die öffentliche Bestellung Stadtwehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Auslegung des Entwurfes der Planzeichnung und Forst (Lausitz) Seite 13 begleitender Planunterlagen gem. -

Zu Unser Aller Sicherheit: Liebe Bürgerinnen Und Bürger, Bitte Bleiben Sie Zu Hause Und Vermeiden Sie Kontakte
Informationsblatt für die Stadt Drebkau mit den Ortsteilen Casel, Domsdorf, Drebkau, Greifenhain, Jehserig, Kausche, Laubst, Leuthen, Schorbus und Siewisch Jahrgang 12 Samstag, den 28. März 2020 Nummer 03/2020 Zu unser aller Sicherheit: Liebe Bürgerinnen und Bürger, bitte bleiben Sie zu Hause und vermeiden Sie Kontakte. Aktuelle Informationen zur Corona-Epidemie erhalten Sie im Innenteil. Shutterstock Drebkau – 2 – Nr. 03/2020 Inhaltsverzeichnis Nichtamtliche Mitteilungen der Stadt Drebkau, Ortsteile, andere Behörden Seite 2 Schul-, Kinder- und Jugendnachrichten Seite 9 Kirchliche Nachrichten Seite 9 Vereine, Verbände, Sonstiges Seite 11 Wichtige Sprechzeiten und Telefonanschlüsse Seite 17 Anzeigen Seite 18 Impressum Das Drebkauer Heimatblatt erscheint monatlich und wird kostenlos an alle Haushalte in der Stadt Drebkau mit ihren Ortsteilen Casel, Domsdorf, Drebkau, Greifenhain, Jehserig, Kausche, Laubst, Leuthen, Schorbus und Siewisch verteilt. - Herausgeber: Stadt Drebkau - Verantwortlich für den nichtamtlichen Teil: Die Textverfasser - Herstellung: Druck und Mehr C. Greschow, Spremberger Straße 66, 03119 Welzow, Telefon (03 57 51) 2 70 83, Fax 2 70 82, [email protected] - Verantwortlich für den Anzeigenteil: Druck und Mehr C. Greschow - Anzeigenannahme: Druck und Mehr C. Greschow, Telefon (03 57 51) 28158 Die nächste Ausgabe des Drebkauer Heimatblattes erscheint am Samstag, 25.04.2020 Redaktionsschluss ist am Mittwoch, 15.04.2020 Bitte den Redaktionsschluss unbedingt einhalten! E-Mail: [email protected] Nichtamtliche Mitteilungen der Stadt Drebkau Informationen zu Corona Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, Evtl. besteht für die Betreuung Ihrer Kinder ein wir berichten zum Stand der Corona Pandemie aktuell auf unserer Anspruch auf Notfallbetreuung in kleinen Grup- Homepage und auf Facebook. Bitte informieren Sie sich dort regelmä- pen. -

Bienen Schaffen Leben
Bienen schaffen Leben Der Landkreis Spree-Neiße blüht für die Bienen Editorial Sehr geehrte Leserinnen und Leser, mit der vorliegenden Broschüre will der Landkreis Spree- Neiße auf ein wichtiges Thema aufmerksam machen, das für uns alle von größter Bedeutung ist: Die Bienen. Ohne unsere fleißigen Helfer in schwarz und gelb gäbe es weder die farbenfrohe Blütenpracht im Garten noch den leckeren Honig am Frühstückstisch. Von der Landwirtschaft und zahlreichen anderen Lebensmitteln ganz zu schweigen. Die Bienen brauchen die Menschen nicht, aber die Menschen brauchen die Bienen. So einfach lässt sich der Stellenwert dieser ganz besonderen Tierart auf den Punkt bringen. Umso wichtiger ist es, dass ein Bewusstsein in der Gesellschaft dafür geschaffen wird, gleichermaßen sorgsam wie helfend mit der heimischen Imme umzugehen. Genau dies wollen wir mit der vorliegenden Broschüre erreichen, um so unseren Beitrag als Landkreis zu leisten und mit gutem Beispiel voranzugehen. Auch abseits dieser Publikation setze ich mich als Landrat für die Biene ein, indem ich Imker und Landwirte miteinander ins Gespräch bringe, um so eine im wahrsten Sinne des Wortes fruchtbare Kooperation zwischen diesen zu ermöglichen. Weiterhin mache ich mich für die Förderung von Blühstreifen stark und bei der zukünftigen Bepflanzung von Deponien im Kreis wird verstärkt darauf geachtet, Gewächse zu verwenden, welche für die Lebensbedingungen der Biene förderlich sind. Ihr Landrat Harald Altekrüger 1 2 Inhalt 4 / 5 Flugkünstler mit Sammelfleiß 30 / 31 Wertvolle Süße und Wie Bienen -

REK) Cottbus/Chó Ebuz – Guben – Forst (Lausitz
Evaluation und Fortschreibung des Regionalen Entwicklungskonzeptes (REK) Cottbus/Chóebuz – Guben – Forst (Lausitz)/Barš (Łužyca) Im Auftrag des Landkreises Spree-Neiße/Wokrejs Sprjewja-Nysa Sprje- REK Cottbus/Chóśebuz – Guben – Forst (Lausitz)/Baršć (Łužyca) 2021 IMPRESSUM Auftraggeber Landkreis Spree-Neiße/Wokrejs Sprjewja-Nysa Heinrich-Heine-Straße 1 03149 Forst (Lausitz) vertreten durch: Harald Altekrüger (Landrat) Olaf Lalk (Erster Beigeordneter / Dezernent) Thomas Brase (Leiter SG Kreis-/Bauleitplanung/Tourismus) E-Mail: [email protected] / [email protected] Tel. (03562) 986-10101 / (03562) 986-16103 Auftragnehmer LOKATION:S, Partnerschaft für Standortentwicklung Liepe+Wiemken Dipl.-Ingenieure Sanderstraße 29/30 12047 Berlin E-Mail: [email protected] Tel. (030) 49 90 51 80 Bearbeitung: Susann Liepe, Dipl.-Ing. Thomas Wude, Dipl.-Ing. I M.Sc. Sven Guntermann, Dipl.-Ing. Max Heß, Dipl.-Ing. Dr. Katharina Knaus, M.A. Kim Brademann, cand. M.A. Ronja Kelch, Cand. B.Sc. Anne-Marie Wulff, cand. M.Sc. Die Evaluation und Fortschreibung des REK wurde unterstützt mit Mitteln der Gemeinsamen Landespla- nungsabteilung (GL) Berlin-Brandenburg. Stand April 2021 2 REK Cottbus/Chóśebuz – Guben – Forst (Lausitz)/Baršć (Łužyca) 2021 Hinweis: Im Bericht werden deutsche und sorbische/wendische Bezeichnungen für Orte verwendet, so wie diese in der Übersicht „Sorbische/wendische Ortschaftsnamen in Brandenburg“ (Stand 2020) aufgeführt sind. In Abstimmung mit dem Auftraggeber wird im Bericht keine explizit Gender-gerechte Sprache verwen- det, -

Zuständigkeiten Für Die Durchführung Der Amtlichen VLÜ-05-TAB-510-SPN Schlachttier- Und Fleischuntersuchung Im Landkreis Spree-Neiße/Wokrejs Sprjewja-Nysa Einschl
Seite 1 von 2 Zuständigkeiten für die Durchführung der amtlichen VLÜ-05-TAB-510-SPN Schlachttier- und Fleischuntersuchung im Landkreis Spree-Neiße/Wokrejs Sprjewja-Nysa einschl. Stadt Cottbus/Chóśebuz Fachbereich Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung Stand: Mai 2021 Amtliche/r Tierarzt/ Fleischbeschaubezirke Vertretung Tierärztin/ Fleischkontrolleur/in Dr. Steffen Knauer Schlachtstätten: Walther Schorbus, Lenz Steinitz Landkreis Spree-Neiße/ Poststraße 2 Wokrejs Sprjewja-Nysa Fachbereich Landwirtschaft, Veterinär- und 03119 Welzow Stadt Drebkau/Drjowk Lebensmittelüberwachung Tel.: 035751 2134 mit den Ortsteilen: Casel, Drebkau, Domsdorf, Greifenhain, Jehserig, Heinrich-Heine-Str. 1 Kausche, Laubst, Leuthen, Siewisch und Schorbus 03149 Forst (Lausitz)/ Baršć (Łužyca) Tel.: 03562 986-18301 Susanna Männchen Gemeinde Kolkwitz/Gołkojce DVM Susanne Schmidt Rubener Weg 5 mit den Ortsteilen: Babow, Brodtkowitz, Dahlitz, Eichow, Glinzig, Gulben, Fortunastr. 17 03099 Kolkwitz Hänchen, Kackrow, Klein Gaglow, Kolkwitz, Krieschow, Kunersdorf, 03054 Cottbus Tel.: 0355 28157 Limberg, Milkersdorf, Papitz, Wiesendorf und Zahsow OT Skadow Mobil: 0173 9249457 Tel.: 0355 821513 DVM Susanne Schmidt Schlachtstätten: Schulz Burg, Marrack, Burg, Gubela Burg, Starick Werben DVM Kerstin Biemelt Fortunastr. 17 Jarick Kackrow Hauptstr. 111 03054 Cottbus 03185 Tauer OT Skadow Gemeinde Burg (Spreewald )/Bórkowy (Błota) mit den Ortsteilen: Tel.: 035601 22782 Tel.: 0355 821513 Burg (Spreewald) und Müschen Mobil: 0172 3442078 Gemeinde Werben/Wjerbno -

Amtsblattamtsblatt
Drebkau - 1 - Nr. 03/2017 DREBKAUERDREBKAUER AMTSBLATTAMTSBLATT Amtsblatt für die Stadt Drebkau mit den Ortsteilen Casel, Domsdorf, Drebkau, Greifenhain, Jehserig, Kausche, Laubst, Leuthen, Schorbus und Siewisch Jahrgang 16 Samstag, den 04. Februar 2017 Nummer 03/2017 Inhaltsverzeichnis Amtliche Bekanntmachungen Amtliche Mitteilungen Bekanntmachungen der Stadt Drebkau Mitteilungen anderer Behörden - Einladung zur 24. ordentlichen Sitzung der Stadtverord- - Mitteilungen des Standesamtsbezirkes Burg (Spree- Seite 4 netenversammlung der Stadt Drebkau am 14.02.2017 Seite 2 wald) Bekanntmachung der Stadt Drebkau für den Ortsteil Drebkau - Einladung zur 22. ordentlichen Sitzung des Ortsbei- rates Drebkau am 23.02.2017 Seite 2 Bekanntmachung anderer Behörden - Bekanntmachung der Termine der Gewässerschau- en 2017 des Gewässerverbandes Spree-Neiße Seite 3 Das Drebkauer Amtsblatt erscheint 14-täglich, jeweils in den ungeraden Wochen und wird kostenlos an alle Haushalte in der Stadt Drebkau mit ihren Ortsteilen Casel, Domsdorf, Drebkau, Greifenhain, Jehserig, Kausche, Laubst, Leuthen, Schorbus und Siewisch verteilt. Herausgeber: Der Bürgermeister der Stadt Drebkau Dietmar Horke Verantwortlich: Der Bürgermeister der Stadt Drebkau Dietmar Horke, Spremberger Straße 61, 03116 Drebkau, Telefon: (03 56 02) 5 62 - 0 Druck und Verlag: DRUCK+SATZ Offsetdruck, Gewerbestraße 17, 01983 Großräschen, Telefon (035753) 17703 Betriebsleiter: Klaus-Dieter Pernack, E-Mail: [email protected] Für nicht gelieferte Zeitungen infolge höherer Gewalt oder anderer Ereignisse kann nur Ersatz des Betrages für ein Einzelexemplar gefordert werden. Weitergehende Ansprüche, ins- besondere aus Schadensersatz, sind ausdrücklich ausgeschlossen. Außerhalb des Verbreitungsgebietes kann das Drebkauer Amtsblatt zum Abo-Preis in Höhe von 2,50 € (inklusive Mehrwertsteuer) oder per PDF zu einem Preis von je 1,00 € über den Verlag bezogen werden. IMPRESSUM Drebkau - 2 - Nr. -
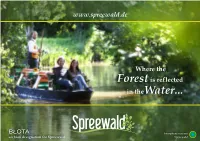
Our Image Brochure (PDF, 11
www.spreewald.de Welcome Where the to the tropics! Forest is reflected in the Beach, water, palm trees, 26°C every day Water ... and fantastic accommodation, next to the Spreewald forest! Tropical Islands Resort – Europe’s largest tropical holiday world. HOLIDAY IN THE FOREST Fun and relaxation all year round! Just o the A13, Staakow exit or Brand Tropical Islands railway station and free shuttle bus tropical-islands.de/en biosphere reserve sorbian designation for Spreewald Spreewald TOURISMUSVERBAND OUR SERVICES FOR YOU: SPREEWALD · Individual advice and free preparation · Sale of event tickets of packages for group tours, day excursions, · Sale of value and arrangement vouchers team events and all travel programmes in the Spreewald · Free Spreewald brochures in Raddusch, Lindenstraße 1 several languages 03226 Vetschau/Spreewald · Free accommodation service for holiday makers throughout the Spreewald Tel. +49 35433 72299 FIND OUT MORE: · Arrangement of city and nature tours OPENING TIMES: as well as guided tours in German and Eng WWW.SPREEWALD.DE OR weekdays 8:00 am – 5:00 pm lish for groups; other languages on request WWW.FACEBOOK.DE/SPREEWALD.DE Welcome to the 1st Quality Region of Germany Kiel SCHLESWIG- HOLSTEIN MECKLENBURG- U Schwielochsee VORPOMMERN N Hamburg Schwerin E Goyatz S 48 C Bremen O Schlepzig BRANDENBURG - NIEDERSACHSEN Lower Spreewald B (Słopišća) Lieberose I O S Berlin P Hannover Spreewald H Ä Golßen R E Magdeburg N NORDRHEIN- - WESTFALEN SACHSEN- 46 Between Lake Schwielochsee ANHALT and Upper Spreewald Düsseldorf