WW Kosovo-III 002 Titelei Inhalt R.Indd
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Kosovo War Tour: Dealing with the Country's War History As a Tour Operator
The Kosovo war tour: dealing with the country’s war history as a tour operator Image 1. “Adem Jashari” memorial complex, Prekaz, Kosovo. 31 May, 2018. by Sarah Driessen Driessen s4361954/1 s4361954 August, 2018 ⁕ Preface ⁕ The first time I visited Kosovo was three years ago in 2015. The country caught my interest and I have been going back there every year since. This is why the decision to focus on Kosovo for my research was quickly made. As a tourist, you stand out, because there are not many there. I have seen the beautiful and positive sides of Kosovo but at the same time I have noticed how the country, years after the war, still has a long way to go. With my research, I want to give a helping hand and combine tourism with the development of the country and dealing with the war history. I have written this thesis for my master’s degree in Human Geography: Cultural Geography & Tourism at the Radboud University, Nijmegen. I went to stay in the capital of Kosovo, Pristina, for three months and experienced what it is like to live there instead of just being a tourist. I hope this thesis can be of value to the person reading it. Sarah Driessen Gendt, 7 August, 2018 Driessen s4361954/2 ⁕ Summary ⁕ This research looks at the possibility of offering a war tour in Kosovo as a way to handle the war history of the country as a tour operator. Kosovo has a negative image among Dutch people, which is mostly caused by the country’s war history. -

Msc Programme in Urban Management and Development Rotterdam, the Netherlands September 2017 Thesis Road Safety in Prishtina
MSc Programme in Urban Management and Development Rotterdam, The Netherlands September 2017 Thesis Road Safety in Prishtina: A Study of Perception from Producers’ and Road Users’ Perspectives Name : Yulia Supervisor : Linda Zuijderwijk Specialization : Urban Strategic and Planning (USP) UMD 13 Road Safety in Prishtina: A Study of Perception from Producers’ and Road Users’ Perspectives i MASTER’S PROGRAMME IN URBAN MANAGEMENT AND DEVELOPMENT (October 2016 – September 2017) Road safety in Prishtina, Kosovo: A study of perception from producers’ and road users’ perspectives Yulia Supervisor: Linda Zuijderwijk UMD 13 Report number: 1041 Rotterdam, September 2017 Road Safety in Prishtina: A Study of Perception from Producers’ and Road Users’ Perspectives ii Summary Prishtina is the capital city of Kosovo, the youngest country in Europe, who declared its independence in 2008. Before its independence, Kosovo is an autonomous province under Serbia, which was part of Socialist Federal Republic of Yugoslavia (SFRY). Kosovo has a long history of conflicts since the occupation of Turkish Ottoman Empire in Balkan Peninsula area until the recent one was the Kosova War in 1998 – 1999. As a post-conflict society, Prishtina is suffering from several urban challenges. One of these challenges is road safety issue indicated by increasing the number of traffic accidents in Prishtina and even nationwide. National government considered this situation as unusual for European countries. This study aimed to answer a research question on how the road safety is perceived from two main perspectives, which are road users (pedestrians and cyclists) and stakeholders in the producer’s level of road safety strategy in Prishtina. This study was conducted in urban zone of Prishtina, which is also the case study, with the regards to the increasing number of traffic accidents, which involve pedestrians and cyclists, as the vulnerable road users. -

Annual Public Funding Report 2019
Qeveria e Kosovës Vlada Kosova - Government of Kosovo Qeveria - Vlada - Government ANNUAL REPORT ON PUBLIC FINANCIAL SUPPORT FOR NON GOVERNMENT ORGANIZATIONS IN REPUBLIC OF KOSOVO FOR YEAR 2019 Address: Tel.: E-mail: Government building +383 (0) 38 200 14 070 [email protected] Office of the Prime Minister Office for Good Governance http://zqm.rks-gov.net Floor 6 Nr. 602 APRIL 2020 1 TABEL OF CONTENTS LIST OF ABBREVIATIONS........................................................................................................................... 3 1. INTRODUCTION............................................................................................................................3 1.1 Methodology Used ....................................................................... .............................................5 2. GENERAL REPORTING DATA BY THE BUDGETARY ORGANIZATIONS ............................................ 8 2.1 Reporting by the Budgetary Organizations .................................................................................. 8 2.2 Data on the Reporting by Each Budgetary Organization ................................................................ 9 3. GENERAL DATA ON THE PUBLIC FINANCIAL SUPPORT FOR THE NGOs AT THE MINISTRY, MUNICIPALITY AND OTHER INDEPENDENT AGENCY LEVEL ............................................................... 13 4. DATA ON THE PUBLIC FINANCIAL SUPPORT FOR THE NGOs BY MINISTRIES, MUNICIPALITIES AND OTHER AGENCIES ....................................................................................................................... -

Prishtina Insight
News: EULEX Garners Mixed Reviews on First Birthday December 11 - 23, 2009 Issue No. 29 www.prishtinainsight.com Free copy Prishtina Insight’s FEATURE Kosovo’s Skiing Guide Promising 2009/2010 Wine After a mild start to the winter, Industry ski slopes in the Balkans have Caught Over been looking distinctly green a Barrel recently. But with snow sched- uled for this week, the skiing sea- > page 7 son is about to begin. Here ARTE Prishtina Insight brings you a guide to the best resorts in The ABC of Human Kosovo, Serbia, Macedonia and Rights’ Abuses Montenegro. page 8 - 9 > page 10 OPINION Exclusive: Another Eight Stations Singing the Hits of ‘99 Cancelled in Kosovo Poll > page 13 Prishtina Insight has analysed the results of the November 15 local elections, revealing that almost one in ten votes for the municipal assembly were ruled invalid, that almost one in four conditional ballots were cancelled, that more than half of com- FOOD & DRINK plaints about the election were rejected on technicalities, and that while Kosovo’s biggest party, PDK, gained votes in the may- Fish Restaurant oral election, it lost out in the ballot for assembly members. > page 10 documentation at one polling station. Analysis of the results for the to vote. By Lawrence Marzouk The revelation increases the num- municipal assembly, released on This was highest in Gllogovc and ber of polling stations where results Wednesday, reveals that 54,444 votes Skenderaj where 51.3 per cent and NGO FOCUS he results of a further eight have not been counted by more than cast in this poll were ruled invalid. -
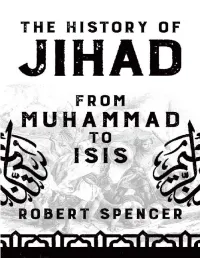
The History of Jihad: from Muhammad to ISIS
ADVANCE PRAISE FOR THE HISTORY OF JIHAD “Robert Spencer is one of my heroes. He has once again produced an invaluable and much-needed book. Want to read the truth about Islam? Read this book. It depicts the terrible fate of the hundreds of millions of men, women and children who, from the seventh century until today, were massacred or enslaved by Islam. It is a fate that awaits us all if we are not vigilant.” —Geert Wilders, member of Parliament in the Netherlands and leader of the Dutch Party for Freedom (PVV) “From the first Arab-Islamic empire of the mid-seventh century to the fall of the Ottoman Empire, the story of Islam has been the story of the rise and fall of universal empires and, no less importantly, of never quiescent imperialist dreams. In this tour de force, Robert Spencer narrates the transformation of the concept of jihad, ‘exertion in the path of Allah,’ from a rallying cry for the prophet Muhammad’s followers into a supreme religious duty and the primary vehicle for the expansion of Islam throughout the ages. A must-read for anyone seeking to understand the roots of the Manichean struggle between East and West and the nature of the threat confronted by the West today.” —Efraim Karsh, author of Islamic Imperialism: A History “Spencer argues, in brief, ‘There has always been, with virtually no interruption, jihad.’ Painstakingly, he documents in this important study how aggressive war on behalf of Islam has, for fourteen centuries and still now, befouled Muslim life. He hopes his study will awaken potential victims of jihad, but will they—will we—listen to his warning? Much hangs in the balance.” —Daniel Pipes, president, Middle East forum and author of Slave Soldiers and Islam: The Genesis of a Military System “Robert Spencer, one of our foremost analysts of Islamic jihad, has now written a historical survey of the doctrine and practice of Islamic sanctified violence. -

Kosovo, from Supervised Independence to Potential EU Candidate by Prime Minister of Republic of Kosovo, Hashim Thaçi
Bi-monthly newsletter of Ministry of Foreign SEPT/OCT 2013 Affairs of Republic of Kosovo. No.12 Year III. Greece strongly Kosovo’s Kosovo now supports the European perspective of Kosovo Path to Gender recognised 5 questions with the Head Equality by 101 UN of the Greek Liaison Office members Kosovo’s NewDiplomatFollow our sites on Twitter: @MFAKosovo @InterfaithKosovo @germiahillconf Kosovo, from supervised independence to potential EU candidate By Prime Minister of Republic of Kosovo, Hashim Thaçi The end of the supervised inde- ready playing a positive role. We pendence was a major beginning have the lowest debt compared to for the Republic of Kosovo. It GDP ratio in all of Europe. We al- was the moment that marked our so have the highest GDP growth political maturity and increased in the Eurozone, which Kosovo our social responsibilities. Like is a de facto member of through ever before, these two catego- our special relationship with the ries walk hand-in-hand: ma- German Bundesbank. In June of turity is achieved only through this year our efforts culminated the giving of responsibility, and with the decision of the Council vice versa. The people of Kosovo of the European Union to autho- themselves decided their status rize the European Union to start after decades of neglect and op- talks on Stabilisation and Asso- pression that almost ended with ciation Agreement with Kosovo. a genocide of unseen proportions Kosovo has invested public in Europe after World War Two. funds in infrastructure and ed- Many challenges lie ahead for the ucation, and we have plans to new state of Kosovo. -

Prishtina Insight
Mess: Court ruling keeps political crisis going. PAGE 4 August 29-September 11, 2014 #140 Price 1€ Prishtina Insight Burek Yoga Nightclubs Beer Trileqe Makiato PI Guide: The people and places that make this city great. PAGES 7-19 PageTwo2 August 29-September 11, 2014 Prishtina Insight HOW TO FUND EXTREMISM - 3. Create fake work contracts AND NOT GET Create 10 fictitious contracts for workers in Afghanistan and/or Iraq, where thousands of CAUGHT Kosovars have taken lucrative jobs as contractors. 1. Start a fake business 4. Create a web page for a fictitious company that works internationally. Include staf bios and job Open accounts in Kosovo vacancies for extra credibility. Contacts in Kosovo present contracts while opening bank accounts. A bank ofcer likely will do little more than check the company name against a black list, and perform a Google search to verify that the company on the contract exists. The existence of the website will provide sufcient proof of this. 2. Prishtina Balkan Investigative Reporting Network Open a Middle East bank account Insight BZchVZHijYZciZkZ!ÑghiÒddg!&%%%%!Eg^h]i^cV!@dhdkd PHONE: (-&%(-')((*-EDITOR-IN-CHIEF:CViZ Open a company bank account account in the IVWV` STAFF:?ZiVM]VggV!BVgXjhIVccZg!KVaZg^Z=de`^ch!EZig^i8daaV`j! Middle East, such as in Yemen or Afghanistan. EVg^bDaajg^!CZ`iVgOd\_Vc^VcY6g^_ZiVAV_`V#DESIGN:IgZbWZaViEg^h]i^cV >ch^\]i^hhjeedgiZYWni]ZCdglZ\^Vc:bWVhhn!GdX`Z[ZaaZg7gdi]Zgh;jcY Deposit 50,000 euros per month as income. VcYi]Z7Va`Vc>ckZhi^\Vi^kZGZedgi^c\CZildg`# Prishtina Insight August 29-September 11, 2014 3 inancial crimes expert Bashkim Zeqiri recently explained to FPI how a terrorist group in the Middle East could hypothetically 5. -

Clare Hall Cambridge
Clare Hall Cambridge Annual Review 2011 Clare Hall Annual Review 2011 Contents President’s Letter p2 Bursar’s Notes p4 Senior Tutor’s Notes p6 News from the Development Office p8 Profile: Tom Karen p11 List of Donors p12 New Research Fellows p14 Student News p16 The Salje Building p18 Stefan Collini’s New Book p21 Ashby Lecture 2011 p22 Sports News p24 A Year of Music p26 From Literature to Visual Art p28 Profile: Professor Maria Grazia Spillantini p29 Research at the Botanic Garden p30 Profile: Alan Short Sustainable Architect p32 Return to Kosovo p34 News of Members p36 Front cover: Graduation, July 2011 Edited by: Trudi Tate | Lynne Richards Clare Hall | Herschel Road | Cambridge | CB3 9AL | Tel: 01223 332360 [email protected] Photo credits: Andrea Baczynski | Julia Hedgecoe | Andrew Houston | Philip Moore | Philip Mynott | Trudi Tate | Andy Wang | Mi Zhou Design and production: M J Webb Associates Ltd Martin Harris, President Page 2 Clare Hall Cambridge Clare Hall Annual Review 2011 Perhaps for the first time since Barbara and I came to Clare Hall, the main focus of attention has seemed this year to be on the external environment, in particular President’s Letter the changes planned for English higher education and their possible eventual consequences for graduate education and thus for Clare Hall. The very use of the word ‘English’ here reminds us that higher education is now devolved to the four nations, and that the All of this has made the Governing Body reflect more on our by what our worldwide community wants to support. -

''Yeni Bir Dil Konuşmak, Yeni Bir Dünyanın Ve Kültürün Kapılarını Açmaktır.'' Frantz Fanon PRİŞTİNE GEZİ
‘’Yeni bir dil konuşmak, yeni bir dünyanın ve kültürün kapılarını açmaktır.’’ Frantz Fanon PRİŞTİNE GEZİ REHBERİ; Kosova’nın başkenti olan Priştine’ye seyahat etmeden önce okuduğum blogların ve diğer seyahat yazılarının birçoğunda gezmeye değer bir şehir olmadığı, vakit kaybı olduğu ve gereksiz masraf olacağı yazılıydı ancak ben hiçbir şehrin bu denli göz ardı edilmemesi gerektiğine inandığım için Balkanlar turumun rotasına Priştine’yi de dahil ettim. İyi ki de etmişim zira Priştine beni gayet memnun uğurladı. Tamam, diğer adı duyulmuş Balkan şehirleri kadar gezip görülecek pek fazla alternatif sunmuyor ama yine de en az iki gün boyunca sıkılmadan vakit geçirebileceğiniz kadar da verimli bir şehir. Kosova’nın incisi aslında Prizren, hatta Balkanlar turu için listenin üst sıralarında olması gereken bir şehir. Prizren ve Priştine’yi, İstanbul ve Ankara gibi düşünebilirsiniz. Asıl gezilecek yer Prizren ama Priştine’ye de sırf klasik başkent havası var diye haksızlık etmeyelim, gidelim, gezelim. ULAŞIM: Priştine, benim Balkanlar turumun son durağıydı. Rotamı ona göre şekillendirmiştim, ya Saraybosna’dan başlayıp Priştine’den dönecektim, ya da tam tersini yapacaktım. Bilet fiyatlarını kontrol ettiğimde Priştine’den dönüşün çok daha ucuz olduğunu gördüğüm için bu şekilde planladım. Pegasus yılın birçok dönemi Balkanlar için uygun fiyatları bilet satışı yapıyor, eskiden kurlar bu kadar uçuk olmadığı için çok daha ucuzdu ama yine de Avrupa ülkelerinin biletlerine kıyasla daha uygun denilebilir. Ara sıra bilet fiyatlarına bakıyorum, Priştine için tek yön ortalama 350-400 Lira dolaylarında. Zaten Balkan ülkeleri için en iyi alternatifiniz de Pegasus Havayolları. Diğer Balkan şehirlere göre Priştine’nin biletleri daha uygun, bu yüzden siz de benim gibi Priştine’den başlamayı veya Priştine’den dönmeyi düşünebilirsiniz. -

Collapse in Kosovo, 22 April 2004, P.13)
KOSOVO: TOWARD FINAL STATUS Europe Report N°161 – 24 January 2005 TABLE OF CONTENTS EXECUTIVE SUMMARY AND RECOMMENDATIONS................................................. i I. INTRODUCTION: THE ISSUE THAT CANNOT WAIT ......................................... 1 II. POSITIONS OF THE KEY PLAYERS ....................................................................... 2 A. THE INTERNATIONAL COMMUNITY .......................................................................................2 1. Standards and status...................................................................................................2 2. The 22 September Statement .....................................................................................3 3. Shoals ahead ..............................................................................................................4 B. THE KOSOVO ALBANIANS.....................................................................................................6 1. Identity and independence .........................................................................................6 2. Lack of practical preparation for independence ........................................................8 3. Into 2005: An agenda for the Kosovo Albanians ....................................................10 C. THE KOSOVO SERBS ...........................................................................................................13 D. BELGRADE ..........................................................................................................................15 -

The EU's New 'Carrot and Stick' Approach to Kosovo
Inside Prishtina: Rebirth of the Rilindja Building October 16- 29, 2009 Issue No. 25 www.prishtinainsight.com Free copy OPINION The EU’s New Teta Mia solves ‘Carrot and your election Stick’ Approach problems to Kosovo > page 13 ARTE By Lawrence Marzouk & Petrit Collaku ‘Laqhe aven’ to the he European Commission has requirements”. Rolling Festival unveiled its ‘carrot and stick’ While the EC’s study talks of Tapproach to Kosovo in three opening a dialogue on visa liberali- reports released on Wednesday, sation for Kosovo, the phrase used > page 9 which open up a possible path for when negotiations started with visa liberalisation but also deliver other western Balkan states, the severe criticism on the country’s report goes on to state that a com- progress. prehensive strategy will first be GUIDE According to the 2009 Progress drawn up. Report for Kosovo, Prishtina faces It remains unclear what this new The five “major challenges” in areas includ- ‘dialogue’ entails and how or when ing corruption, public administra- Kosovo will officially join the autumnal tion, economy and freedom of the process of visa liberalisation. media. The study reads: “Based on a wonder of Albania The EC’s Feasibility Study on thorough assessment the Bill Clinton in Kosovo Next Month to Unveil Statue Kosovo has had the ‘feasibility’ Commission proposes to draft a > page 8 dropped from the title as five out of comprehensive strategy to guide The statue of Bill Clinton was unveiled in Prishtina on Tuesday, only the 27 EU member states do not Kosovo’s efforts to meet the EU’s to be wrapped up again after it was announced that the former US pres- recognise Prishtina’s declaration of requirements for visa liberalisa- ident was to visit Kosovo next month. -

Issue 19 – Kosovo – November 12, 2010
Issue 19 – Kosovo – November 12, 2010 Kosovo—is it a country? Seventy-one countries1 around the world say yes, but most of our Serbian friends would emphatically say no, and it would not take long for you to realize how emotionally charged this subject is. This is not the same as kidding your Southern relatives over the outcome of the US Civil War. The events are too recent; the experiences firsthand—not something read from a textbook. To diffuse the situation, it might be best to steer the conversation in a different direction. Map: This map shows Kosovo as a separate state.2 For us, Kosovo appears initially of little interest. There’s no stock exchange yet; it’s a small landlocked country—slightly smaller than Connecticut—with a population of only 2 million; and it’s one of the poorest countries in Europe on a per capita basis. We examine it here because of an opportunistic experience that Frontaura associate Eric Dahl had in September and October. Eric spent three weeks in Kosovo as part of the Kosovo-America Emerging Leaders Program that the US State Department sponsored. He was one of 13 individuals to participate in this business exchange 1Currently, 71 countries recognize Kosovo, including the US, Canada, and most of Western Europe. Notable countries that do not recognize Kosovo include China, Russia, and Serbia. Five EU member states—Cyprus, Greece, Romania, Slovakia, and Spain—also do not recognize Kosovo; some because of they do not want to create a precedent given separatist movements within their own countries.