Schinkelmuseen 143 7
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
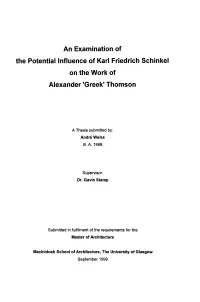
An Examination of the Potential Influence of Karl Friedrich Schinkel on the Work of Alexander 'Greek' Thomson
An Examination of the Potential Influence of Karl Friedrich Schinkel on the Work of Alexander 'Greek' Thomson A Thesis submitted by: Andre Weiss B. A. 1998 Supervisor: Dr. Gavin Stamp Submitted in fulfilment of the requirements for the Master of Architecture Mackintosh School of Architecture, The University of Glasgow September 1999 ProQuest N um ber: 13833922 All rights reserved INFORMATION TO ALL USERS The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. In the unlikely event that the author did not send a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if material had to be removed, a note will indicate the deletion. uest ProQuest 13833922 Published by ProQuest LLC(2019). Copyright of the Dissertation is held by the Author. All rights reserved. This work is protected against unauthorized copying under Title 17, United States Code Microform Edition © ProQuest LLC. ProQuest LLC. 789 East Eisenhower Parkway P.O. Box 1346 Ann Arbor, Ml 4 8 1 0 6 - 1346 Contents List of Illustrations ...................................................................................................... 3 Introduction .................................................................................................................9 1. The Previous Claims of an InfluentialRelationship ............................................18 2. An Exploration of the Individual Backgrounds of Thomson and Schinkel .............................................................................................................38 -

Aboard Our Airships
Welcome aboard our airships "Take a culinary trip to Potsdam's palaces and gardens with our airships!" Buffet suggestions for groups of 100+ – 3 – Contact Banquet and Events Department Tel.: +49 331 907 75 555 Email: [email protected] A cultural paradise Potsdam's palaces and gardens Many of the palaces and parks in Potsdam have been designated UNESCO world heritage sites and are consequently some of the most popular places of interest in Brandenburg's state capital. However, Potsdam's origins can be traced back to the 10th century, when the city's foundation stone was laid in the shape of Poztupimi fort, home to a Slavic settlement. Over the centuries, the once rather sleepy fishing village gradually developed into the royal residence of the Prussian kings, which bears more than a passing resemblance to Versailles. The New Palace, Sanssouci Palace, Cecilienhof Palace and the Marble Palace in the New Garden, or Babelsberg Palace, situated in the landscape park of the same name, are just some of the numerous palaces and parks dotted around this spectacular city. Buffet suggestions for groups of 100+ “Charlottenhof” Palace Buffet Starters Mixed lettuce: iceberg , endives, radicchio and frisée Dark balsamic dressing made of Aceto balsamic vinegar and olive oil Acai dressing refined with cardamon Grilled red and yellow halves of bell pepper marinated with herbs and oil Greek “shepherd” salad made of feta, cucumber, bell pepper, onion, garlic and olives in bright dressing Grilled courgette and red bell pepper marinated with oil Waldorf -

Jahrbuch Stiftung Preußische Schlösser Und Gärten Berlin-Brandenburg
Jahrbuch Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg Band 2 1997/1998 Copyright Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online- Publikationsplattform der Stiftung Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland (DGIA), zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Herunterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu privaten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hinausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weitergabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch strafrechtlich verfolgt werden. Berichte Generaldirektion Schwerpunkte in der öffentlich wirksamen Arbeit der Generaldirektion, zu der das Büro des Generaldirektors, der persönliche Referent, das Pressereferat, das Referat für Publikationen und der Stiftungskonservator gehören, waren neben der Koordination und Planung der Publikationstätigkeit der Stiftung wiederum die Organisation protokollarischer Veranstaltungen sowie die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. In den Berichtsjahren wurden insgesamt 40 (1997: 18; 1998: 22) Pressetermine durchgeführt. Dazu gehörten Pressekonferenzen beziehungsweise Pressevorbesichtigungen, Fototermine und Hintergrundgespräche. Außerdem gab die Pressestelle insgesamt 104 (1997: 46; 1998: 58) Presseinformationen heraus. Über die regelmäßigen Berichte und Reportagen in den regionalen Tageszeitungen -

Festschrift Zum 50Jährigen Jubiläum Der Humboldt-Gesellschaft 1962 – 2012
HUMBOLDT-GESELLSCHAFT FÜR WISSENSCHAFT, KUNST UND BILDUNG e. V. Festschrift zum 50jährigen Jubiläum der Humboldt-Gesellschaft 1962 – 2012 Historische Dokumente Akademischer Festakt Vorträge und Berichte zur 95. Tagung der Humboldt-Gesellschaft vom 4. bis 6. Mai 2012 in Berlin Vorträge und Berichte zur 96. Tagung der Humboldt-Gesellschaft vom 12. bis 14. Oktober 2012 in Bad Nauheim Festschrift zum 50jährigen Jubiläum der Humboldt-Gesellschaft 1962 – 2012 mit Beiträgen von Bolesław Andrzejewski, Erich Bammel, Ulrich Bansemer, Matthias Bischof, Dirk Bißbort, Ilse Brem, Udo von der Burg, Helga Colbert-Boscheinen, Daniela Fugellie, Ulrich von Heinz, Kurt Heller, Dagmar Hülsenberg, Kristin Junga, Walter Krämer, Erwin Kuntz, Karl Lubomirski, Mathias Mejeh, Carsten Niemitz, Hermann Parzinger, Ludger Roth, Helmut Schwarz, Silke Siebrecht und Sara Tavakolimehr Humboldt-Gesellschaft für Wissenschaft, Kunst und Bildung e.V. Die Beiträge geben ausschließlich die Meinung der Verfasser wieder. Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. Humboldt-Gesellschaft für Wissenschaft, Kunst und Bildung e.V., Mannheim ISBN: 978-3-940456-45-7 Copyright 2012 by Humboldt-Gesellschaft für Wissenschaft, Kunst und Bildung e.V. Sitz Mannheim Einzusehen im Internet unter <www.humboldtgesellschaft.org> Jede Art der Vervielfältigung und Wiedergabe ist untersagt. Schriftleitung: -

I Meilensteine in Thorvaldsens Künstlerbiografie
I Meilensteine in Thorvaldsens Künstlerbiografie 1 Jason und die Folgen Am 29. August 1796 bestieg Thorvaldsen in Kopenhagen die Fregatte Thetis, die ihn nach Malta brachte. Von dort reiste der Bildhauer nach Rom weiter, wo er sein Stipendium der Kopenhagener Kunstakademie antrat. Am 8. März 1797 erreichte er schließlich Rom und feierte dieses Datum fortan als seinen zweiten Geburtstag.1 Tags darauf schrieb Lorens Henrich Fisker, der Kapitän der Thetis, an seine Frau: „Thorvaldsen ist jetzt in Rom, Gott sei mit ihm! Er ist ein honetter Kerl, aber ein fauler Hund.“2 Die angebliche Bequemlich- keit des jungen Thorvaldsen sollte besonders in posthumen Biografien als Kontrast zur späteren Schaffenskraft betont und damit zu einem festen Bestandteil der Meistererzäh- lung seiner Künstlerbiografie gemacht werden.3 In Rom nahm sich der Archäologe Georg Zoëga seines jungen Landsmannes an. Während Fisker den Bildhauer als faul bezeichnet hatte, beklagte Zoëga dessen mangel- hafte Bildung. So betrachtete er Thorvaldsen zwar als äußerst begabten Künstler, jedoch sei er „höchst unwissend in allem, was ausserhalb der Kunst liegt“.4 Zoëga wunderte sich darüber, dass die Akademie ihre Stipendiaten „so roh“ nach Rom schicke, wo der Künstler „sehr viele Zeit verlieren muß, um Dinge zu lernen, ohne welche er seinen hiesigen Auf- enthalt nicht gehörig nützen kann, und welche er leichter und geschwinder vor der Reise hätte lernen können“.5 Weiter fragte er sich: 1 Thiele 1852 – 1856, Bd. 1, 33 – 46 (inkl. Thorvaldsens Reisetagebuch). Zu Thorvaldsens ‚römischem Ge- burtstag‘ siehe ebd., 46; auch Repholtz 1911, 41; Baronesse Stampes Erindringer 1912, 56. 2 Lorens Henrich Fisker an Charlotte Amalie Fisker, 9. -

25Th Anniversary
25th Anniversary Montblanc de la Culture 25th Anniversary Montblanc de la Culture Arts Patronage Award Arts Patronage Montblanc de la Culture 25th Anniversary Arts Patronage Award 1992 25th Anniversary Montblanc de la Culture Arts Patronage Award 2016 Anniversary 2016 CONTENT MONTBLANC DE LA CULTURE ARTS PATRONAGE AWARD 25th Anniversary — Preface 04 / 05 The Montblanc de la Culture Arts Patronage Award 06 / 09 Red Carpet Moments 10 / 11 25 YEARS OF PATRONAGE Patron of Arts — 2016 Peggy Guggenheim 12 / 23 2015 Luciano Pavarotti 24 / 33 2014 Henry E. Steinway 34 / 43 2013 Ludovico Sforza – Duke of Milan 44 / 53 2012 Joseph II 54 / 63 2011 Gaius Maecenas 64 / 73 2010 Elizabeth I 74 / 83 2009 Max von Oppenheim 84 / 93 2 2008 François I 94 / 103 3 2007 Alexander von Humboldt 104 / 113 2006 Sir Henry Tate 114 / 123 2005 Pope Julius II 124 / 133 2004 J. Pierpont Morgan 134 / 143 2003 Nicolaus Copernicus 144 / 153 2002 Andrew Carnegie 154 / 163 2001 Marquise de Pompadour 164 / 173 2000 Karl der Grosse, Hommage à Charlemagne 174 / 183 1999 Friedrich II the Great 184 / 193 1998 Alexander the Great 194 / 203 1997 Peter I the Great and Catherine II the Great 204 / 217 1996 Semiramis 218 / 227 1995 The Prince Regent 228 / 235 1994 Louis XIV 236 / 243 1993 Octavian 244 / 251 1992 Lorenzo de Medici 252 / 259 IMPRINT — Imprint 260 / 264 Content Anniversary Preface 2016 This year marks the 25th anniversary of the Montblanc Cultural Foundation: an occasion to acknowledge considerable achievements, while recognising the challenges that lie ahead. Since its inception in 1992, through its various yet interrelated programmes, the Foundation continues to appreciate the significant role that art can play in instigating key shifts, and at times, ruptures, in our perception of and engagement with the cultural, social and political conditions of our times. -

ARRE-TM-Potsdam 2018
PROGRAM ARRE-Technical Meeting at Potsdam, 14th – 16th November 2018 “Aging or retouching? Problem and advantage of artificial patina in historic interiors.” DATE: Wednesday 14 th November 2018 to Friday 16 th November 2018 LOCATION: 14 th November 2018 Potsdam, Palaces and Collection Department of SPSG, Zimmerstrasse 10/11, Potsdam (south edge of Sanssouci Park) 15 th November 2018 Potsdam, Sanssouci Park, New Palace (Neues Palais) Potsdam, New Garden (Neuer Garten), Marble Palace (Marmorpalais) 16 th November 2018 Berlin, Peacock Island (Pfaueninsel) OBJECT: “Aging or retouching? Problem and advantage of artificial patina in historic interiors.” Wednesday, 14th of November 2018 Meeting Point: Palaces and Collection Department of SPSG, first floor, Zimmerstrasse 10/11, Potsdam (south edge of Sanssouci Park) 12:30 pm get together Zimmerstraße 10/11, Potsdam (Palaces and Collection Department, first floor) 01:00 pm introduction to the topic Samuel Wittwer, director of palaces and collection department, SPSG 01:30 pm presentations from participants (each 15-20 minutes Mette Marciniak presentation plus discussion) and others, Denmark Recent maintenance projects – a line in the work on a Sebastian historic castle (Mette Marciniak and others) Edwards, United Kingdom Elfriede Iby, Historic Royal Palaces (Sebastian Edwards) Austria Karolina Examples of restauration and reconstruction in Schönbrunn Alkemade / Palace and the Kaiserappartements in the Vienna Hofburg Joanna Paprocka- (Elfriede Iby) Gajek, Poland Reconstruction of upholsteries in -

Inhaltsverzeichnis I. Einführung Ii. Geschichte
INHALTSVERZEICHNIS GELEITWORT VON HANS-JOACHIM GIERSBERG UND BURKHARDT GÖRES . ix DANKSAGUNG XIII I. EINFÜHRUNG Ziele der Publikation 3 Forschungsstand 4 Quellen 6 BEGRIFFSERKLÄRUNGEN Herkunft des Wortes Kronleuchterformen Regionale Bezeichnungen KULTURGESCHICHTLICHE ANMERKUNGEN 11 Materialien 11 Wer hat Kronleuchter besessen? 11 Wo befanden sich Kronleuchter? 11 Kerzen 12 II. GESCHICHTE UND HERSTELLUNG EUROPÄISCHE ENTWICKLUNGEN 21 Niederlande 21 Frankreich 24 Italien 26 Skandinavische Länder 28 Österreich 31 Bayern 33 Sachsen 38 Russland 41 England 42 Spanien 44 Kleinere Fürstentümer und adlige Hofhaltungen 46 Niederer Adel und Bürgertum in Deutschland 48 Volkskunst 49 ENTSTEHUNG UND ENTWICKLUNG DES KRONLEUCHTERS AUS BERGKRISTALL UND GLAS 51 Der Behangkronleuchter 51 Der Glasarmkronleuchter 75 VI DIE HERSTELLUNG VON KRONLEUCHTERN Inhaltsverzeichnis IM 18. UND 19. JAHRHUNDERT - DAS GESTELL 87 Bronze Das Material Verarbeitung und Veredelung 90 Möglichkeiten zur Unterscheidung der verschiedenen Vergoldungstechniken 93 Bronziers in Berlin und Potsdam im 18. Jahrhundert zur Zeit König Friedrichs II. 94 Die Berliner Bronzewarenfabrikanten Werner & Mieth 96 Weitere Berliner Bronziers und Lüsterhersteller 103 DIE HERSTELLUNG VON KRONLEUCHTERN IM 18. UND 19. JAHRHUNDERT - DER BEHANG 105 Bergkristall 105 Das Material 105 Entstehung des Bergkristalles in den Alpen 106 Große Funde in der Schweiz bis zum 18. Jahrhundert 107 Fundorte der zu Kronleuchterbehang verarbeiteten Bergkristalle 108 Gewinnung 109 Handel 110 Verarbeitung 111 Händler und Hersteller von Bergkristallbehang 114 Glas 116 Das Material 116 Rohstoffe und Glassorten 116 Veränderungen und Schäden 118 Ziele der Glasherstellung 119 Herstellung von Kronleuchterbehang 120 Herstellung von Glasarmkronleuchtern 124 Glasschleifer, die von 1740 bis 1802 in Berlin und Potsdam Kronleuchterbehang schliffen und Kronleuchter zusammenstellten 130 Weitere Entwicklung bei der Anfertigung von Kronleuchterbehang 133 Die Zechliner Hütte 134 Zechliner Kronleuchter 138 Schlesische Glashütten 140 Schlesische Kronleuchter 142 VII III. -

Exploring the Altes Museum the Altes Museum Or Old Museum Was
1 Sara Marcus 12-11-18 From Royalty to Bourgeoisie: Exploring the Altes Museum The Altes Museum or Old Museum was constructed in Berlin between 1824-30 by Karl Friedrich Schinkel (1781-1841). Originally known as the “Königliches Museum,” it was commissioned by King Friedrich Wilhelm III of Prussia for the purpose of being the first public art museum in Prussia as well as the first royal museum. As the relationship in the 19th century changed between art, the observer, and who should be a part of that experience, the Altes Museum was erected to embody the idea of Berlin as a center of learning and culture, and to elevate its citizens in the presence of art. The Berlin Museum emerged from a small group of the ruling class and it was first officially demanded and proclaimed by the Art Academy under Friedrich Wilhelm II. (Das Berliner Museum entsteht aus einer kleinen Gruppe der herrschenden Schicht. Öffntlich wurde es zuerst gefordrt und verkundet… in der Kunstakademie unter Friedrich Wilhelm II.)1 After the Wars of Liberation, his son, King Friedrich Wilhelm III, continued to advocate for the foundation of a public art museum to display the collection of artifacts that Prussia had amassed over the years. During the reign of Napoleon, Prussian art was forcefully taken to be displayed in Paris, which alerted the Prussian people that a permanent home to show off their national heritage was necessary.2 While ideas for a museum were already in the air, it is safe to say that the main reason why construction started when it did was in response to Napoleon’s looting. -

Berlin's New Cultural Heart
I Research Text Berlin’s new cultural heart Cultural stronghold and historical centre Berlin, September 2017 – Today, Berlin belongs to one of Europe’s leading centres of culture – and its heart beats strongest directly in the old historical city. For centuries, Berlin’s city centre has been home to a unique concentration of outstanding cultural institutions constructed on the ground where the medieval city of Berlin was founded. The modern Mitte district does not just boast the UNESCO World Heritage Site of the Museum Island, but also two opera houses and six major theatres, as well as museums, innumerable galleries and arts venues. Now, this cultural ensemble is gaining a new dimension with many new major cultural projects located here, just a few minutes’ walk apart. You can find an overview of the main on-going and planned landmark projects below. Pierre Boulez Saal Opened in March 2017, the new Pierre Boulez Saal is a major international concert hall. Initiated by Daniel Barenboim, General Music Director of the Staatsoper Unter den Linden, the hall was developed by American architect Frank Gehry and with globally acclaimed acoustician Yasuhisa Toyota creating the impeccable acoustics. Lined with light Canadian cedarwood, the Pierre-Boulez-Saal offers a flexible design allowing the auditorium’s seating as well as the stage to be arranged in various constellations for a wide spectrum of events. The concert hall is also the public face of the Barenboim-Said Akademie, not only serving as its home venue but also a space where young musicians from conflict zones in the Middle East can practice under the guidance of their mentors. -

Circling Opera in Berlin by Paul Martin Chaikin B.A., Grinnell College
Circling Opera in Berlin By Paul Martin Chaikin B.A., Grinnell College, 2001 A.M., Brown University, 2004 Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Program in the Department of Music at Brown University Providence, Rhode Island May 2010 This dissertation by Paul Martin Chaikin is accepted in its present form by the Department of Music as satisfying the dissertation requirement for the degree of Doctor of Philosophy. Date_______________ _________________________________ Rose Rosengard Subotnik, Advisor Recommended to the Graduate Council Date_______________ _________________________________ Jeff Todd Titon, Reader Date_______________ __________________________________ Philip Rosen, Reader Date_______________ __________________________________ Dana Gooley, Reader Approved by the Graduate Council Date_______________ _________________________________ Sheila Bonde, Dean of the Graduate School ii Acknowledgements I would like to thank the Deutsche Akademische Austauch Dienst (DAAD) for funding my fieldwork in Berlin. I am also grateful to the Institut für Musikwissenschaft und Medienwissenschaft at Humboldt-Universität zu Berlin for providing me with an academic affiliation in Germany, and to Prof. Dr. Christian Kaden for sponsoring my research proposal. I am deeply indebted to the Deutsche Staatsoper Unter den Linden for welcoming me into the administrative thicket that sustains operatic culture in Berlin. I am especially grateful to Francis Hüsers, the company’s director of artistic affairs and chief dramaturg, and to Ilse Ungeheuer, the former coordinator of the dramaturgy department. I would also like to thank Ronny Unganz and Sabine Turner for leading me to secret caches of quantitative data. Throughout this entire ordeal, Rose Rosengard Subotnik has been a superlative academic advisor and a thoughtful mentor; my gratitude to her is beyond measure. -

Unesco Welterbe Museumsinsel Berlin
to the list of UNESCO World Heritage. World UNESCO of list the to pm, closed Mondays closed pm, 8 to Thurs pm, 6 – am 10 Sun – Tues Mondays closed pm, 8 to Thurs pm, 6 – am 10 Sun – Tues pm 8 to Thurs pm, 6 – am 10 Sun – Mon Mondays closed pm, 8 to Thurs pm, 6 – am 10 Sun – Tues added was Berlin Museumsinsel 1999 In century. 19th the to Entrance: Monbijoubrücke Entrance: Kolonnadenhof) (via Bodestraße Entrance: James-Simon-Galerie) or Kolonnadenhof (via Lustgarten Am Entrance: world, ancient the through history, early and Age Stone the Entrance: Bodestraße Bodestraße Entrance: collections. The encyclopaedic spectrum of works spans from from spans works of spectrum encyclopaedic The collections. art unique Berlin’s zu Museen Staatliche the housing Museum (Ethnological Museum) with European artworks. European with Museum) (Ethnological Museum Schadow are on view in the sculpture hall. hall. sculpture the in view on are Schadow is the mysterious “Berlin Golden Hat” from the Bronze Age. Bronze the from Hat” Golden “Berlin mysterious the is architecture museum of years 100 represent buildings Its Museum” juxtaposes masterpieces from the Ethnologisches Ethnologisches the from masterpieces juxtaposes Museum” Rauch, Berthel Thorvaldsen, Antonio Canova and Rudolph Rudolph and Canova Antonio Thorvaldsen, Berthel Rauch, from the Stone Age to the Middle Ages. One of the highlights highlights the of One Ages. Middle the to Age Stone the from level. upper the on display on is Period Imperial Roman the and important and most beautiful museum ensembles in the world. world. the in ensembles museum beautiful most and important the exhibition “Beyond Compare.