Die Kleine Studentische Fechtfibel
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Jewish Encyclopedia
Jewish Encyclopedia The History, Religion, Literature, And Customs Of The Jewish People From The Earliest Times To The Present Day Volume XII TALMUD – ZWEIFEL New York and London FUNK AND WAGNALLS COMPANY MDCCCCVI ZIONISM: Movement looking toward the segregation of the Jewish people upon a national basis and in a particular home of its own: specifically, the modern form of the movement that seeks for the Jews “a publicly and legally assured home in Palestine,” as initiated by Theodor Herzl in 1896, and since then dominating Jewish history. It seems that the designation, to distinguish the movement from the activity of the Chovevei Zion, was first used by Matthias Acher (Birnbaum) in his paper “Selbstemancipation,” 1886 (see “Ost und West,” 1902, p. 576: Ahad ha – ‘Am, “Al Parashat Derakim,” p. 93, Berlin, 1903). Biblical Basis The idea of a return of the Jews to Palestine has its roots in many passages of Holy Writ. It is an integral part of the doctrine that deals with the Messianic time, as is seen in the constantly recurring expression, “shub shebut” or heshib shebut,” used both of Israel and of Judah (Jer. xxx, 7,1; Ezek. Xxxix. 24; Lam. Ii. 14; Hos. Vi. 11; Joel iv. 1 et al.). The Dispersion was deemed merely temporal: ‘The days come … that … I will bring again the captivity of my people of Israel, and they shall build the waste cities and inhabit them; and they shall plant vineyards, and drink the wine thereof … and I will plant them upon their land, and they shall no more be pulled up out of their land” (Amos ix. -

Der Student Im Garten*
Der Student im Garten von Harald Lönnecker Frankfurt a. Main 2008 Dateiabruf unter: www.burschenschaft.de Dateiabruf unter: www.burschenschaft.de Der Student im Garten* von Harald Lönnecker 1924 veröffentlichte die Deutsche Studentenschaft, der öffentlich-rechtliche Zusammenschluß der Allgemeinen Studentenausschüsse in Deutschland, Österreich, Danzig und dem Sudetenland, im Göttinger Deutschen Hochschul-Verlag ein 194 Seiten umfassendes Buch mit dem Titel: „Rosanders, des lieblich floetenden Schaeffers und klirrend Gassatim gehenden Purschen Studentengartlein, worinnen derselbe manichmahl mit seinen Confratibus und Liebsten mit sonderer Ergezzlichkeit sich erlustiret, spazziret und maniche sueß-dufftende Bluhme sich abgebrochen“.1 „Gassatim gehen“ oder „gassatieren“ bedeutete in der Studentensprache seit dem ausgehenden 17., beginnenden 18. Jahrhundert, sich lärmend, musizierend und singend nachts auf den Gassen und Straßen herumzutreiben. Dies geschah in der Regel „klirrend“ von Sporen und Raufdegen, der gern lautstark und herausfordernd als „Gassenhauer“ an Steinen und Häuserecken gewetzt wurde. „Pursch[e]“ oder „Bursch[e]“ war die gängige Bezeichnung für den Studenten, „Burschenschaft“ hieß nicht mehr als „Studentenschaft“. Erst nach 1815 bezeichnet das Wort einen bestimmten Korporationstypus.2 Das „Studentengartlein“ lehnt sich an Johannes Jeeps (1581/82-1644) erstmals 1605 bzw. 1613 erschienenes „Studentengärtlein“ an, ein Studentenliederbuch, entstanden an der Nürnberger Hochschule zu Altdorf und ihren Studenten gewidmet, das eine Tradition der einfachen Strophen- und Melodiegestaltung für das säkulare Studentenlied begründete und für rund zweihundert Jahre wegweisend und stilbildend für den studentischen Gesang wurde.3 * Zuerst in: Eva-Maria Stolberg (Hg.), Auf der Suche nach Eden. Eine Kulturgeschichte des Gartens, Frankfurt a. M., Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien 2008, S. 111-133. 1 „auffs Neue an den Tag gebracht [...] von Kurt Siemers“. -

Verbindungen in Königsberg Liste
Verbindungen in Königsberg a) Albertus-Universität Königsberg (Albertina) 1. Allgemeinheiten 1.1. Königsberger Burschenschaft I (1817-1819) 1.2. Allgemeine Burschenschaft (1819-1833) 1.3. Königsberger Burschenschaft II (1833) 1.4. Albertina, Allgemeine Burschenverbindung (1838-1845) 1.5. Allgemeinheit (kein eigentlicher Name) (1845-1846) 1.6. Allgemeine Studentenschaft (1848-1851/52) 1.7. Königsberger Studentenschaft (1884-1888) 2. Korporationen 2.1. Adalberta, Verein Katholischer Deutscher Studentinnen im VKDSt (1916-1933?) 2.2. Agronomia, Corps im RSC, Bauernschaft im NTh (1879-1935/36) 2.3. Akademische Freischar (Hochschulgilde) in der DG (1926-1934) Akademische Gesellschaft für allgemeine Wissenschaften ® Akad. Verbindung Albertia 2.4. Akademische Muße, Kränzchen in der Königsberger Burschenschaft (1818-1819) 2.5. Akademischer Fechtclub (1859-1860) Akademischer Gesangverein ® Sängerverbindung Askania Akademischer Pharmazeutenverein ® Freischlagende Verbindung Marcomannia 2.6. Akademischer Richard Wagner-Verein I (um 1885) 2.7. Akademischer Richard Wagner-Verein II (1908-1914) Akademischer Ruderverein ® Akad. Ruderverbindung Alania Akademischer Sportclub ® Akad. Sportverbindung Curonia Akademischer Turnverein ® Burschenschaft Teutonia Akademischer Verein für neuere Philologie ® Turnerschaft Markomannia Akademische Turnriege ® Akad. Turnverbindung Ostmark 2.8. Akademisch-Historischer Verein (1881-vor 1885) Akademisch-Landwirtschaftlicher Verein ® Corps Agronomia 2.9. Akademisch-Mathematischer Verein (1878/79-1889) Akademisch-Medizinischer -

Teil 2: Dresdner Verbindungen
‚Lebenslange Gemeinschaft statt anonyme Massen- universität‘ – mit solchen Worten werben studenti- sche Verbindungen (auch Korporationen genannt) unter den Erstsemestern um Neumitglieder. Was nach Ersatzfamilie klingt, wird vor allem mit Traditionen und angeblich „zeitlosen Werten“ begründet. Zu diesen gehören bunte Mützen und Bänder, Degen und Wappen, rituelle Abendveranstaltungen und jahrhun- dertealte Lieder sowie eine Sprache, die für Außen- stehende kaum zu enträtseln ist. Die meisten dieser Verbindungen sind reine Männerbünde. Kritiker:innen werfen ihnen häufig eine elitäre und frauenfeindliche Haltung, nicht selten sogar explizit extrem rechte Einstellungen vor. Der StuRa der TU Dresden hat sich der Aufgabe gewidmet, Fakten von Klischees zu tren- nen und das deutsche Verbindungswesen allgemein wie auch vor Ort genauer unter die Lupe genommen. Band 2 schaut sich die Dresdner Situation an: Welche Verbindungen gibt es hier, wie sind sie untereinander vernetzt und wie positionieren sie sich öffentlich? Vor allem das Netzwerk rund um die Dresdner Burschen- schaften, die wiederum eng mit Pegida, Identitärer Bewegung und AfD verbunden sind, verdient besonde- re Beachtung, denn Dresden ist für die Neue Rechte in Deutschland längst zu einem Ausnahmeort geworden. Teil 2: Dresdner Verbindungen stura.link/refpob WHAT.StuRa.TUD StuRaTUD WHAT_StuRa_TUD StuRaTUD IMPRESSUM AUSGEFUXT – Kritik an studentischen Verbindungen Teil 2: Dresdener Verbindungen Auch als pdf verfügbar unter: stura.tu-dresden.de/ausgefuxt 1. Auflage - Dezember 2017 – überarbeitet 01. März 2018 Redaktionsschluss: Oktober 2017 Herausgegeben durch die Referate WHAT, Politische Bildung, Hochschulpolitik und Öffentlichkeitsarbeit des Studentenrates (StuRa) der Technischen Universität Dresden Postanschrift: StuRa der TU Dresden Helmholtzstr. 10 01069 Dresden stura.tu-dresden.de Besucheradresse: Haus der Jugend George-Bähr-Str. -

Download File
In the Shadow of the Family Tree: Narrating Family History in Väterliteratur and the Generationenromane Jennifer S. Cameron Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Graduate School of Arts and Sciences COLUMBIA UNIVERSITY 2012 2012 Jennifer S. Cameron All rights reserved ABSTRACT In the Shadow of the Family Tree: Narrating Family History in Väterliteratur and the Generationenromane Jennifer S. Cameron While debates over the memory and representation of the National Socialist past have dominated public discourse in Germany over the last forty years, the literary scene has been the site of experimentation with the genre of the autobiography, as authors developed new strategies for exploring their own relationship to the past through narrative. Since the late 1970s, this experimentation has yielded a series of autobiographical novels which focus not only on the authors’ own lives, but on the lives and experiences of their family members, particularly those who lived during the NS era. In this dissertation, I examine the relationship between two waves of this autobiographical writing, the Väterliteratur novels of the late 1970s and 1980s in the BRD, and the current trend of multi-generational family narratives which began in the late 1990s. In a prelude and three chapters, this dissertation traces the trajectory from Väterliteratur to the Generationenromane through readings of Bernward Vesper’s Die Reise (1977), Christoph Meckel’s Suchbild. Über meinen Vater (1980), Ruth Rehmann’s Der Mann auf der Kanzel (1979), Uwe Timm’s Am Beispiel meines Bruders (2003), Stephan Wackwitz’s Ein unsichtbares Land (2003), Monika Maron’s Pawels Briefe (1999), and Barbara Honigmann’s Ein Kapitel aus meinem Leben (2004). -

RESEARCH in the HISTORY of ECONOMIC THOUGHT and METHODOLOGY RESEARCH in the HISTORY of ECONOMIC THOUGHT and METHODOLOGY Founding Editor: Warren J
RESEARCH IN THE HISTORY OF ECONOMIC THOUGHT AND METHODOLOGY RESEARCH IN THE HISTORY OF ECONOMIC THOUGHT AND METHODOLOGY Founding Editor: Warren J. Samuels (1933–2011) Series Editors: Luca Fiorito, Scott Scheall, and Carlos Eduardo Suprinyak Recent Volumes: Volume 35A: Research in the History of Economic Thought and Methodology: Including a Symposium on the Historical Epistemology of Economics; 2017 Volume 35B: Research in the History of Economic Thought and Methodology: Including a Symposium on New Directions in Sraffa Scholarship; 2017 Volume 36A: Research in the History of Economic Thought and Methodology: Including a Symposium on Bruce Caldwell’s Beyond Positivism after 35 Years; 2018 Volume 36B: Research in the History of Economic Thought and Methodology: Including a Symposium on the Work of Mary Morgan: Curiosity, Imagination, and Surprise; 2018 Volume 36C: Research in the History of Economic Thought and Methodology: Including a Symposium on Latin American Monetary Thought: Two Centuries in Search of Originality; 2018 Volume 37A: Research in the History of Economic Thought and Methodology: Including a Symposium on 50 Years of the Union for Radical Political Economics; 2019 Volume 37B: Research in the History of Economic Thought and Methodology: Including a Symposium on Ludwig Lachmann; 2019 Volume 37C: Research in the History of Economic Thought and Methodology: Including a Symposium on Robert Heilbroner at 100; 2019 Volume 38A: Research in the History of Economic Thought and Methodology: Including a Symposium on Public Finance in the History of Economic Thought; 2020 EDITORIAL BOARD Michele Alacevich Nicola Giocoli University of Bologna, Italy University of Pisa, Italy Rebeca Gomez Betancourt Harald Hagemann University of Lumière Lyon 2, France University of Hohenheim, Germany John Davis Tiago Mata Marquette University, USA; University University College, London, of Amsterdam, The Netherlands UK Till Düppe Steven Medema Université du Québec à Montréal, University of Colorado Denver, Canada USA Ross Emmett Gary Mongiovi Arizona State University, USA St. -

Robert Blum Und Die Burschenschaft
Robert Blum und die Burschenschaft von Harald Lönnecker Koblenz 2006 Dateiabruf unter: www.burschenschaft.de Dateiabruf unter: www.burschenschaft.de Robert Blum und die Burschenschaft* von Harald Lönnecker In der Einleitung zur Verfassungsurkunde der Jenaischen Burschenschaft vom Juni 1815 heißt es: „Nur solche Verbindungen, die auf den Geist gegründet sind, auf welchen überhaupt nur Verbindungen gegründet sein sollten, auf den Geist, der uns das sichern kann, was uns nächst Gott das Heiligste und Höchste sein soll, nämlich Freiheit und Selbständigkeit des Vaterlands, nur solche Verbindungen benennen wir mit dem Namen einer Burschenschaft.“1 Die Burschenschaft war die Avantgarde der deutschen Nationalbewegung. Sie wurzelte in den Freiheitskriegen, stand unter dem Einfluß von Friedrich Ludwig Jahn, Ernst Moritz Arndt und Johann Gottlieb Fichte, war geprägt durch eine idealistische Volkstumslehre, christliche Erweckung und patriotische Freiheitsliebe. Diese antinapoleonische Nationalbewegung deutscher Studenten war politische Jugendbewegung und die erste gesamtnationale Organisation des deutschen Bürgertums überhaupt, die 1817 mit dem Wartburgfest die erste gesamtdeutsche Feier ausrichtete und mit rund 3.000 Mitgliedern 1818/19 etwa ein Drittel der Studentenschaft des Deutschen Bundes umfaßte.2 Die zur nationalen Militanz neigende Burschenschaft, zu einem Gutteil hervorgegangen aus dem Lützowschen Freikorps, setzte ihr nationales Engagement in neue soziale Lebensformen um, die das Studentenleben von Grund auf reformierten. Aber nicht nur das: Die Studenten begriffen die Freiheitskriege gegen Napoleon als einen Zusammenhang von innerer Reform, innenpolitischem Freiheitsprogramm und * Zuerst in: Bundesarchiv (Hg.), Martina Jesse, Wolfgang Michalka (Bearb.), „Für Freiheit und Fortschritt gab ich alles hin.“ Robert Blum (1807-1848). Visonär – Demokrat – Revolutionär, Berlin 2006, S. 113-121. 1Paul Wentzcke, Geschichte der Deutschen Burschenschaft, Bd. -

St. Andrews Ball—A 5 Star Success!!! St
Make Your Plans for Burns Night—Jan 27th at Receptions in Loveland, Ohio!!! ISSUE 14 / WINTER ’11 Bill Parsons, Editor 6504 Shadewater Drive Hilliard, OH 43026 513-476-1112 [email protected] THE NEWSLETTER OF THE CALEDONIAN SOCIETY OF CINCINNATI In This Issue: St. X 5-Star Success 1 St. Andrews Ball—A 5 Star Success!!! St. X Photo Montage 2,9 *Schedule of Events 2 veryone aspires to have at least a little fun and play in their life. And Burns Night 2012 3 Eat Maketewah, The Caledonian CSHD 3 Society of Cincinnati did that! Some Cinti Highld Dancers 3 familiar and some new faces, along A Scottish Xmas Menu 4 with those who have not been seen awhile, were there. Upon arrival *Resource List 4 at Maketewah, the Saint Andrews Out of the Sporran 5 attendees were greeted by the Scottish- IF Stuarts Returned 6-8 like architecture which we, as a *Email PDF Issue only* Society; have never seen before. Gone are the French Baroque, Hall of Mirrors IF Stuarts Returned 7-8* at the Netherland, and missing was the Performances by Cincinnati Scots Color... Fun... Fellow- more contemporary Deco stylings of Highland Dancers and The Cincinnati ship... and Bliss were The Syndicate. Highland Dancers were received the outcome for all Check-in was handled expertly by with great interest. Then the mingling guests at Saint An- PAY YOUR DUES! Billie Andrews and her crew again. of Scots began, as we fostered our drews 2011, captions Don’t forget to pay your current Drinks this year were “great pours” for Scottish friendships. -

Autoritär Elitär Reaktionär
Autoritär Elitär Reaktionär Reader zur Verbindungskritik 2 3 Autoritär Elitär Reaktionär Impressum V.i.S.d.P. Vorstand des AStA der Goethe-Universität Frankfurt: Juri Ghofrani, Alexander »Lexi« Knodt, Anna Yeliz Schentke Redaktion D. Katzenmaier, M. Koelges, C. Mißbach, G. Zettersten Druck Conrad Druck, Berlin Layout gegenfeuer – büro für gestaltung Herausgeber AStA Uni Frankfurt Mertonstraße 26–28 60325 Frankfurt am Main Zweite, überarbeitete und erweiterte Auflage 3000 Stück, Dezember 2017 Kontakt [email protected] Eigentumsvorbehalt Dieser Reader bleibt bis zur Aushändigung an den*die Adressat*in Eigentum des*der Absender*in. »Zur-Habe-Nahme« ist keine Aushändigung im Sinne dieses Vorbehalts. Nicht ausgehändigte Zeitungen sind unter Angabe von Gründen an den*die Absender*in zurückzusenden. Bildnachweise Van. / photocase.com Seite 4, Wikipedia: Seite 10 (Adolf Meyer), Seite 14 (unbekannt), Seite 16–17 (C. Gehrts.), Seite 22 (Archiv Corps Baltia Königsberg), Seite 27 (Georg Pahl), Seite 28 (Bundesarchiv), Seite 32 (Llorenzi), Seite 38 (Source Bibliothèque nationale de France) Seite 40 (Radierung von unbekanntem Künstler, Mitte des 19. Jahrhunderts), Seite 49 (Kalispera Dell) Seite 50 (Metropolico.org) Antifamarburg: Seite 43, 56, 59, Seite 74 (Genealogist) Martin Juen: Seite 64, 48, DPA: Seite 6, 42, 64, 66, Umbruch Bild Archiv: Seite 75 Nicht alle Texte spiegeln in allen Punkten die Meinung der gesamten Redaktion wider. 5 Vorwort 2 — 3 Überblick Burschenschaften & Studentenverbindungen. Eine Handreichung zu Struktur, Inhalten, -

Reader Gegen Studentische Verbindungen
Reader gegen studentische Verbindungen Zusammengestellt von der Antifa TU Berlin Herbst 2005 Antiburschen Reader 3 Antiburschen Reader Inhaltsverzeichnis Editorial 2 Rechte Studentenverbindungen in Berlin 4 Antifaschistisches Infoblatt Institutionalisierte Freundschaft 8 Zur Geschichte und Soziologie studentischer Verbindungen AStA Uni Hannover Das Frauenbild der Burschenschaften 14 Antifa TU Herr Schönbohm von der CDU 16 Antifa TU Elite sein... 20 Ziel korporationsstudentischer Erziehung Stephan Peters (Der rechte Rand) Verbindungen und Frauen 23 AStA Uni Hamburg Studentische Verbindungen 24 AStA Uni Düsseldorf Glossar 29 Antifaschistisches Pressearchiv und Bildungszentrum (APABIZ) Literaturverzeichnis 31 Internetlinks 32 Kontaktaddressen 32 3 Antiburschen Reader Antiburschen Reader Editorial Schwerpunkt dieses Hefts sind studentische Verbindungen bzw. Burschenschaften. Deren reaktionäres Gedankengut, ihre widerlichen Traditionen und ihre seltsamen Lockungen und Werbungen (z.B. Verbandsleben, billig Wohnen) sollen hier beleuchtet werden. Da wäre z.B. ihr elitäres Denken, welches die angehenden Akademiker an der Spitze einer aufstrebenden deutschen Nation sieht. Und tatsächlich finden sich erstaunlich viele „alte Herren“ (Burschis im Berufsleben) in Politik, Wissenschaft und Wirtschaft wieder. Diese sind keineswegs inaktiv, sondern unterstützen die Burschen mittels ihrer Machtpositionen und finanzieller Mittel. Dass eine Verbindung einen „Lebensbund“ schließt, wird hier besonders deutlich. Nicht besser wird dieser “Lebensbund” mit dem -
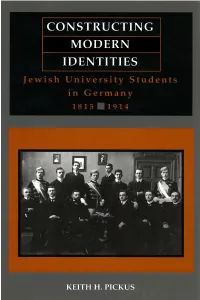
CONSTRUCTING MODERN IDENTITIES Jewish University Students in Germany 1 8 1 5 1 9 1 4
CONSTRUCTING M O D E R N IDENTITIES CONSTRUCTING MODERN IDENTITIES Jewish University Students in Germany 1 8 1 5 1 9 1 4 Keith H. Pickus WAYNE STATE UNIVERSITY PRESS DETROIT Copyright © 1999 by Wayne State University Press, Detroit, Michigan 48201. All material in this work, except as identified below, is licensed under a Creative Commons Attribution- NonCommercial 3.0 United States License. To view a copy of this license, visit https://creativecommons.org/ licenses/by-nc/3.0/us/. All material not licensed under a Creative Commons li- cense is all rights reserved. Permission must be obtained from the copyright owner to use this material. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Pickus, Keith H., 1959– Constructing modern identities : Jewish university students in Germany, 1815–1914 / Keith H. Pickus. p. cm. Includes bibliographical references (p. ) and index. ISBN 978-0-8143-4352-4 (paperback); 978-0-8143-4351-7 (ebook) 1. Jewish college students—Germany—History— 19th century. 2. Jews— Germany—History—1800–1933. 3. Jewish college students—Germany— Societies, etc.— History—19th century. 4. Jews—Germany—Identity. 5. Germany—Ethnic relations. I. Title. DS135.G33 1999 378.1'982'9924043—DC21 99-11845 Designer: S. R. Tenenbaum The publication of this volume in a freely accessible digital format has been made possible by a major grant from the National Endowment for the Humanities and the Mellon Foundation through their Humanities Open Book Program. Grateful acknowledgment is made to the Koret Foun- dation for financial support in the publication of this volume. Wayne State University Press thanks the following individuals and institutions for their generous permis- sion to reprint material in this book: Paul Fairbrook; The Leo Baeck Institute; and Stanford University Press. -

Herrschaftszeiten Nochmal! Ein Reader Zu Studentenverbindungen in Mainz
Ein Reader zu Studentenverbindungen in Mainz. Vorbemerkung Obwohl es fast seit der Gründung der Johannes Gutenberg-Universität Mainz 1946 auch wieder Studentenverbindungen in Mainz gab, fehlte bis 1995, als der Reader „HERRschaftszeiten!“ erschien, eine größere kritische Darstellung der Aktivitäten von Korporationen in Mainz. Da seitdem jedoch einige Jahre ins Land gegangen sind, war es an der Zeit, über einen neuen Reader nachzuden- ken, den Ihr nun in Händen haltet. Dieser neue Reader basiert außer auf den Selbstdarstellungen, Flugblättern und Semesterprogrammen auf einer weitge- henden Analyse der Korporationspresse der letzten Jahre, denn die Vorgänge innerhalb der Dachverbände lassen auch Rückschlüsse auf die Mainzer Verbin- H dungen zu. E Das Ergebnis war erschreckend. Auch auf den zweiten Blick läßt sich zeigen, R daß bei so gut wie allen Verbindungen und Dachverbänden ein Gedankengut – R insbesondere zur Frage des deutschen Volkstums – vorherrscht, daß vom Grau- S zonenbereich am rechten Rand der CDU bis hin zum offen neofaschistischen C Spektrum reicht. Zugehörige personelle Überschneidungen - nach ganz weit H rechts - lassen sich auch für Mainz nachweisen, und zwar auch in jüngster Zeit. A Neben der fruchtbaren Suche nach recht(sextrem)en Inhalten und Personen soll F auch angerissen werden, welche soziale Funktion Verbindungen in der BRD – T insbesondere als Stichwortgeber für bedeutende Parteien oder Lobbyverbände S haben. Z E Viel Spaß bei der Lektüre wünscht Euch, I T Hans A. Plast E N Inhalt 2 Einleitung 3 Die Geschichte