Handout Referat Vicus Vitudurum
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Map 19 Raetia Compiled by H
Map 19 Raetia Compiled by H. Bender, 1997 with the assistance of G. Moosbauer and M. Puhane Introduction The map covers the central Alps at their widest extent, spanning about 160 miles from Cambodunum to Verona. Almost all the notable rivers flow either to the north or east, to the Rhine and Danube respectively, or south to the Po. Only one river, the Aenus (Inn), crosses the entire region from south-west to north-east. A number of large lakes at the foot of the Alps on both its north and south sides played an important role in the development of trade. The climate varies considerably. It ranges from the Mediterranean and temperate to permafrost in the high Alps. On the north side the soil is relatively poor and stony, but in the plain of the R. Padus (Po) there is productive arable land. Under Roman rule, this part of the Alps was opened up by a few central routes, although large numbers of mountain tracks were already in use. The rich mineral and salt deposits, which in prehistoric times had played a major role, became less vital in the Roman period since these resources could now be imported from elsewhere. From a very early stage, however, the Romans showed interest in the high-grade iron from Noricum as well as in Tauern gold; they also appreciated wine and cheese from Raetia, and exploited the timber trade. Ancient geographical sources for the region reflect a growing degree of knowledge, which improves as the Romans advance and consolidate their hold in the north. -

The Roman Antiquities of Switzerland
Archaeological Journal ISSN: 0066-5983 (Print) 2373-2288 (Online) Journal homepage: http://www.tandfonline.com/loi/raij20 The Roman Antiquities of Switzerland By Bunnell Lewis M.A., F.S.A. To cite this article: By Bunnell Lewis M.A., F.S.A. (1885) The Roman Antiquities of Switzerland, Archaeological Journal, 42:1, 171-214, DOI: 10.1080/00665983.1885.10852174 To link to this article: http://dx.doi.org/10.1080/00665983.1885.10852174 Published online: 15 Jul 2014. Submit your article to this journal View related articles Full Terms & Conditions of access and use can be found at http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=raij20 Download by: [University of California Santa Barbara] Date: 18 June 2016, At: 04:49 THE ROMAN ANTIQUITIES OF SWITZERLAND. By BUNNELL LEWIS, M.A., F.S.A. Many persons, well-informed in other respects, think that there are no Boman antiquities in Switzerland. This mistake results from various causes. Most people travel there to enjoy the scenery, and recruit their health. The Bomans have not left behind them in that country vast monuments of their power, like the temples, theatres and aqueducts, which in regions farther south are still to be seen ; but, speaking generally, we must be content with smaller objects stored in museums, sometimes unprovided with catalogues.1 Moreover, no English writer, as far as I know, has discussed this subject at any length; attention has been directed almost exclusively to pie-historic remains made known by Dr. Keller's book on Bfahlbauten (lake- dwellings), of which an excellent translation has been published.2 However, I hope to show that the classical antiquities of Switzerland, though inferior to those of some other countries, ought not to be passed over with contemptuous neglect, and that they deserve study quite as much as similar relics of the olden time in Britain, 1 A very good account of the Collections 2 Dr. -

Römisches Handwerk: Leder Und Bein
Römisches Handwerk: Leder und Bein Sabine Deschler-Erb Leder- und Beinhandwerk gehören zu den antiken Handwerkszweigen, die organische Rohmaterialien verarbeiteten: Auszählung nach Petrikovitz 1991, 133ff. in Deschler-Erb 2008 Nach schriftlichen Quellen die wichtigste Gruppe! Klimatische Voraussetzungen für organische Rohstoffe nördlich der Alpen W W W K K K Gletscherrückzug! Gletschervorstösse hoch Waldgrenze tiefer Seespiegel niedrig höher SPMV, S. 31 Römerzeit relativ mild Begünstigt Intensivierung des Landbaus und Haustierzucht sowie Import neuer Pflanzen wie Weinrebe, Walnuss, Kastanie, diverse Gemüse Verkohlte Knoblauchzehen aus einem Brandgrab (Beigabe) aus Augst Topographie: Einfluss auf Angebot an organischen Rohstoffen Starke Nutzung bis Übernutzung der natürlichen Ressourcen Hecken Äcker / Brachen Kräutergarten Gemüsegarten Wiesen / Weiden Obstgärten n=525 n=465 Deschler-Erb 2008 Der archäologische Ausgrabungsalltag: „Knochentrocken“ Organisches Handwerk nur indirekt nachweisbar aufgrund: • Befund (z.B. Öfen, Feuerstellen, Gruben) • Werkzeug Häufig ungelöste Frage: Was wurde verarbeitet und hergestellt? Grabung Kaiseraugst TOP-Haus 2001 Feuchtbodenerhaltung: Seltener Glücksfall in römischen Siedlungen, in der Schweiz aber relativ häufig Eschenz Oberwinterthur Vindonissa Cham SolothurnSursee Messen Yverdon Avenches Pomy Genf Archäobiologische Untersuchungen zu römischen Siedlungen auf dem Gebiet der heutigen Schweiz Botanische Analysen Tierknochenanalysen SPMV 2002 Vergleich schriftliche Quellen – röm. Fundstellen der Schweiz -

Zum Handwerk Der Vici in Der Nord- Und Ostschweiz : Ein Vorläufiger Überblick
Zum Handwerk der Vici in der Nord- und Ostschweiz : ein vorläufiger Überblick Autor(en): Doswald, Cornel Objekttyp: Article Zeitschrift: Jahresbericht / Gesellschaft Pro Vindonissa Band (Jahr): - (1993) PDF erstellt am: 05.10.2021 Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-280838 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch http://www.e-periodica.ch -

RÖMISCHE EPOCHE 1 Einleitung
© STARCH Einleitung 1 RÖMISCHE EPOCHE 1 Einleitung Die Spuren unserer römischen Vergangenheit sind zahlreich. Die sorg- fältig errichteten kalkvermörtelten Mauern von grossflächigen Gebäude- anlagen, Mosaikreste, Götterstatuetten, Münzen und die zahllosen Ton- scherben üben eine eigentümliche Faszination aus. Sie erinnern uns an eine Ferienreise in den Süden, an die berühmten Helden Asterix und Obelix oder an die sogenannten Sandalenfilme («Gladiator», «Ben Hur», «Cleopatra» usw.). Einige römische Ruinen konnten konserviert werden und sind dem Pu- blikum zugänglich. Sehr viel mehr bauliche Reste sind dem Bagger, bzw. Neubauten zum Opfer gefallen. Eine Erhaltung der römischen Bauwerke am Ort der Auffindung ist in einer so dicht bebauten Region wie bei- spielsweise der Kanton Zürich aus wirtschaftlichen Gründen nur in Aus- nahmefällen möglich. Da zudem der Kanton Zürich noch nicht über ein archäologisches Museum verfügt, können die neuen Resultate der Archä- Grundriss eines grösseren Gebäudes ologie nicht systematisch präsentiert werden. in Oberwinterthur ZH (Vitudurum), das Die Gegend der heutigen Nord- und Ostschweiz war zwar während der als Lagerhaus diente. Solche in Not- 500-jährigen römischen Herrschaft nicht von besonderer Bedeutung für grabungen freigelegte Ruinen müssen die geschichtliche Entwicklung der Epoche; die Tatsache, dass das Gebiet regelmässig Neubauten weichen. Kantonsarchäologie Zürich. mehrfach ein Grenzland darstellte, macht es aber in mancher Hinsicht in- teressant. Die zahlreichen archäologischen Quellen ermöglichen zudem eine approximative Darstellung des Alltags eines Frontinus aus Vitudurum oder einer Flavia aus Turicum. Den römischen Überresten wurde schon sehr früh Aufmerksamkeit ge- schenkt; zunächst eher aus praktischen Gründen, später aus (wissen- schaftlichem) Interesse: Im Frühmittelalter dienten halbzerfallene römi- sche Gebäude als Wind- und Wetterschutz und römische Objekte wurden wiederverwendet: Münzen und andere kleine Gegenstände wurden auf- gelesen und zur Zier, als Wertgegenstand oder als Amulett an den Gürtel gehängt. -

Rapperswil-Jona, Kempraten: Römische Schweiz(1231 Kb, PDF)
Römersiedlung Kempraten Meienbergstrasse Die Schweiz in römischer Zeit Das Gebiet der heutigen Spätestens seit dem achten vorchristlichen Jahrhundert wurden weite Teile der Schweiz und des angrenzenden heutigen Schweiz von Kelten bewohnt, einem Volk, das sich aus zahlreichen Auslandes im 1. Jh. v.Chr. Lingonen Germanien Rhein Stämmen zusammensetzte. In der Mitte des 1. Jahrhunderts v.Chr. beschlossen die Seine Donau Helvetier, die grösste in der Schweiz ansässige Volksgruppe, auszuwandern. Sie zogen gemeinsam mit einigen kleineren Stämmen nach Westen in das Gebiet des HaeduerGallien heutigen Frankreich, das ebenfalls von Kelten besiedelt war. Die Römer nannten Rauraker dieses Gebiet Gallien. Der römische Feldherr Gaius lulius Caesar, der schon seit längerer Zeit die Absicht hatte, den Herrschaftsbereich Roms nach Norden Sequaner Helvetier auszudehnen, nahm den Aufbruch der Helvetier zum Anlass für seine berühmt Bibracte 58 v. Chr. gewordenen gallischen Feldzüge. Im Jahre 58 v.Chr. wurden die Auswanderer von Tiguriner Raetien den römischen Legionen bei Bibracte im französischen Burgund vernichtend Nantuaten Uberer Saone Loire Allobroger geschlagen. Caesar zwang die Helvetier und ihre Verbündeten, in ihre alten Seduner Veragrer Siedlungsgebiete zurückzukehren. Innerhalb weniger Jahre eroberte er ganz Gallien Lepontier und begründete damit die jahrhundertelange Herrschaft der Römer im Gebiet nördlich der Alpen. Rhone Po Arverner Die Jahrzehnte um Christi Geburt waren durch eine starke römische Truppenpräsenz in den eroberten Gebieten geprägt. Neben neuen politischen Organisationsformen Römische Provinzen brachten die Soldaten auch andere Elemente der römischen Kultur in die Provinzen. Auszug und Rückkehr der Helvetier 58 v. Chr. So wurden zum Beispiel neue Bautechniken mit Stein und Ziegeln eingeführt. Es Aufmarschroute der römischen Legionen unter Julius Caesar entstanden die ersten grossen Tempel und man errichtete grosse öffentliche Badeanlagen. -

Eine Schatztruhe Namens Vicus Kempraten
schwerpunkt› Vicus Kempraten Eine Schatztruhe namens Vicus Kempraten In den Medien kehren sie seit Jahren in regelmässigen Abständen wieder, die Meldungen über neue römische Funde in Kempraten. 2018 stiess die Kantonsarchäologie nun erstmals auf Grabstätten. Es ist ein weiteres Puzzleteil zum ‹Bild der römischen Kleinstadt, die sich einst hier befand. › Eine Säule und einige Grundmauern in ei- Parzellen an der Fluhstrasse in Angriff, bei fleissig weitergegraben hat und neue bedeu- ner Rasenfläche – mehr ist nicht zu sehen denen erstmals eine grössere Fläche – rund tende Funde gemacht wurden, hat sich an im archäologischen Park an der Meienberg- 1100 Quadratmeter – nach modernen Stan- dieser grundlegenden Interpretation nichts strasse, hinter der «Krone» Kempraten. Und dards untersucht wurde (siehe Artikel Seite geändert. Und auch nicht an der Bezeichnung doch spricht dieser Ort Bände für eine histo- 46). Die Auswertung nahm mehrere Jahre «Vicus», die für eine bestimmte römische rische Epoche, die für Rapperswil-Jona von in Anspruch und brachte wichtige neue Er- Siedlungsform steht (siehe Kasten Seite 42) zentraler Bedeutung war. Hier befand sich kenntnisse, zum Beispiel über die Siedlungs- und anders als beispielsweise in Solothurn vor bald zwei Jahrtausenden das Forum – dauer. Gegründet um zirka 35 bis 40 n. Chr., für Kempraten nicht inschriftlich belegt ist. das wirtschaftliche und politische Zentrum – hatte der Vicus bis mindestens zur Wende Allerdings wurde 2009 auf der Seewiese das einer römischen Siedlung am oberen Ende vom 4. zum 5. Jahrhundert Bestand. Auch Fragment einer Inschrift gefunden, auf dem des Zürichsees. die Siedlungsfläche, schlossen die Archäolo- «Vica» zu lesen ist. «Das könnte ein Teil des ginnen und Archäologen, war grösser als zu- Wortes ‹Vicani› sein, was Einwohner eines Vi- Grösser als zunächst angenommen vor angenommen, sie dürfte mindestens elf cus bedeuten würde.» Die Kantonsarchäologie spricht vom Vicus Hektaren betragen haben. -
Info-Blatt 2014/1
IINFO-BLATT 20201144/1/1 JanuarJanuar 20 201414 EditorialEditorial LiebeLiebe Vereinsmitglieder Der Quartierverein feierte letztes Jahr sein 50. Jubiläum. Solch runde Geburtstage bieten die Gelegenheit, zurück Der Quartierverein feierte letztes Jahr sein 50. Jubiläum. Solch runde Geburtstage bieten die Gelegenheit, zurück zuzu schauen,schauen, sich auf seine GeschichteGeschichte zuzu besinnenbesinnen und und sich sich mit mit ihr ihr auseinander auseinander zu zu setzen. setzen. Wir Wir durften durften festste feststel- l- Der Vorstand 2014 des Quartiervereins Lenggis-Kempraten vlnr: len,len, dassdass dies Ihnen, liebeliebe LeserinnenLeserinnen undund Leser,Leser, ein ein Bedürfnis Bedürfnis ist. ist. So So konnte konnte Robert Robert Helbling Helbling in in seinen seinen drei drei R e-Re- Fridolin Gysel, Barbara Klarer, Reto Schwendimann, Patricia Bucher, Der Vorstand 2014 des Quartiervereins Lenggis-Kempraten vlnr: feratenferaten zurzur weltlichen undund kirchlichenkirchlichen GeschichteGeschichte Kempratens Kempratens von von Anfang Anfang bis bis Mitte Mitte des des 20 20 Jahrhun Jahrhundertsderts jeweils jeweils FridolinSandraDer Vorstand JäGysel,ger, Horst Barbara2014 Bodenmanndes Klarer Quartiervereins, Reto Schwendimann Lenggis-Kempraten, Patricia Bucher vlnr: , Der Vorstand 2014 des Quartiervereins Lenggis-Kempraten vlnr: vieleviele interessierte Quartierbewohnerinnen undund ––bewohnerbewohner begrüssen. begrüssen. SandraFridolin Jä Gysel,ger, Horst Barbara Bodenmann Klarer, Reto Schwendimann, Patricia Bucher, Fridolin Gysel, Barbara Klarer, Reto Schwendimann, Patricia Bucher, Sandra Jäger, Horst Bodenmann Sandra Jäger, Horst Bodenmann EbensoEbenso ziehen die Veranstaltungen „auf„auf denden Spuren Spuren der der Römer Römer durch durch Kempraten“ Kempraten“ jeweils jeweils ein ein grosses grosses Publikum Publikum an, was nicht weiter erstaunt. Die römische Siedlung Kempraten entstand um das Jahr 40 n. Chr. Im ehemaligen an, was nicht weiter erstaunt. Die römische Siedlung Kempraten entstand um das Jahr 40 n. -

CLSL 38 Ireland and Its Contacts Print
Ireland and its Contacts L’Irlande et ses contacts Cahiers de l'ILSL No 38 L'édition des actes de ce colloque a été rendue possible grâce à l'aide financière des organismes suivants : Faculté des lettres de l'Université de Lausanne Institut de Linguistique et des Sciences du Langage Cahier de l‘ILSL, No 38, 2013 Ont déjà paru dans cette série : Cahiers de l'ILSL L'Ecole de Prague : l'apport épistémologique (1994, n° 5) Fondements de la recherche linguistique : perspectives épistémologiques (1996, n° 6) Formes linguistiques et dynamiques interactionnelles (1995, n° 7) Langues et nations en Europe centrale et orientale (1996, n° 8) Jakobson entre l'Est et l'Ouest, 1915-1939 (1997, n° 9) Le travail du chercheur sur le terrain (1998, n° 10) Mélanges en hommage à M.Mahmoudian (1999, n° 11) Le paradoxe du sujet : les propositions impersonnelles dans les langues slaves et romanes (2000, n° 12) Descriptions grammaticales et enseignement de la grammaire en français langue étrangère (2002, n° 13) Le discours sur la langue en URSS à l'époque stalinienne (2003, n° 14) Pratiques et représentations linguistiques au Niger (2004, n° 15) Le discours sur la langue sous les pouvoirs autoritaires (2004, n° 17) Le slipping dans les langues médiévales (2005, n° 18) Travaux de linguistique. Claude Sandoz (2005, n° 19) Un paradigme perdu : la linguistique marriste (2005, n° 20) La belle et la bête : jugements esthétiques en Suisse romande et alémanique sur les langues (2006, n° 21) Etudes linguistiques kabyles (2007, n° 22) Langues en contexte et en contact (2007, n° 23) Langage et pensée : Union Soviétique, années 1920-30 (2008, n° 24) Structure de la proposition (histoire d'un métalangage) (2008, n° 25) Discours sur les langues et rêves identitaires (2009, n° 26) Langue et littératures pour l'enseignement du français en Suisse romande: problèmes et perspectives (2010, n° 27) Barrières linguistiques en contexte médical (2010, n° 28) Russie, linguistique et philosophie (2011, n° 29) Plurilinguismes et construction des savoirs (2011, n° 30) Langue(s). -
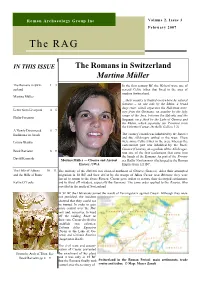
RAG Vol 2 Issue 3
Roman Archaeology Group Inc Volume 2, Issue 3 February 2007 The RAG IN THIS ISSUE The Romans in Switzerland Martina Müller The Romans in Swit- 1—3 In the first century BC the Helvetii were one of zerland several Celtic tribes that lived in the area of modern Switzerland. Martina Müller ... their country is limited everywhere by natural features – on one side by the Rhine, a broad deep river, which separates the Helvetian terri- Letter from Liverpool 4—5 tory from the Germans; on another by the lofty range of the Jura, between the Helvetii and the Philip Freeman Sequani; on a third by the Lake of Geneva and the Rhône, which separates our Province from the Helvetii.(Caesar, De Bello Gallico 1.2) A Newly Discovered 6—7 Bathhouse in Jarash The country’s north was inhabited by the Raurici and the Allobroges settled in the west. There Louise Blanke were more Celtic tribes in the area, whereas the easternmost part was inhabited by the Raeti. Genava (Geneva), an oppidum of the Allobroges, Book Reviews 8—9 was one of the first settlements that came into the hands of the Romans. As part of the Provin- David Kennedy Martina Müller — Classics and Ancient cia Gallia Narbonensis it belonged to the Roman History, UWA Empire from 121 BC. The Hills of Athens 10—11 The territory of the Helvetii was situated northeast of Genava (Geneva). After their attempted and the Hills of Rome migration in 58 BC and their defeat by the troops of Julius Caesar near Bibracte they were forced to return to the Swiss Plateau. -

Aberystwyth University Dictionary of Continental Celtic Place-Names
Aberystwyth University Dictionary of Continental Celtic Place-Names Falileyev, Alexander; Gohil, Ashwin E.; Ward, Naomi; Briggs, Keith Publication date: 2010 Citation for published version (APA): Falileyev, A., Gohil, A. E., Ward, N., & Briggs, K. (2010). Dictionary of Continental Celtic Place-Names: A Celtic Companion to the Barrington Atlas of the Greek and Roman World. CMCS Publications. http://hdl.handle.net/2160/10148 General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the Aberystwyth Research Portal (the Institutional Repository) are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. • Users may download and print one copy of any publication from the Aberystwyth Research Portal for the purpose of private study or research. • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain • You may freely distribute the URL identifying the publication in the Aberystwyth Research Portal Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. tel: +44 1970 62 2400 email: [email protected] Download date: 02. Oct. 2021 Abalus Ins.? Reudigni? Lugdunum Matilo Aurelium Cananefatium Kaloukones? Rhenus fl.? Lugii? 52 Helinium? Levefanum Helinium fl.? Carvo Carvium Mosa fl.? Batavodurum Noviomagus Salas fl.? Ganuenta -

The Mithraeum at Kempraten (Ch) – Preliminary Results from a New Discovery in 2015/16
Acta Ant. Hung. 58, 2018, 199–215 DOI: 10.1556/068.2018.58.1–4.12 SARAH LO RUSSO – REGULA ACKERMANN – HANNES FLÜCK WITH A CONTRIBUTION BY MARKUS PETER THE MITHRAEUM AT KEMPRATEN (CH) – PRELIMINARY RESULTS FROM A NEW DISCOVERY IN 2015/16 Summary: During rescue excavations carried out near the vicus at Kempraten (municipality of Rappers- wil-Jona, St. Gallen, Switzerland) in advance of a private construction project, a Mithraeum measuring approximately 8 by 10 m was unexpectedly discovered in the summer of 2015 and subsequently exca- vated and investigated in detail. This paper presents the preliminary results of the excavation, which was completed less than a year ago, and pays particular attention to the interdisciplinary approach used in the excavation. These included intense sampling of the features for the purposes of micromorphology and archaeobiology. Three construction phases with intermittent conflagrations were identified. The question as to whether there was an ante-chamber remains unanswered. The external areas are also quite difficult to interpret, at least for the time being. The rich assemblage of finds, which included numerous coins, pottery, animal bones and a range of religious artefacts (e.g. altars and a half relief), will only be dealt with in a cursory manner here. According to the range of coins, the Mithraeum undoubtedly dated from the late 3rd to the late 4th or early 5th centuries. The site will be analysed by an interdisciplinary team and pre- liminary work is already underway. Key words: Switzerland, Germania superior, excavation methods, sampling strategy, vicus, Mithraeum, archaeological science, archaeology, Roman Imperial period, cult, religion 1.