Japan – Bericht Zur Hauptexkursion 2013 Japan – Report of the Main Excursion 2013
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Hilfsangebote Für Menschen in Zeiten Der Corona-Krise
Hilfsangebote für Menschen in Zeiten der Corona-Krise Träger/Institution Stadtteil Projektbeschreibung Ansprechpartner Telefon und E-Mail AGAPLESION MARKUS DIAKONIE „Nachbarn sind wir ALLE“ Tel. 069 60906-822 Quartiersmanagement Hilfe-Suchende und Hilfe-Anbie- Email: info.na- tende! [email protected] ASB Regionalverband Frankfurt am Main Botendienst, um die Arztpra- Tel.069-31407244, Tel: 069-314072-0 xen, Apotheken und ggf. Kran- Email: [email protected] kenhäuser zu entlasten. Freiwilligenagentur im Bürgerinstitut e.V. Westend Koordination/Vermittlung von Michael Beckmann, Bet- Tel. 069 97201730/31 aktuellen Unterstützungsbedar- tina Büttner Email: freiwilligenagentur@buergerin- fen stitut.de Ev. Kirchengemeinde Nieder-Eschbach Nieder-Eschbach Einkäufe organisieren Pfrn. Brigitte Meinecke Tel. 069 5074061, Tel. 069 50698737 Ev. Lydiagemeinde Praunheim / Hausen Seelsorge Pfrn. Katja Föhrenbach Tel. 069 76752528 Quartiersmanagement Praunheim Praunheim Einkaufshilfe, Anlaufstelle bei Tel. 069 - 29826277 Gesprächsbedarf Ev. Emmausgemeinde (Eschersheim) Eschersheim Telefon-Seelsorge, Einkaufen, Pfrn. Elke Jung, Pfrn. Chris- Tel. 069 525648, Tel. 069 95155556 Botengänge tiane Rauch Ev. Andreasgemeinde (Eschersheim) Eschersheim Telefonseelsorge sowie Ver- Pfrn. Sabine Fröhlich Tel. 069 50682605 mittlung von Hilfen für Einkäufe und Botengänge Ev. Dreifaltigkeitsgemeinde (Kuhwaldsied- Kuhwaldsiedlung/ Einkaufshilfe, Botengänge, Pfr. Tobias Völger, Tel. 069 71670828 lung und Europaviertel) Europaviertel Fahrdienste, in kleinem Umfang Email: [email protected] Kinderbetreuung Ev. Wartburggemeinde (Bornheim) Bornheim Nachbarschaftshilfe Pfr. Thomas Diemer Tel. 069 - 945 925 46 Email: pfarramt@wartburggemeinde- frankfurt.de Ev. Kirchengemeinde Riedberg Riedberg Seelsorge und Hilfe beim Ein- Pfrn. Kirsten Emmerich Tel. 069 - 95 10 90 54 kauf Email: [email protected] 1 Hilfsangebote für Menschen in Zeiten der Corona-Krise Ev.-Luth. St. Nicolai-Gemeinde (Ostend) Ostend Seelsorge nicht nur in Krisenzei- Pfr. -
Wiener Spaziergänge Walks in Vienna
Wiener Spaziergänge Walks in Vienna 07 - 08 / 2020 Führungen / Guided Tours www.wienguide.at seit / since 1988 www.wien.info #ViennaNow www.wien.info Die Wiener Spaziergänge Wir sind eine dynamische und pro- Gutscheine & Abos fessionell arbeitende Gruppe von staatlich geprüften Fremdenführern, Gutscheine für Führungen und die sich darauf spezialisiert haben, Abo für die Zusendung des neue Wege im Städtetourismus Monatsprogramms per Post zu gehen. Zusätzlich zu den tradi- (EUR 15,– jährlich) oder der tionellen Stadtrundfahrten bieten elektronische Versand unseres wir das ganze Jahr über ein exklusives Programms: Programm von themenbezogenen Stadtrundgängen an. Sie erkennen Bestellung uns an dem offiziellen roten AUSTRIA Tel +43 (0) 1 774 89 01 GUIDE Abzeichen. [email protected] • Treffpunkt wie bei Führung angegeben Preise / Prices • Führungen finden bei jedem Preis (exklusive eventu- Wetter statt eller Eintrittspreise) € 18,- • Keine Reservierung nötig, außer Price of tour (exclusive of für Gruppen admission fees) € 18,- WIEN-Karte / VIENNA Card € 16,- • Führungsdauer, wenn nicht Kinder bis 14 / under 14s € 9,- anders angegeben: 1 1/2 bis 2 Stunden Bezahlung direkt beim Guide / • Mindestteilnehmerzahl: 3 voll You pay directly to the guide zahlende Personen • Teilnahme auf eigene Gefahr Privatführungen und • Tonband- und Videoaufzeich- nungen nur nach vorheriger Stadtrundfahrten Absprache Ob für Einzelreisende, Reisegruppen oder Ihr Firmenevent – wir haben das passende Angebot! Auskünfte & Information Bei über 300 Tourenvorschlägen Tel +43 664/260 43 88 finden Sie auf unserer Internetseite www.wienguide.at bestimmt das [email protected] Richtige. www.wienguide.at oder zuständiger Guide Unsere freundlichen und kompe- tenten Fremdenführer freuen sich Diesen Prospekt erhalten auf Ihren Besuch! Privatführungen werden für 1–999 Gäste durchge- Sie bei: führt. -

Frank Lloyd Wright,Fuji, and Fun!
, Frank Lloyd Wright Fuji, and Fun! - THE BEST OF JAPAN 12 Days from $5,699 air & land (4) Tokyo • (1) Fuji Area • (5) Kyoto CHINA JAPAN 4 Tokyo 1 5 Kyoto Fuji Area Tokyo Day 1 Depart USA Today you begin an amazing cultural adventure TOUR FEATURES as you depart the USA on your international flight to Japan. •ROUND TRIP AIR TRANSPORTATION - Air transportation Day 2 Arrive Tokyo, Japan Upon arrival at Narita Airport, you will from Minneapolis, MN be met by your Aventura World tour director and depart to your hotel •FIRST-CLASS ACCOMMODATIONS - First class centrally-located in Tokyo for check-in. Tokyo welcomes you from its ultramodern hotel accommodations for 10 nights skyscrapers and neon-clad edifices to its time-honored temples that •SUPERB CUISINE - 16 included meals consisting of 10 buffet share the old world history and mystique of this fascinating land. A breakfasts, 3 lunches and 3 dinners feast for the senses from exquisite dining, to spiritual temples and •SIGHTSEEING TOUR PROGRAM - Sightseeing, including local shrines, to fascinating museums and architectural gems, your time guide and all entrance fees as per day-to-day itinerary in Japan will be unforgettable every step of the way. This evening we •CULTURAL DISCOVERY SERIES - Our program encompasses will share in a splendid welcome dinner at our hotel restaurant. (D) cultural connections, in-depth learning of the local economy, Day 3 Tokyo Rise and shine with an included breakfast before social systems and interaction with locals such as the heading out for a day of adventuring in Tokyo. Visit Tsukiji Outer Japanese tea ceremony, Chanko Nabe Dinner, Onsen (Spa) Market, situated adjacent to the world’s largest wholesale fish and visit, Miho Museum visit, JR Shinkansen bullet train ride seafood market, where you will experience more than 400 outlets and more in this shopping area that dates back to the Taisho period (1912– •FRANK LLYOD WRIGHT PROGRAM - Visits to Jiyu Gakuen 26). -

Meet "Maiko" in Gion and Kyoto One Day Bus Tour Includes Round Trip Bus Fares, Lunch, Keihan Train Tickets, and Hankyuu Train Tickets
No.12 : November 2020 ~ December 2021 1009 Meet "Maiko" in Gion and Kyoto One Day Bus Tour Includes round trip bus fares, lunch, Keihan Train tickets, and Hankyuu Train tickets. N ※Any additional cost would be at your own expense. O ※Meeting time is 8:20 at Umeda, 8:25 at Nippombashi, 8:50 at Namba, and 9:05 at Kyoto station. T ※Bus will leave according to the schedule, and will not wait for late arrivals. I C ※Smoking is not allowed in the bus. Thank you for your cooperation. E ※Itinerary is subject to change depending on the weather, traffic conditions, etc. ※We recommend you to wear a comfortable shoes since this tour has a long walk in Gion area. Detailed Itinerary Umeda Nippombashi Namba Kyoto Hearton Hotel Nishi-Umeda 1F Lobby → In front of Tsurutontan restaurant → Namba OCAT 1F JR Kyoto station 8:20 Meet 8:30 Dep. 8:25 Meet 8:35 Dep. 8:50 Meet 9:00 Dep. 9:05 Meet 9:15 Dep. Keihan Train Meet Maiko , Lunch ( Chanko Nabe ) Fushimi Inari Taisha → Fushimi-Inari to Gion-Shijo → Gion ( Hanamikoji & Yasaka Shrine ) 10:00 ~ 11:00 11:17 Dep. 11:24 Arr. 11:35 ~ 14:50 Hankyuu Train Arashiyama Namba Nippombashi Umeda Kyoto Station Kawaramachi to Arashiyama → → → → 14:50 Dep. 15:07Arr. 15:10 ~ 16:50 18:30 ETA 18:45 ETA 19:15 ETA 17:40 ETA Meet Maiko Activity detail Maiko Performance Maiko Questionaire Corner Picture with Maiko Ozashiki Asobi Experience → → → 13:10 ~ 13:20 (10Mins) 13:20 ~ 13:35 (15Mins) 13:35 ~ 13:50 (15Mins) 13:50 ~ 14:10 (20Mins) ※Customers depart from Kyoto station will travel to Inari station by JR train with our Tour Guide. -

Degussa-Areal Taunusturm/Bankenviertel
1 Innenstadtkonzept 2 Dom-Römer-Areal 3 Degussa-Areal 4 Taunusturm/Bankenviertel 5 Stadtumbau Bahnhofsviertel 6 Campus Westend 7 Senckenberganlage/Bockenheimer Warte 9 Europaviertel/Messeerweiterung Rahmenplan für die Entwicklung der Innenstadt Neubebauung eines kleinteiligen Altstadtquartiers nach Zukünftiges „MainTor-Quartier“ wird im Zuge der Stadträumliche Verdichtung und Bündelung von Hoch- Neues Wohnen & Entwicklung einer Campus-Universität „im Park“ Wandel des ehemaligen Universitätsquartiers zum Immenses Potential für die Innenentwicklung dem Abriss des Technisches Rathauses Neubebauung öffentlich zugänglich und aufgewertet häusern im traditionellen Bankenviertel Leben im Bahnhofsviertel urbanen „Kultur Campus Bockenheim“ Zukünftiger Boulevard Berliner Straße, Perspektive: Büro raumwerk Städtebauliches Modell des Dom-Römerberg-Areals Panorama „MainTor-Quartier“ (KSP Architekten) © DIC Projektentwicklung GmbH & Co.KG Taunusturm (Bildmitte) von der Neuen Mainzer Straße © Gruber + Kleine-Kraneburg Architekten „1000 Balkone“ auf den Hofseiten der Gebäude: Idee des Büros bb22 Blick auf den zentralen Campusplatz und das neue Hörsaalgebäude Modell zur überarbeiteten Rahmenplanung Sommer 2010, Entwurf: K9 Architekten Blick in das Areal „Helenenhöfe“, Visualisierung: aurealis Real Estate GmbH& Co.KG Planungsanlass: Die Frankfurter Innenstadt ist Wohn- und Arbeitsort und Planungsanlass: Nach Abriss des Technischen Rathauses soll das Areal Planungsanlass: Die als Deutsche Gold- und Silber-Scheide-Anstalt Planungsanlass: Der geplante Taunusturm -

Les Hanamachi
Les hanamachi Des quartiers « réservés » La ville de Kyôto comporte cinq hanamachi ( 花 街 , villes fleurs) où vivent les geisha et que l'on appelle ensemble Gokagai ( 五 花 街 ). Le plus célèbre d'entre eux est Gion- kobu ( 祇 園 甲 部 ), suivi de Ponto-chô ( 先 斗 町 ) et Kamishichiken (上七軒). Viennent ensuite Gion-higashi (祇 園 東 ) et Miyagawa-chô ( 宮 川 町 ). On y ajoute parfois l'ancien quartier réservé de Shimabara (嶋原), actuellement inactif. Ces quartiers comptent encore de nos jours un peu moins de 200 ochaya qui emploient environ 250 geiko et maiko. Les hanamachi ont chacun un blason appelé mon ( 紋 ), ou kamon (家紋), de même que les okiya. On peut les voir sur les lanternes ou les noren ( 暖 簾 , rideaux d'enseigne) des bâtiments des hanamachi. Les geisha aussi arborent ces blasons par L'ochaya Ichiriki お茶屋一力 exemple sur le col de leur kimono, celles qui sont indépendantes en ayant un qui leur est propre. On y parle le kyo-kotoba ( 京 言 葉 ), dialecte de Kyôto, que les nouvelles arrivées se doivent d'apprendre si elles ne le connaissent pas. Mon des hanamachi Gion Les quartiers de Gion se situent près du sanctuaire Yasaka-jinja (八坂神社). Les mon de Gion sont symbolisés par une couronne de dango ( 団 子 , boulettes de riz). Celui de Gion-kobu se différencie par son initiale ko (甲), au centre. Les premières ochaya de Gion apparurent en 1665. Le quartier connu son âge d'or pendant la première moitié du XIXe siècle. Plus de trois mille geisha travaillaient dans les quelques sept cents ochaya. -

Japón - Resumen 1
JAPÓN - RESUMEN 1 Consejos - Los españoles no necesitamos visado, solo un pasaporte en vigor y podremos permanecer en el país con el visado de turista durante 90 días. - Hay que descalzarse para entrar en muchos sitios. - Exageradamente puntuales. - No se puede fumar en la calle, pero sí en muchos restaurantes. - La mayoría de las tapas de alcantarillas de Japón ("manhoru") están decoradas con trabajos artísticos que reflejan el atractivo de la ciudad donde están, algún monumento, festival o sus costumbres. Cada vez hay más personas que coleccionan fotos de éste fenómeno. - Los coches no pueden aparcar en las aceras. Deben hacerlo en parkings o dentro de los edificios. - En los hoteles y apartamentos suelen dejar los paraguas gratis. - No hay papeleras por la calle, pero está todo muy limpio. - Baños: o Hay baños por todas partes y están todos (o casi) impecables. o NO tocar el botón rojo: es para llamadas de emergencia. A veces pone “SOS” pero otras solo pone kanji en japonés. o En los bares no suele haber servilletas y en los baños a veces no hay papel. - Las escuelas llevan a los niños a sitios turísticos donde poder practicar el inglés con los turistas. Te hacen preguntas muy básicas y no te entretienen mucho, después te piden si pueden escribirte por correo, te regalan una grulla de Origami y se hacen una foto contigo. - En las escaleras mecánicas y por la acera, ir siempre por la izquierda, para dejar la derecha libre a aquellos que quieran desplazarse más rápido. En los peldaños comunes, subir por donde indiquen las flechas, normalmente por la izquierda también. -
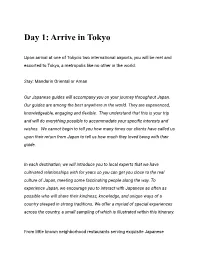
Scott Gilman T+L A-List Sample Itinerary 2021
Day 1: Arrive in Tokyo Upon arrival at one of Tokyo’s two international airports, you will be met and escorted to Tokyo, a metropolis like no other in the world. Stay: Mandarin Oriental or Aman Our Japanese guides will accompany you on your journey throughout Japan. Our guides are among the best anywhere in the world. They are experienced, knowledgeable, engaging and flexible. They understand that this is your trip and will do everything possible to accommodate your specific interests and wishes. We cannot begin to tell you how many times our clients have called us upon their return from Japan to tell us how much they loved being with their guide. In each destination, we will introduce you to local experts that we have cultivated relationships with for years so you can get you close to the real culture of Japan, meeting some fascinating people along the way. To experience Japan, we encourage you to interact with Japanese as often as possible who will share their kindness, knowledge, and unique ways of a country steeped in strong traditions. We offer a myriad of special experiences across the country, a small sampling of which is illustrated within this itinerary. From little known neighborhood restaurants serving exquisite Japanese cuisine, to world-renowned French and Italian restaurants, Japan offers the finest selection of indigenous and international dining experiences in the world. Access to the smaller, quintessential local restaurants — which often serve the finest Japanese food and sake — is often difficult (if not impossible) unless one speaks Japanese. Our wealth of experience in Japan however has provided us with a network of restaurants, where chefs will treat our customers as if they are regular clientele — thereby allowing you to experience Japanese cuisine at its finest. -

Hilfsangebote Für Menschen Nicht Nur in Zeiten Der Corona-Krise
Hilfsangebote für Menschen nicht nur in Zeiten der Corona-Krise Träger/Institution Projektbeschreibung Ansprechpartner Telefon und E-Mail AGAPLESION MARKUS „Nachbarn sind wir ALLE“ Tel. 069 60906-822 DIAKONIE Hilfe-Suchende und Hilfe-Anbietende! Email: [email protected] Quartiersmanagement Braucht Ihr Hilfe in diesen schwierigen Zeiten bei Einkäufen, anderen Besorgungen, mit dem Hund Gassi gehen, bei der Kinderbetreuung…? ASB Regionalverband Botendienst, um die Arztpraxen, Apotheken und Tel.069-31407244, Tel: 069-314072-0 Frankfurt am Main ggf. Krankenhäuser zu entlasten. Email: [email protected] Freiwilligenagentur im Koordination/Vermittlung von aktuellen Unterstüt- Michael Beckmann, Bet- Tel. 069 97201730/31 Bürgerinstitut e.V. zungsbedarfen in sozialen Einrichtungen und Unter- tina Büttner Email: [email protected] stützungsangeboten von Privatpersonen und/oder Unternehmen. Evang. Kirchengemeinde Einkäufe organisieren Pfrn. Brigitte Meinecke Tel. 069 5074061, Tel. 069 50698737 Nieder-Eschbach Evang. Lydiagemeinde Seelsorge Pfrn. Katja Föhrenbach Tel. 069 76752528 (Praunheim / Hausen) Quartiersmanagement Einkaufshilfe, Anlaufstelle bei Gesprächsbedarf Tel. 069 - 29826277 Praunheim Evang. Emmausge- Telefon-Seelsorge, Einkaufen, Botengänge Pfrn. Elke Jung, Pfrn. Tel. 069 525648, Tel. 069 95155556 meinde (Eschersheim) Christiane Rauch Evang. Andreasge- Telefonseelsorge sowie Vermittlung von Hilfen für Pfrn. Sabine Fröhlich Tel. 069 50682605 meinde (Eschersheim) Einkäufe und Botengänge Evang. Dreifaltigkeitsge- -

Frankfurter Sozialbericht
REIHE SOZIALES UND JUGEND | 41 Wir bieten Hilfe an. FRANKFURTER SOZIALBERICHT TEIL X: FAMILIEN IN FRANKFURT AM MAIN – LEBENSWIRKLICHKEIT UND UNTERSTÜTZUNGSBEDARFE Ergebnisse einer empirischen Erhebung unter Frankfurter Müttern und Vätern mit minderjährigen Kindern Dezernat für Soziales, Senioren, Jugend und Recht FRANKFURTER SOZIALBERICHT TEIL X: FAMILIEN IN FRANKFURT AM MAIN – LEBENSWIRKLICHKEIT UND UNTERSTÜTZUNGSBEDARFE Verfasser/-innen: Pia Bolz Dr. Herbert Jacobs Nicole Lubinski Wissenschaftliche Begleitung: Prof. Dr. Diether Döring Europäische Akademie der Arbeit in der Universität Frankfurt am Main Reiner Höft-Dzemski Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e. V., Berlin Mitglieder des Beirats der Sozialberichterstattung: Karl-Heinz Huth Agentur für Arbeit Frankfurt am Main Dr. Jürgen Richter Arbeiterwohlfahrt, Kreisverband Frankfurt am Main e.V. Petra Becher Bürgerinstitut e.V. Hartmut Fritz Caritasverband Frankfurt e.V. Michael Zimmermann-Freitag Der PARITÄTISCHE Hessen, Regionalgeschäftsstelle Ffm Horst Koch-Panzner DGB, Kreis Frankfurt am Main Pfarrer Dr. Michael Frase Diakonisches Werk Frankfurt am Main Prof. Dr. Gero Lipsmeier Fachhochschule Frankfurt am Main, Fachbereich 4 Rebekka Rammé Frankfurter Jugendring Dr. Ralf Geruschkat Industrie- und Handelskammer Frankfurt am Main Iris Behr Institut Wohnen und Umwelt, Darmstadt Dezernat für Soziales, Senioren, Jugend und Recht Frankfurt am Main, 2014 3 VORWORT 4 FRANKFURTER SOZIALBERICHT, TEIL X – FAMILIEN IN FRANKFURT AM MAIN 5 den vorliegenden Bericht eine umfangreiche -
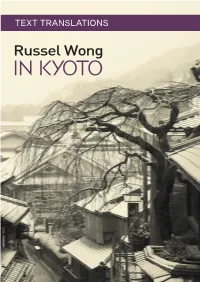
Text Translations 1 5 6 7
TEXT TRANSLATIONS 1 5 6 7 4 3 1 2 PLAN OF THE GALLERY LIFE IN EDO X RUSSEL WONG IN KYOTO 1 Russel Wong in Kyoto Japan, particularly Kyoto, has always drawn and inspired local and international photographers. Russel Wong’s interest in photographing Kyoto and its geisha community began during a visit to Tokyo in 2005 to shoot publicity photographs for Watanabe Ken when he was starring in Memoirs of a Geisha (2005). Kyoto came up during their conversation and this rekindled Wong’s passion to dig deeper. The film received mixed reviews; mostly disapproval and disdain from the geisha community in Kyoto. Despite its controversies, the film has contributed in recent years to public perceptions of and curiosity about Japanese geisha (Kyoto dialect, geiko). Wong feels that perhaps his photographs can give the geiko community – which hardly speaks and is seldom seen – a voice for an international audience. Geiko community The geiko community in Kyoto is a closed group and the traditional system of ichigen- san okotowari, “turning away first-timers” still rules in most teahouses today. It took Wong five years to gain access to the geiko communities in all five kagai (geisha districts, also known as hanamachi) in Kyoto. Inspired by woodblock prints In making this body of work, Wong was inspired by Edo-period woodblock prints by Kitagawa Utamaro, Katsushika Hokusai, and Utagawa Hiroshige. He was particularly drawn to the compositions, how the elements of the image work together, and by the silhouettes and portraits of the women depicted in them. Wong’s photographs are infused with his own sense of nostalgia. -

Litteraturliste
LITTERATURLISTE „Aoyama Technical College“ in Architectural 1996, pp. 110-27. „From a Talk with Hiroshi Hara“ in Mitsumasa, Hara, H.: „Architecture and Individuality“ in Review 1136 okt. 1991, pp. 45-49. Choudhury, S. & Clavijo, C.: „Machiya. A Survey F. (Ed.): Architecture Riffle 006: Umeda Japan Architect 6/1966, pp. 87-107. „Aoyama Technical College“ in Japan Architect of Traditional Japanese Urban Houses“ in Sky Building Sky Building, Toto, Tokyo Hara, H.: „500Mx500Mx500M Cube“ in GA Ar- 2/1991, pp. 160-63. Japan Architect 1/1972, pp. 91-104. 1993. chitect 13: Hiroshi Hara, A.D.A. Edita, „Amusement Complex <H>“ in Japan Archi- Cooper, M. (overs. & Ed.): This Island of Ja- GA Architect 9: Shin Takamatsu, A.D.A. Edita, Tokyo 1990, pp. 240-43. tect 1/1994, pp. 170-73. pan. João Rodrigues’ Account of 16th- Tokyo 1990. Hara, H.: „On the ‘Drifting Space’ and the Ar- Bellini, M.: „Architecture and Cities“ in Japan century Japon, Kodansha International, GA Architect 13: Hiroshi Hara, A.D.A. Edita, chitectural Forms“ in Japan Architect Architect 3/1992, pp. 172-79 Tokyo & New York 1973. Tokyo 1990. 3/1993, pp. 26-31. Bellini, M.: „Tokyo Design Center“ in Japan Davies, C.: „Office Interiors“ in Davies, C. & Gion. Suina asobi no sekai, (Gion. Den ele- Hara, H.: „Extraterrestrial Architecture Project“ Architect 3/1992, pp. 180-91 Lambot I.: Century Tower, Ernst & Sohn, gante legeverden, ISBN4-473-01399-5) in GA Architect 13: Hiroshi Hara, A.D.A. Bognar, B.: „From Ritualistic Objects to Science Berlin 1992, pp. 141-59. Hakoosho, Kyoto 1995. Edita, Tokyo 1990, pp.