Der Bundesrat / 1949
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The GDR's Westpolitik and Everyday Anticommunism in West Germany
Philosophische Fakultät Dierk Hoffmann The GDR’s Westpolitik and everyday anticommunism in West Germany Suggested citation referring to the original publication: Asian Journal of German and European Studies 2 (2017) 11 DOI https://doi.org/10.1186/s40856-017-0022-5 ISSN (online) 2199-4579 Postprint archived at the Institutional Repository of the Potsdam University in: Postprints der Universität Potsdam Philosophische Reihe ; 167 ISSN 1866-8380 http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus4-435184 DOI https://doi.org/10.25932/publishup-43518 Hoffmann Asian Journal of German and European Studies (2017) 2:11 Asian Journal of German DOI 10.1186/s40856-017-0022-5 and European Studies CASE STUDY Open Access The GDR’s Westpolitik and everyday anticommunism in West Germany Dierk Hoffmann1,2 Correspondence: hoffmann@ifz- muenchen.de Abstract 1 Potsdam University, Berlin, ’ Germany West German anticommunism and the SED s Westarbeit were to some extent 2Institut fur Zeitgeschichte interrelated. From the beginning, each German state had attemted to stabilise its Munchen Berlin Abteilung, Berlin, own social system while trying to discredit its political opponent. The claim to Germany sole representation and the refusal to acknowledge each other delineated governmental action on both sides. Anticommunism in West Germany re-developed under the conditions of the Cold War, which allowed it to become virtually the reason of state and to serve as a tool for the exclusion of KPD supporters. In its turn, the SED branded the West German State as ‘revanchist’ and instrumentalised its anticommunism to persecute and eliminate opponents within the GDR. Both phenomena had an integrative and exclusionary element. -

Landeszentrale Für Politische Bildung Baden-Württemberg, Director: Lothar Frick 6Th Fully Revised Edition, Stuttgart 2008
BADEN-WÜRTTEMBERG A Portrait of the German Southwest 6th fully revised edition 2008 Publishing details Reinhold Weber and Iris Häuser (editors): Baden-Württemberg – A Portrait of the German Southwest, published by the Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg, Director: Lothar Frick 6th fully revised edition, Stuttgart 2008. Stafflenbergstraße 38 Co-authors: 70184 Stuttgart Hans-Georg Wehling www.lpb-bw.de Dorothea Urban Please send orders to: Konrad Pflug Fax: +49 (0)711 / 164099-77 Oliver Turecek [email protected] Editorial deadline: 1 July, 2008 Design: Studio für Mediendesign, Rottenburg am Neckar, Many thanks to: www.8421medien.de Printed by: PFITZER Druck und Medien e. K., Renningen, www.pfitzer.de Landesvermessungsamt Title photo: Manfred Grohe, Kirchentellinsfurt Baden-Württemberg Translation: proverb oHG, Stuttgart, www.proverb.de EDITORIAL Baden-Württemberg is an international state – The publication is intended for a broad pub- in many respects: it has mutual political, lic: schoolchildren, trainees and students, em- economic and cultural ties to various regions ployed persons, people involved in society and around the world. Millions of guests visit our politics, visitors and guests to our state – in state every year – schoolchildren, students, short, for anyone interested in Baden-Würt- businessmen, scientists, journalists and numer- temberg looking for concise, reliable informa- ous tourists. A key job of the State Agency for tion on the southwest of Germany. Civic Education (Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg, LpB) is to inform Our thanks go out to everyone who has made people about the history of as well as the poli- a special contribution to ensuring that this tics and society in Baden-Württemberg. -

Wiederaufbau Von Wirtschaft Und Verwaltung
IV Der Wiederaufbau von Wirtschaft und Verwaltung Neuanfang unter amerikanischer Flagge Wiederbelebung sozialdemokratischer Ortsvereine Wilhelm Hoegners erste Regierungszeit Die Wiedergründung des bayerischen Landesverbandes der SPD Der Bayerische Beratende Landesausschuss Der Weg zur Bayerischen Verfassung Erster Bayerischer Landtag 1946: Koalition mit der CSU Bayerns SPD erstmals in der Opposition (1947–1950) Streitfall Grundgesetz – Wahlen zum ersten Deutschen Bundestag Zweiter Bayerischer Landtag 1950: erneute Koalition mit der CSU Dritter Landtag 1954: die Viererkoalition und ihr Ende Bayerische Landtagswahl 1958: SPD wieder in der Opposition Wirtschaft Die bayerische SPD und das Godesberger Programm Wiederaufbau Fünfter Bayerischer Landtag 1962: Generationswechsel in der SPD Verwaltung 95 IV DER WIEDERAUFBAU VON WIRTSCHAFT UND VERWALTUNG Neuanfang unter amerikanischer Flagge Das Ende der Die Einnahme Bayerns durch US-amerikanische Schiefer und mit Thomas Wimmer, dem späteren nationalsozialistischen Tr uppen vollzog sich innerhalb weniger Wochen; sie Oberbürgermeister von München. Die beiden Sozial- Diktatur begann am 25. März 1945 nördlich von Aschaffen- demokraten sandten Schäffer am 22. Mai 1945 eine burg und endete am 4. Mai mit der Übergabe von Liste mit Personalvorschlägen „ministrabler“ SPD- Berchtesgaden. Mit der bedingungslosen Kapitula- Kandidaten, auf der unter anderem die früheren tion des Deutschen Reiches am 8. Mai 1945 war die Landtagsabgeordneten Albert Roßhaupter, Wilhelm zwölfjährige nationalsozialistische Diktatur -

Verzeichnis Der Abkürzungen
Verzeichnis der Abkürzungen APuZ Aus Politik und Zeitgeschichte BCSV Badisch-Christlich-Soziale Volkspartei BHE Block (Bund) der Heimatvertriebenen und Entrechteten BP Bayernpartei BVerfG Bundesverfassungsgericht BVP Bayrische Volkspartei CDU Christlich Demokratische Union Deutschlands csu Christlich Soziale Union CVP Christliche Volkspartei DP Deutsche Partei DKP Deutsche Kommunistische Partei DNVP Deutschnationale Volkspartei DRP Deutsche Reichspartei DVP Deutsche Volkspartei DZP Deutsche Zentrumspartei EG Europäische Gemeinschaft EU Europäische Union EURATOM Europäische Atomgemeinschaft EVG Europäische Verteidigungsgemeinschaft FAZ Frankfurter Allgemeine Zeitung FDP Freie Demokratische Partei FR Frankfurter Rundschau GG Grundgesetz INFAS Institut ftir angewandte Sozialwissenschaft JÖR Jahrbuch des Öffentlichen Rechts der Gegenwart KPD Kommunistische Partei Deutschlands LDPD Liberaldemokratische Partei Deutschlands MP Ministerpräsident MPen Ministerpräsidenten 395 NPD Nationaldemokratische Partei Deutschlands NZZ Neue Züricher Zeitung ÖVP Österreichische Volkspartei POS Partei des Demokratischen Sozialismus PVS Politische Vierteljahreszeitschrift RNZ Rhein-Neckar-Zeitung SBZ Sowjetische Besatzungszone SED Sozialistische Einheitspartei Deutschlands SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands SPÖ Sozialdemokratische Partei Österreichs ssw Südschleswigscher Wählerverband sz Süddeutsche Zeitung Zentrum Deutsche Zentrumspartei ZParl Zeitschrift flir Parlamentsfragen 396 Tabellenverzeichnis Tabelle I: Einstellungen zur Auflösung von Landtagen -
Karl Arnold (1901–1958)
Karl Arnold (1901–1958) Eine Ausstellung der Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. Archiv für Christlich-Demokratische Politik Rathausallee 12 · 53757 Sankt Augustin www.kas.de Konzeption und Gestaltung: Dr. Brigitte Kaff Fotos: ACDP, Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Landtagsarchiv und Stadtarchiv Düsseldorf, Rheinische Post, AP, dpa, Keystone Graphische Gestaltung und Herstellung: G Gottschalk-Graphik Gesellschaft für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit mbH Luisenstraße 14a · 53604 Bad Honnef 1 Karl Arnold – Herkunft und Familie 1901, 21. März Karl Arnold wird in Herrlishöfen bei Biber- ach an der Riß als Sohn des Landwirts Johann B. Arnold geboren 1919 Gesellenprüfung als Schuhmacher 1920/1921 Lehrgang an der „Sozialen Hochschule, Leo- haus“ in München 1921 Angestellter des Christlichen Lederarbeiter- verbandes in Düsseldorf 1924 Sekretär des Düsseldorfer Bezirkskartells der Christlichen Gewerkschaften ! @ 1929–1933 Stadtverordneter, ab 1931 stellv. Fraktions- vorsitzender (Zentrum) ab 1933 Mitinhaber eines Installati- onsgeschäftes; Arnold gehörte zu einem Widerstandskreis christlicher Regimegegner in Düsseldorf 1944, 23. August Im Zuge der Aktion „Gewit- ter“ von der Gestapo verhaf- tet 1945 Mitgründer der CDP/CDU Düsseldorf; Mitgründer der Einheitsgewerkschaft 1945 Mitglied des „Vertrauens - ausschusses“ und des von der Besatzungsmacht ernannten Stadtrates in Düsseldorf 1945–1948 Vorsitzender der CDU-Düssel- dorf 1946, 29. Januar Wahl zum Oberbürgermeister 1946–1948 Stadtverordne- ter # 1946–1958 Mitglied des Landtags NRW 1946, Dezember–1947, Juni Stellver- tretender Ministerpräsident 1947, 17. Juni Wahl zum Ministerprä siden ten, Regierungs koalition aus CDU/Zentrum/ SPD/KPD 1949–1950 Bundesratspräsident 1950, 27. Juli Wahl zum Ministerpräsidenten, Regierungs koalition aus CDU/Zentrum 1954, 27. Juli Wahl zum Ministerpräsidenten, Regierungs koalition aus CDU/Zentrum/FDP 1956, 20. Februar Sturz von Ministerpräsident Arnold durch konstruktives Mißtrauensvotum der SPD und FDP 1956, 28. -

Die Cdu-Landtagsfraktion in Nordrhein-West Falen 1946- 1980*
Ludger Gruber DIE CDU-LANDTAGSFRAKTION IN NORDRHEIN-WEST FALEN 1946- 1980* Die historische Entwicklung der CDU-Landtagsfraktion in Nordrhein-Westfalen nachzu zeichnen, schien auf den ersten Blick eine nicht leichte, aber lösbare Aufgabe zu sein. Doch sehr bald zeigte sich, daß der politische Allerweltsbegriff "Fraktion" wissenschaftlich nur schwer einzugrenzen und zu bestimmen ist. Offenbar nicht olme Grund vermieden die Ver fassung von Nordrhein-Westfalen sowie die Geschäftsordnung seines Landtags ein näheres Eingehen auf die Fraktion, 1 resignierten die Zeitgenossen bei dem Versuch, die Rechtsnatur von Parlamentsfraktionen gesetzlich zu regeln2 oder gelangte die Forschung mehrheitlich zu dem Ergebnis, daß es eine theoretische, d. h. allgemeinverbindliche und umfassende Defini tion der Institution "Fraktion" nicht gebe. 3 Der spärlichen materiell-rechtlichen Einbindung einer Fraktion in das Staatorganisations gefüge stehen ihre umfangreichen faktischen Befugnisse und ihre Schlüsselstellung in der Verfassungswirklichkeit auch des Landes Nordrhein-Westfalen gegenüber. Diese werden bis lang jedoch vornehmlich von der Rechts- und der Politikwissenschaft mit ihren disziplinspe zifischen Fragestellungen erörtert. 4 Dabei könnte auch die Geschichtswissenschaft, vielleicht sogar gerade sie, weitere Erkenntnisse über folgende Problemkreise hervorbringen: • Wesen und Funktion einer parlamentarischen Fraktion • Die Landesebene als politische und räumliche Bedingung von Fraktionshandeln * Dieser Beitrag stützt sich auf eine in Kürze erscheinende Monographie des Verfassers, in der die Ergebnisse des Forschungsprojektes des nordrhein-westfalischen Landtags vorgestellt werden. Der voraussichtliche Titel lautet: Die CDU-Landtagsfraktion in Nordrhein-Westfalen 1946-1980. Eine parlamentshistorische Untersuchung. ' Kein Artikel der Landesverfassung von Nordrhein-Westfalen vom 28. 6. 1950 ftihrt den Begriff "Frak tion"; vgl. Kurt Kleinrahm und Alfred Dickersbach, Die Verfassung des Landes Nordrhein-Westfalen, Kommentar, Göttingen 3 1977. -

27. November 1964
Nr. 17: 27. November 1964 17 Bonn, Freitag 27. November 1964 Sprecher: Adenauer, Barzel, Blumenfeld, Burgbacher, Dichtel, Dollinger, Duftiues, Erhard, Grundmann, Gurk, Hellwig, Jansen, Katzer, Klepsch, Kohl, Krone, Lemke, Lücke, Röder, Scheu- feien, Schmücker, Frau Schwarzhaupt, [Stingl]. Bericht zur Lage (Erhard). Aussprache: Außenpolitische Differenzen; Kommunalwahlen im Herbst 1964; Bundestagswahlkampf 1965. Ort und Termin des Bundesparteitages 1965. Ver- schiedenes. Beginn: 9.30 Uhr Ende: 14.10 Uhr Adenauer: Meine Damen und Herren! Ich heiße Sie alle herzlich willkommen, an Ihrer Spitze den Herrn Bundeskanzler. Es haben sich entschuldigt die Herren Erik Blumenfeld ... (Zuruf: Ist da!) Der scheint sich im voraus zu entschuldigen! (Lebhafte Heiterkeit.) Dr. Rupprecht Dittmar, Dr. Eugen Gerstenmaier, Dr. Bruno Heck, Claus Joachim von Heydebreck, Kurt Georg Kiesinger, Dr. Franz Meyers, Prof. Dr. Paul Mikat, Dr. Otto Schmidt, Dr. Gerhard Stoltenberg, Franz Etzel, Dr. Wilhelm Bosse1, Frau Annette Dörzenbach2, Frau Dr. Mathilde Gantenberg3, Georg Grosse4, Dr. Anton Köchling5, Walter Kühlthau6, Lambert Lensing7, Dr. Ferdinand 1 Dr. Wilhelm Bosse (1900-1971), Rechtsanwalt und Notar; 1954-1961 Vorsitzender der CDU-Fraktion in der Bezirksversammlung Altona, 1961-1966 MdHB. 2 Annette Dörzenbach (geb. 1921), 1952 CDU, 1959-1976 Mitglied des Kreistags (Mosbach, ab 1973 Neckar-Odenwald). 3 Dr. Mathilde Gantenberg (1889-1975), Lehrerin; 1956-1961 MdB (CDU). Vgl. PROTOKOLLE 3 S. 657 Anm. 15. 4 Georg Grosse (1900-1973), Bankdirektor; 1920 Zentrum, 1945 Mitgründer der CDU Thüringen und 1946-1947 stv. Landesvorsitzender, ab 1946 MdL Thüringen (1946-1948 Minister für Handel und Versorgung), 1949 Flucht nach West-Berlin, ab 1950 Mitglied des Hauptvorstands der Exil-CDU, 1956 Direktor der Bank für Gemein Wirtschaft, Aachen. -
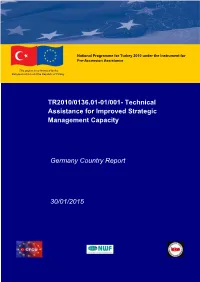
TR2010/0136.01-01/001- Technical Assistance for Improved Strategic
National Programme for Turkey 2010 under the Instrument for Pre-Accession Assistance This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey TR2010/0136.01-01/001- Technical Assistance for Improved Strategic Management Capacity Germany Country Report 30/01/2015 1 Table of Contents Page 1. General Information 4 1.1. Sources and Aims 4 1.2. Structural Aspects of the German State 4 1.3. Area and Population 7 1.4. GDP and Financial and Budgetary Situation 10 1.5. Main Economic and Commercial Characteristics 12 2. Government and Public Administration of the Federal Level 15 2.1. Federal Constitutional Structure (head of state, head of government, parliament, judiciary) 15 2.2. Central Bodies (chancellor, ministers) 16 2.3. Public Administration 17 2.3.1. Public Administration: employees 17 2.3.2. Public Administration: assessment and training 19 2.4. Reforms to the Structure of Government (past, in progress, planned) 22 3. Four Examples of Länder/Federal States (according to size, history, economic structure and geographic direction) 26 3.1. Baden-Württemberg - General Structure 28 3.1.1. Government and Public Administration 28 3.1.2. Reforms 30 3.2. Brandenburg - General Structure 32 3.2.1. Government and Public Administration 32 3.2.2. Reforms 33 3.3. Lower Saxony - General Structure 34 3.3.1. Government and Public Administration 35 3.3.2. Reforms 36 3.4. Saarland - General Structure 38 3.4.1. Government and Public Administration 38 3.4.2. Reforms 39 4. Strategic Planning and Public Budgeting 41 4.1. -

Journalists and Religious Activists in Polish-German Relations
THE PROJECT OF RECONCILIATION: JOURNALISTS AND RELIGIOUS ACTIVISTS IN POLISH-GERMAN RELATIONS, 1956-1972 Annika Frieberg A dissertation submitted to the faculty of the University of North Carolina at Chapel Hill in partial fulfillment of the requirements for the Degree of Doctor of Philosophy in the Department of History. Chapel Hill 2008 Approved by: Dr. Konrad H. Jarausch Dr. Christopher Browning Dr. Chad Bryant Dr. Karen Hagemann Dr. Madeline Levine View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Carolina Digital Repository ©2008 Annika Frieberg ALL RIGHTS RESERVED ii ABSTRACT ANNIKA FRIEBERG: The Project of Reconciliation: Journalists and Religious Activists in Polish-German Relations, 1956-1972 (under the direction of Konrad Jarausch) My dissertation, “The Project of Reconciliation,” analyzes the impact of a transnational network of journalists, intellectuals, and publishers on the postwar process of reconciliation between Germans and Poles. In their foreign relations work, these non-state actors preceded the Polish-West German political relations that were established in 1970. The dissertation has a twofold focus on private contacts between these activists, and on public discourse through radio, television and print media, primarily its effects on political and social change between the peoples. My sources include the activists’ private correspondences, interviews, and memoirs as well as radio and television manuscripts, articles and business correspondences. Earlier research on Polish-German relations is generally situated firmly in a nation-state framework in which the West German, East German or Polish context takes precedent. My work utilizes international relations theory and comparative reconciliation research to explore the long-term and short-term consequences of the discourse and the concrete measures which were taken during the 1960s to end official deadlock and nationalist antagonisms and to overcome the destructive memories of the Second World War dividing Poles and Germans. -

Villa Reitzenstein
Villa Reitzenstein Herzlich willkommen in der Villa Reitzenstein Das prächtige Gebäude in Stuttgarter Halbhöhenlage ist Amtssitz des Ministerpräsidenten und zugleich Sitz der Landesregierung und des Staatsministeriums von Baden-Württemberg. Wir laden Sie herzlich ein zu einem virtuellen Rundgang durch dieses Haus, das von der Baronin Helene von Reitzenstein zu Beginn des vorigen Jahrhunderts errichtet wurde und von einem herrlichen Park umgeben ist. Werfen Sie einen Blick in das Innere der Villa und erfahren Sie mehr über den Ort, von dem aus Baden-Württemberg regiert wird. Virtueller Rundgang durch die Villa Reitzenstein www.villa-reitzenstein.de © Staatsministerium Baden-Württemberg Villa Reitzenstein Innenansichten Eingangshalle Durch ein schweres messingbeschlagenes Portal betritt der Besucher die großzügige Eingangshalle der Villa Reitzenstein. Von hier aus erreicht man die Empfangs- und Repräsentationsräume des baden-württembergischen Regierungssitzes. Markant ist das kunstvolle Fußbodenmosaik aus italienischem Marmor. Ein großformatiges Gemälde erinnert an die Erbauerin der Villa, Baronin Helene von Reitzenstein, ein weiteres an ihren Ehemann, Baron Carl von Reitzenstein. In das gusseiserne Geländer entlang der ins Obergeschoss führenden Treppe ist ein Monogramm mit ihren Initialen „HR“ eingearbeitet. Schon die Eingangshalle vermittelt einen Eindruck von der Eleganz der schlossartigen Villa. Im Seitenflur hängen die gemalten Porträts der ehemaligen Ministerpräsidenten Reinhold Maier (1952 - 1953), Hans Filbinger (1966 - 1978), Lothar Späth (1978 - 1991) und Erwin Teufel (1991 - 2005). Virtueller Rundgang durch die Villa Reitzenstein www.villa-reitzenstein.de © Staatsministerium Baden-Württemberg Villa Reitzenstein Runder Saal Im Runden Saal empfängt der baden-württembergische Ministerpräsident Gäste aus nah und fern. Zahlreiche Staatsoberhäupter und königliche Hoheiten standen schon unter dem Kronleuchter der früheren Hausherrin, Baronin von Reitzenstein, und trugen sich in das Gästebuch des Landes ein. -

Die Politisch-Administrative Elite Der BRD Unter Kurt Georg Kiesinger (1966-1969)
Gefördert durch: Randauszählungen zu Elitestudien des Fachgebiets Public Management der Universität Kassel Band 18 Die Politisch-Administrative Elite der BRD unter Kurt Georg Kiesinger (1966-1969) Bastian Strobel Simon Scholz-Paulus Stefanie Vedder Sylvia Veit Die Datenerhebung erfolgte im Rahmen des von der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien geförderten Forschungsprojektes „Neue Eliten – etabliertes Personal? (Dis-)Kontinuitäten deut- scher Ministerien in Systemtransformationen“. Zitation: Strobel, Bastian/Scholz-Paulus, Simon/Vedder, Stefanie/Veit, Sylvia (2021): Die Poli- tisch-Administrative Elite der BRD unter Kurt Georg Kiesinger (1966-1969). Randauszählungen zu Elitestudien des Fachgebiets Public Management der Universität Kassel, Band 18. Kassel. DOI: 10.17170/kobra-202102193304. Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung ...................................................................................................................................... 1 2 Personenliste ................................................................................................................................ 5 3 Sozialstruktur ................................................................................................................................ 9 4 Bildung ........................................................................................................................................ 13 5 Karriere ...................................................................................................................................... -

CSU-Parteivorsitzender 1945-1949
Die Parteivorsitzenden* der CSU (Stand: August 2020) Josef Müller – Landesvorsitzender 17.12.1945-28.05.1949 Hans Ehard – Landesvorsitzender 28.05.1949-22.01.1955 Hanns Seidel – Landesvorsitzender 22.01.1955-18.03.1961 Franz Josef Strauß – Landes-/Parteivorsitzender 18.03.1961-03.10.1988 Theo Waigel – Parteivorsitzender 19.11.1988-16.01.1999 Edmund Stoiber – Parteivorsitzender 16.01.1999-29.09.2007 Erwin Huber – Parteivorsitzender 29.09.2007-25.10.2008 Horst Seehofer – Parteivorsitzender 25.10.2008-19.01.2019 Markus Söder – Parteivorsitzender seit 19.01.2019 ** Die Ehrenvorsitzenden der CSU (Stand: Januar 2019) Josef Müller –Ernennung zum Ehrenvorsitzenden am 13.06.1969 Hans Ehard –Ernennung zum Ehrenvorsitzenden am 13.06.1969 Edmund Stoiber – Ernennung zum Ehrenvorsitzenden am 29.09.2007 Theo Waigel – Ernennung zum Ehrenvorsitzenden am 18.07.2009 Horst Seehofer – Ernennung zum Ehrenvorsitzenden am 14.01.2019 * Die Bezeichnung Landesvorsitzender (seit 1945) wurde 1968 in Parteivorsitzender geändert. ** Die Ernennung zu Ehrenvorsitzenden erfolgte jeweils durch die CSU-Parteitage. Franz Josef Strauß machte in der Präsidiumssitzung am 13.06.1969 darauf aufmerksam, dass die ehemaligen Parteivorsitzenden nach einer Satzungsänderung nicht mehr Mitglied des Landesvorstands wären, stattdessen könnten nun Ehrenmitglieder und Ehrenvorsitzende ernannt werden. 2 Josef Müller – CSU-Parteivorsitzender 1945-1949 (Foto: ACSP) 27.03.1898 in Steinwiesen geboren 1916-1918 Soldat beim Bayerischen Minenwerfer-Bataillon IX 1919-1923 Studium der Rechtswissenschaften