Christa Reinig Christa Reinig (Geb
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Das 20. Jahrhundert 252
Das 20. Jahrhundert 252 Prominent 2 ! Bekannte Schriftsteller, Kritiker und Künstler Antiquariat Frank Albrecht · [email protected] 69198 Schriesheim · Mozartstr. 62 · Tel.: 06203/65713 Das 20. Jahrhundert 252 D Verlag und A Prominent 2 ! Bekannte Schriftsteller, S Antiquariat Kritiker und Künstler 2 Frank 0. J A Albrecht H Inhalt R H Belletristik ....................................................................... 1 69198 Schriesheim U Sekundärliteratur ........................................................... 31 Mozartstr. 62 N Kunst ............................................................................. 35 Register ......................................................................... 55 Tel.: 06203/65713 D FAX: 06203/65311 E Email: R [email protected] T USt.-IdNr.: DE 144 468 306 D Steuernr. : 47100/43458 Die Abbildung auf dem Vorderdeckel A zeigt eine Original-Zeichnung von S Joachim Ringelnatz (Katalognr. 113). 2 0. J A H Spezialgebiete: R Autographen und H Widmungsexemplare U Belletristik in Erstausgaben N Illustrierte Bücher D Judaica Kinder- und Jugendbuch E Kulturgeschichte R Unser komplettes Angebot im Internet: Kunst T http://www.antiquariat.com Politik und Zeitgeschichte Russische Avantgarde D Sekundärliteratur und Bibliographien A S Gegründet 1985 2 0. Geschäftsbedingungen J Mitglied im Alle angebotenen Bücher sind grundsätzlich vollständig und, wenn nicht an- P.E.N.International A ders angegeben, in gutem Erhaltungszustand. Die Preise verstehen sich in Euro und im Verband H (€) inkl. Mehrwertsteuer. -

Annexure No.-83 BA (Hons) German CBCS Department of Germanic and Romance Studies, University of Delhi
Annexure No.-83 BA (Hons) German CBCS Department of Germanic and Romance Studies, University of Delhi BA (Hons) German CBCS About the Department The Department offers B.A. (Honours) CBCS courses in four different European languages, namely, French, German, Italian and Spanish. These courses have been designed adopting the Task based and Communicative Approach, i.e. the latest Foreign Language Teaching methodology, in order to enable learners to attain the language competency levels specified by the internationally accepted Common European Framework of Reference for Languages (CEF), developed by the European Council. All the four programs follow a common structure, prescribed by the UGC guidelines on Choice Based Credit System. Each course aims at imparting specific linguistic skills as well as life skills that would help learners to communicate effectively in real life situations. Our endeavor is to integrate real life communicative situations in the language class rooms with the help of concrete tasks and project based collaborative teaching-learning. The B.A. (Honours) CBCS programs serve the following purposes: Develops communication skills in the chosen language and helps to acquire a broad understanding of the society, history and culture within which these languages have developed and are used. Integrates knowledge of social and political institutions, historical events, and literary and cultural movements into the acquisition of the four linguistic skills - reading, writing, listening and speaking. Develops language skills and critical thinking. Enables students to attain B2 level at the end of the program by completing stages of language learning specified by the internationally accepted Common European Framework of Reference for Languages (CEF), developed by the European Council. -

Christa Reinig
Darstellung und Auflösung von Lebensproblemen im Werk: Christa Reinig Inaugural-Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades des Fachbereichs III der Universität Siegen vorgelegt von Sibylle Scheßwendter, Kassel, im Jahre 2000 I Darstellung und Auflösung von Lebensproblemen im Werk: Christa Reinig INHALT: Vorwort (S.1-3) A. Krieg und Tod I. Kriegstrauma: Krieg und Tod als Themen des Jugendwerkes (S45) 1) Christa Reinigs ”tiefstes Herz” in seiner Entwicklung (S.4) a) ”Das Jahr 1945” (S.5) b) ”der traum meiner verkommenheit” (S.7) 2) Das Kriegstrauma als metaphorischer Boden für die frühe Lyrik und Prosa (S.8) a) ”In die Gewehre rennen”( S.8) b) Tod, Mystik und Buddhismus (S.11) c) Spruchdichtung (S.14) d) ”Der Teufel, der stumm bleiben wollte” (S.14) e) Todesstrafe: ”Japanische Bittschrift” (S.16) f) ”Ödipus Ichtöter”, ”Einige Fahrstühle”, frühe Prosastücke (S.18) g) ”Die Ballade vom blutigen Bomme” (S.20) h) Ringelnatz und Reinig (S.24) 3) Zusammenfassung (S.26) II. Bewältigung in Phasen (S.26) 1) Bildliche Erweiterung zur Raum- und Weltraumthematik in “Orion trat aus dem Haus. Neue Sternbilder” (S.28) II 2) Abrechnung mit dem tradierten Christentum in ”Columba.Taube” (S.30) 3) Einschub: Vergleich mit Ingeborg Bachmanns Kriegs- und Todesbegriff in Lyrik und Prosa und Virginia Woolfs ”Mrs. Dalloway” (S.30) a) Ingeborg Bachmann, ”Einem Feldherrn”, ”Alle Tage”, ”Todesarten” (S.31) b) Virginia Woolfs Septimus Warren Smith (S.31) 4) Umschichtung der Sterblichkeitserfahrung durch Sapphos Dichtung und eine neue matriarchale Frömmigkeit in ”Die Frau im Brunnen” (S.33) 5) Enttraumatisierende Liebe in ”Müßigggang ist aller Liebe Anfang“ (S.35) III. Zusammenfassung (S.37) B. -

Zur Neueren Lyrik Christa Reinigs. –
Zeit der Weiblichkeit? – Zur neueren Lyrik Christa Reinigs. – Beginnen wir mit drei Zitaten von Christa Reinig: Drei typen hab ich gerne: einen heterosexuellen, der über die homosexualität phantasiert, einen mann guten willens, der den frauen zur emanzipation verhelfen will, und einen linken professor, der über die menschlichkeit und nächstenliebe der proletarier doziert. 1[Christa Reinig: „Theweleit-Phantasien“, in: Christa Reinig: Der Wolf und die Witwen. Erzählungen und Essays, München, 1981 (1979), S. 36–45; S. 45] 4 MITTWOCH Was denkst du? – Dich! Bist du traurig? – Ich bin glücklich als ich noch nicht lieben konnte habe ich viel gelacht 5 DONNERSTAG Sie ist wieder nicht gekommen ich schließe das fenster es gibt nichts getreues außer den bildern 2[Christa Reinig: Sämtliche Gedichte. Mit einem Vorwort von Horst Bienek, Düsseldorf, 1984, S. 111. – Zitate aus diesem Band im folgenden Text: SG und Seitenzahl.] Das Prosa-Zitat entstammt einer Rezension von Theweleits Männerphantasien vom Ende der siebziger Jahre. Die beiden Vierzeiler sind dem Zyklus Müßiggang ist aller Liebe Anfang (1979) entnommen, von dem vor allem die Rede sein soll. Dabei nehme ich die Abweisungen der Autorin ernst; ich möchte zu zeigen versuchen, warum ich ihr nicht gehorchen kann. Natürlich kommt mir der Vorzug der poetischen Sprache zu Hilfe, daß sie ihre Wirklichkeit selbst schafft, so mimetisch sie sich auch gibt, und daß diese Wirklichkeit Kommunikation nur dem verweigern kann, der sich nicht mit ihr in ein hermeneutisches Gespräch einläßt, der sie also, schlicht gesagt, mißversteht. Daß man sich immer um das Verständnis des zunächst fremden bemühen muß, ist eine Binsenweisheit. Ebenso, daß immer ein mehr oder weniger bedeutender Rest bleibt, den man sich nicht aneignen kann. -
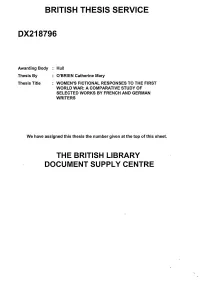
Hull Thesis By
BRITISH THESIS SERVICE DX218796 Awarding Body : Hull Thesis By : O'BRIEN Catherine Mary Thesis Title : WOMEN'S FICTIONAL RESPONSES TO THE FIRST WORLD WAR: A COMPARATIVE STUDY OF SELECTED WORKS BY FRENCH AND GERMAN WRITERS We have assigned this thesis the number given at the top of this sheet. THE BRITISH LIBRARY DOCUMENT SUPPLY CENTRE . DEPARTMENT. ................... DEGREE NAME-C.. ..... G-es ........ tv'. u. /, - THE UNIVERSITY O HULL Deposit of thesis in accordance with Senate Minute 131,1955/56, 141,1970/1 and 343,1988/89 C- M I l) R`ý hereby give m consent that a copy of my thesis g. Dc, -1D -__ ýV\, If accepted for the degree of .. V in the University of Hull and thereafter deposited in the University Library shall be available for consultation, interlihrar Ioan and photoco ying at the discretion of the University Librarian Signalure/__'' L If, by reason of special circumstances, the author wishes to withhold for a period of not more than five years from the date of the degree being awarded the consent required by Senate, and if for similar reasons lie or she does not wish details of the thesis to be included in the University Library's catalogues or forwarded to any indexing or abstracting organisation, he or she should complete and sign sections (1) and (2) below, as appropriate (1) 1 wish access to my thesis to be withheld until for the following reason Signature (2) I further wish that full details of the title and subject of my thesis are not to be included in the University Library's catalogues or forwarded to any indexing -

Sommersemester 2017 Vorlesungszeit:18.04.2017 - 22.07.2017
Sommersemester 2017 Vorlesungszeit:18.04.2017 - 22.07.2017 Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät Unter den Linden 6, 10099 Berlin, Sitz: Dorotheenstr. 24, 10117 Berlin Dekanin Prof. Dr. phil. Ulrike Vedder, DOR 24, 3.501, Tel. 2093-9712 Dekanatssekretärin Sibylle Weiß, DOR 24, 3.202, Tel. 2093-9604, Fax 2093-9601 Prodekanin für Lehre und Studium Prof. Dr. Alfrun Kliems, DOR 65, 529, Tel. 2093-5176 Prodekanin für Forschung Prof. Dr. phil. Anke Lüdeling, DOR 24, 3.342, Tel. 2093-9799 Verwaltungsleiterin Dr. phil. Annegret van Mörbeck, DOR 24, 3.344, Tel. 2093-9603, Fax 2093-9602 stellvertr. Verwaltungsleiterin Else Engelhardt, DOR 65, 458, Tel. 2093-5100 Frauenbeauftragte PD Dr. phil. Anna Helene Feulner, DOR 24, 3.213, Tel. 2093-9779 Dekanatsassistentin Laura Hausmann, DOR 24, 3.309, Tel. 2093-9604 Lehre und Studium Referentin für Lehre und Studium Dr. phil. Barbara Gollmer, DOR 24, 3.205, Tel. 2093-9606, Fax 2093-9602 Studentische Studienfachberaterin Stefanie Meißner, DOR 24, 3.206, Tel. 2093-9735 Koordinatorin für internationale Angelegenheiten M.A. Stephanie Trigoudis, DOR 24, 3.411, Tel. 2093-9798 Sprechzeit: Do 13-15 Leiter der Praktikumsbörse "Sprungbrett" Dr. phil. Rainer Fecht, FRS191, 3008B, Tel. 2093-70504, Fax 2093-70640 Promotionsangelegenheiten Vorsitzender Prof. Dr. phil. Markus Egg, UL 6, 2008A, Tel. 2093-2295 Sachbearbeiterin Uta Kabelitz, DOR 24, 3.208, Tel. 2093-9688 Prüfungsausschuss Fremdsprachliche Philologien Vorsitzender Prof. Dr. phil. Lutz Küster, DOR 65, 427, Tel. 2093-5123, Fax 2093-5125 Vorsitzender Prof. Dr. phil. Markus Asper, UL 6, 3067A, Tel. 2093-70430, Fax 2093-70436 Sachbearbeiterin für Prüfungsangelegenheiten Katharina Bordiehn, DOR 65, 476, Tel. -

Lyrische Dialektik Von Ulrich Dittmann (München)
Lyrische Dialektik von Ulrich Dittmann (München) Lieber Wolfgang, meine sehr verehrten Damen und Herren, Professor Wiesmüller und ich, wir kennen uns über einen ganzen Generationszeitraum, d.h. vor mehr als dreißig Jahren kamen wir erstmals dank der editorischen Arbeit an Stifters Prosa zusammen. Mit einem Thema aus der Lyrik überschreite ich auf Wunsch der Veranstalter unsere durch die professionelle Kooperation definierten Gattungsgrenzen. Ich tue das gerne, liegt doch ein unprofessioneller Anlass vor, zu dem ich auch sehr gerne angereist bin. Mein Thema klingt anspruchsvoll theoretisch, es wird Ihnen hier jedoch keine Theorie kreiert werden, davon hat meine Generation genug produziert; den Begriff „dialektisch“ drängten mir Texte auf, von denen ich Ihnen zwei vorstellen möchte. Ich konnte mich mit ihnen immerhin so weit identifizieren, dass ich sie wiederholt in meinen Seminaren und germanistischen Einführungskursen an der Ludwig-Maximilians-Universität verwendete. Durchaus in didaktischer Absicht ging es mir darum, den Studierenden die Vorurteile auszutreiben, die ihnen – notgedrungen, weil von Vertretern meiner Generation unterrichtet – den Zugang zu weiten Bereichen der Lyrik einschränkten oder ganz verbauten. In gewisser Weise waren also die Wahl der Texte und die Beschäftigung mit ihnen, auch eine Befreiungsreaktion auf Erfahrungen meines vor mehr als 50 Jahren, vor allem durch Gedichtlektüre motivierten Studienbeginns. Außerdem gab es zu den beiden von mir für diesen Anlass ausgewählten Texten außerfachliche Ereignisse, die sie mir nahe brachten. Ich werde davon berichten, zunächst aber zum Hintergrund meiner Textwahl aus aktiver Unterrichtszeit und für den heutigen Anlass. Bei meinem Studienanfang war Emil Staiger dank seiner Grundbegriffe der Poetik der Papst des Faches und Wolfgang Kayser sein Sprachrohr; dessen Buch Das sprachliche Kunstwerk lehrte uns ganz dogmatisch: Beim lyrischen Sprechen „ist alles Innerlichkeit. -

Gender and Humour II: Reinventing The
Issue 2011 35 Gender and Humour II: Reinventing the Genres of Laughter Edited by Prof. Dr. Beate Neumeier ISSN 1613-1878 Editor About Prof. Dr. Beate Neumeier Gender forum is an online, peer reviewed academic University of Cologne journal dedicated to the discussion of gender issues. As an English Department electronic journal, gender forum offers a free-of-charge Albertus-Magnus-Platz platform for the discussion of gender-related topics in the D-50923 Köln/Cologne fields of literary and cultural production, media and the Germany arts as well as politics, the natural sciences, medicine, the law, religion and philosophy. Inaugurated by Prof. Dr. Tel +49-(0)221-470 2284 Beate Neumeier in 2002, the quarterly issues of the journal Fax +49-(0)221-470 6725 have focused on a multitude of questions from different email: [email protected] theoretical perspectives of feminist criticism, queer theory, and masculinity studies. gender forum also includes reviews and occasionally interviews, fictional pieces and Editorial Office poetry with a gender studies angle. Laura-Marie Schnitzler, MA Sarah Youssef, MA Opinions expressed in articles published in gender forum Christian Zeitz (General Assistant, Reviews) are those of individual authors and not necessarily endorsed by the editors of gender forum. Tel.: +49-(0)221-470 3030/3035 email: [email protected] Submissions Editorial Board Target articles should conform to current MLA Style (8th edition) and should be between 5,000 and 8,000 words in Prof. Dr. Mita Banerjee, length. Please make sure to number your paragraphs Johannes Gutenberg University Mainz (Germany) and include a bio-blurb and an abstract of roughly 300 Prof. -

Diplomsko Delo
UNIVERZA V MARIBORU FILOZOFSKA FAKULTETA ODDELEK ZA GERMANISTIKO DIPLOMSKO DELO Katja Kocbek Maribor, 2009 UNIVERSITÄT MARIBOR PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT Abteilung für Germanistik Diplomarbeit FRAUEN IN DEN WERKEN DEUTSCHSPRACHIGER SCHRIFTSTELLERINNEN: AM BEISPIEL VON INGEBORG BACHMANNS SIMULTAN UND HERA LINDS DAS SUPERWEIB Mentorin: o. Prof. Dr. Vesna Kondrič Horvat Studentin: Katja Kocbek Studienfach: Germanistik Maribor, 2009 UNIVERZA V MARIBORU FILOZOFSKA FAKULTETA Oddelek za germanistiko Diplomsko delo ŽENSKE V DELIH NEMŠKO GOVOREČIH AVTORIC; NA PRIMERU NOVELE SIMULTANO AVTORICE INGEBORG BACHMANN IN SUPERŽENSKA AVTORICE HERE LIND Mentorica: red. prof. dr. Vesna Kondrič Horvat Študentka: Katja Kocbek Študijska smer: Nemški jezik s književnostjo Maribor, 2009 U N I V E R Z A V M A R I B O R U F I L O Z O F S K A F A K U L T E T A Koroška cesta 160 2000 Maribor I Z J A V A Podpisani-a Katja Kocbek, rojena 31.01.1982, študentka Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, smer Nemški jezik s književnostjo, izjavljam, da je diplomsko delo z naslovom Frauen in den Werken deutschsprachiger Schriftstellerinnen; am Beispiel von Ingeborg Bachmanns „Simultan“ und Hera Linds „Das Superweib“ pri mentorici red. prof. dr. Vesni Kondrič Horvat, avtorsko delo. V diplomskem delu so uporabljeni viri in literatura korektno navedeni; teksti niso prepisani brez navedbe avtorjev. Katja Kocbek Maribor, 12.3.2009 DANKSAGUNG Ich möchte mich in erster Linie bei meiner Mentorin bedanken, die auf meinen Themenvorschlag eingegangen ist, mir bei der Erstellung der Diplomarbeit freie Hand ließ und mir half, wenn ich ihre Hilfe benötigt habe. Mein herzlicher Dank geht auch an meine Familie, Verwandte und Freunde, die zu mir gehalten und mich immer wieder ermutigt haben. -

Dokument 1.Pdf
Universitätsprofessor Dr. Gerhard Sauder Akademische Feier zum 75. Geburtstag von Herrn Universitätsprofessor Dr. Gerhard Sauder 13. September 2013 © 2014 universaar Universitätsverlag des Saarlandes Saarland University Press Presses Universitaires de la Sarre Postfach 151150, 66041 Saarbrücken Herausgeber Der Universitätspräsident Redaktion Universitätsarchiv mit Prof. Dr. Ralf Bogner Vertrieb Presse und Kommunikation der Universität des Saarlandes 66123 Saarbrücken ISBN 978-3-86223-135-5 URN urn:nbn:de:bsz:291-universaar-1177 Satztechnik: David Lemm Fotos: Jörg Pütz (Umschlag), Dr. Gregor Scherf (Portrait) Druck: Universitätsdruckerei 5 Inhalt Vorbemerkung 7 Priv.-Doz. Dr. Sascha Kiefer, Universität des Saarlandes Grußwort 9 Prof. Dr. Volker Linneweber, Präsident der Universität des Saarlandes Grußwort 13 Prof. Dr. Dr. h.c. Roland Marti Dekan der Philosophischen Fakultät II – Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaften der Universität des Saarlandes Grußwort 17 Prof. Dr. Christiane Solte-Gresser, Universität des Saarlandes Grußwort 19 Prof. em. Dr. Dr. h.c. mult. Gonthier-Louis Fink, Université de Strasbourg Johann Gottfried Herder: Der Flug der Liebe 23 Dr. Julia Bohnengel, Universität des Saarlandes Johann Wolfgang Goethe: Dauer im Wechsel 27 Dr. Inge Wild, Universität Mannheim Achim von Arnim: Ritt im Mondschein 31 Priv.-Doz. Dr. Christof Wingertszahn, Goethe-Museum Düsseldorf Conrad Ferdinand Meyer: Der römische Brunnen 33 Priv.-Doz. Dr. Sascha Kiefer, Universität des Saarlandes Else Lasker-Schüler: Ein alter Tibetteppich 35 Prof. em. Dr. Reiner Wild, Universität Mannheim 6 Else Lasker-Schüler: Die Verscheuchte 39 Prof. Dr. Sabina Becker, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg Joachim Ringelnatz: Im Park 43 Prof. Dr. Matthias Luserke-Jaqui, Technische Universität Darmstadt Christa Reinig: Robinson 47 Klaus Ackermann, Gymnasium am Steinwald, Neunkirchen/ Staatliches Studienseminar, Saarbrücken Hilde Domin: Ziehende Landschaft 51 Dr. -

CURRICULUM VITAE Kathleen Lenore Komar
CURRICULUM VITAE Kathleen Lenore Komar: Distinguished Professor of Comparative Literature & German, UCLA, 2014 Member of the Executive Board of the International Comparative Literature Association 2010- President of the American Comparative Literature Association March 2005-2007 Chair of the Academic Senate of UCLA 2004-05 Vice-Chair of the Academic Senate, UCLA 2003-04 Vice-President of the American Comparative Literature Association, 2003-2005 Associate Dean of the Graduate Division, UCLA 1992-2002 Director of the Humanities Cluster Program, UCLA 1991-92 Chair of the Program in Comparative Literature UCLA 1986-89 Full Professor Step VI, Department of Comparative Literature UCLA 2003 Full Professor, Department of Germanic Languages & Program in Comparative Literature UCLA 1990- Associate Professor, Department of Germanic Languages & Program in Comparative Literature UCLA l984-1990 Assistant Professor, Department of Germanic Languages & Program in Comparative Literature UCLA l977-84 EDUCATION: 1977 Ph.D. in Comparative Literature (Major literature German, minors in English and French), PRINCETON UNIVERSITY 1975 M.A. in Comparative Literature (Major in German, minors in English and French), PRINCETON UNIVERSITY 1971-72 Study abroad at the Universities of Bonn and Freiburg. 1971 B.A. in English, Honors in the College, Special Honors in English, UNIVERSITY OF CHICAGO HONORS & RECOGNITIONS: 2014 Promoted to Distinguished Professor of Comparative Literature & German, UCLA 2014 Awarded the University of California systemwide Oliver Johnson -

Sommersemester 2017 Vorlesungszeit:18.04.2017 - 22.07.2017
Sommersemester 2017 Vorlesungszeit:18.04.2017 - 22.07.2017 Seite 1 von 318 Sommersemester 2017 gedruckt am 30.09.2017 16:15:53 Inhalte Überschriften und Veranstaltungen Überfachlicher Wahlpflichtbereich 10 Zentralinstitut Professional School of Education (PSE) 10 Modul 1: übergreifende Aspekte im Lehramt - Digitale Medien im Unterricht 10 Modul 2: übergreifende Aspekte im Lehramt 11 Career Center 13 Schlüsselkompetenzen und praxisbezogene Lehrveranstaltungen 14 Informations- und Medienkompetenz 42 Organisations- und Managementkompetenz 44 Sozial- und Methodenkompetenz 45 bologna.lab: Neue Lehre, neues Lernen 47 Berlin Perspectives - International Study Programme 47 Q-Programme 55 Q-Kolleg 55 Q-Team 57 Q-Tutorien 61 Studieren in Teilzeit 66 Modul: Data Scraping – Eine praxisorientierte Einführung 67 »Vielfalt der Wissensformen« - Interdisziplinäres Studienprogramm 67 »Vielfalt der Wissensformen«: Theorien und Geschichte (Modul 1) 67 »Vielfalt der Wissensformen«: Analysen und Methoden (Modul 2) 69 Juristische Fakultät 71 Modul Grundlagen des Rechts 71 Modul Grundkenntnisse Öffentliches Recht, insb. Grundrechte 72 Lebenswissenschaftliche Fakultät 72 Agrar- und Gartenbauwissenschaften 72 Bachelor 72 Master 73 Biologie 74 Bio 13 Forschungsfelder der Biologie - Organismische Biologie & Evolution [WiSe] 74 Bio 14 Forschungsfelder der Biologie - Molekulare Lebenswissenschaften [SoSe] 74 üWPBio Ausgewählte Themen der Biologiedidaktik (Master) [SoSe] 74 Masterprogramm Mind and Brain 75 ÜWPM von Psychologen 79 Bachelor of Science 79 Pflichtbereich