Christa Reinig
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Das 20. Jahrhundert 252
Das 20. Jahrhundert 252 Prominent 2 ! Bekannte Schriftsteller, Kritiker und Künstler Antiquariat Frank Albrecht · [email protected] 69198 Schriesheim · Mozartstr. 62 · Tel.: 06203/65713 Das 20. Jahrhundert 252 D Verlag und A Prominent 2 ! Bekannte Schriftsteller, S Antiquariat Kritiker und Künstler 2 Frank 0. J A Albrecht H Inhalt R H Belletristik ....................................................................... 1 69198 Schriesheim U Sekundärliteratur ........................................................... 31 Mozartstr. 62 N Kunst ............................................................................. 35 Register ......................................................................... 55 Tel.: 06203/65713 D FAX: 06203/65311 E Email: R [email protected] T USt.-IdNr.: DE 144 468 306 D Steuernr. : 47100/43458 Die Abbildung auf dem Vorderdeckel A zeigt eine Original-Zeichnung von S Joachim Ringelnatz (Katalognr. 113). 2 0. J A H Spezialgebiete: R Autographen und H Widmungsexemplare U Belletristik in Erstausgaben N Illustrierte Bücher D Judaica Kinder- und Jugendbuch E Kulturgeschichte R Unser komplettes Angebot im Internet: Kunst T http://www.antiquariat.com Politik und Zeitgeschichte Russische Avantgarde D Sekundärliteratur und Bibliographien A S Gegründet 1985 2 0. Geschäftsbedingungen J Mitglied im Alle angebotenen Bücher sind grundsätzlich vollständig und, wenn nicht an- P.E.N.International A ders angegeben, in gutem Erhaltungszustand. Die Preise verstehen sich in Euro und im Verband H (€) inkl. Mehrwertsteuer. -
2015 Broschüre Mit Allen Künstlern Herunterladen
JAHRES- GABEN 2015 Verein für Original-Radierung München Gedruckt mit freundlicher Unterstützung der Color Gruppe, München JAHRES- GABEN UND SONDER- EDITIONEN 2015 Verein für Original-Radierung München Präsentation Jahresgaben und Sondereditionen 2015 Eröffnung 15. Oktober, 19.00 – 21.00 Uhr Ausstellungsdauer 16. Oktober – 13. November 2015 (03. – 06. November geschlossen) Öffnungszeiten während der Ausstellungsdauer jeweils Dienstag – Freitag 15.00 – 18.30 Uhr Lange Nacht 17. Oktober 2015 geöffnet von 19.00 – 02.00 Uhr Grafik-Auktion 22. November, 16.00 Uhr (Vorbesichtigung ab 15.00 Uhr) Wolfgang Werkmeister Eröffnung 26. November, 19.00 –21.00 Uhr Ausstellungsdauer 27.11.–18.12.2015 Öffnungszeiten während der Ausstellungsdauer jeweils Dienstag – Freitag 15.00 – 18.30 Uhr Ausstellungen 2016 · Verena Appel, Monika Falke, Heehyun Jeong · Michael Kalmbach/Christoph Meckel · „unterwegs“ 125 Jahre VfOR (open art September) · Olav Christopher Jensen (Oktober, Lange Nacht) Weitere Informationen unter www.radierverein.de oder im Flyer der Initiative Münchner Galerien. Verein für Original-Radierung München e.V. Ludwigstrasse 7, im Innenhof (Souterrain) 80539 München Tel. +49 (0)89 280 884 [email protected] www.radierverein.de Gedruckt mit freundlicher Unterstützung der Color Gruppe, München September 2015 Sehr geehrte Mitglieder, und alle, die es schon lange werden wollen, heute liegt Ihnen wie immer um diese Zeit unsere aktuelle Broschüre vor. Auch dieses Jahr wieder umfangreich, weil wir aktive Mitglieder gebeten haben, sich mit Sondereditionen zu beteiligen. Zur Erinnerung: Auf den ersten drei Seiten sind die Jahresgaben abgebildet. Aus diesen Blättern können Sie eines als Gegenleistung für Ihren Mitgliedsbeitrag umsonst auswählen. Weitere Jahresgaben können Sie zudem zum Preis von jeweils sechzig Euro dazu erwerben. -

Contemporary German Literature Collection) Brian Vetruba Washington University in St Louis, [email protected]
Washington University in St. Louis Washington University Open Scholarship University Libraries Publications University Libraries 2015 Twenty-ninth Annual Bibliography 2015 (Contemporary German Literature Collection) Brian Vetruba Washington University in St Louis, [email protected] Paul Michael Lützeler Washington University in St. Louis, [email protected] Katharina Böhm Washington University in St. Louis, [email protected] Follow this and additional works at: https://openscholarship.wustl.edu/lib_papers Part of the German Literature Commons, and the Library and Information Science Commons Recommended Citation Vetruba, Brian; Lützeler, Paul Michael; and Böhm, Katharina, "Twenty-ninth Annual Bibliography 2015 (Contemporary German Literature Collection)" (2015). University Libraries Publications. 20. https://openscholarship.wustl.edu/lib_papers/20 This Bibliography is brought to you for free and open access by the University Libraries at Washington University Open Scholarship. It has been accepted for inclusion in University Libraries Publications by an authorized administrator of Washington University Open Scholarship. For more information, please contact [email protected]. Max Kade Center for Contemporary German Literature Max Kade Zentrum für deutschsprachige Gegenwartsliteratur Director: Paul Michael Lützeler Twenty-ninth Annual Bibliography 2015 Editor: Brian W. Vetruba Editorial Assistant: Katharina Böhm February 28, 2017 Washington University in St. Louis Department of Germanic Languages and Literatures Max Kade Center -

Annexure No.-83 BA (Hons) German CBCS Department of Germanic and Romance Studies, University of Delhi
Annexure No.-83 BA (Hons) German CBCS Department of Germanic and Romance Studies, University of Delhi BA (Hons) German CBCS About the Department The Department offers B.A. (Honours) CBCS courses in four different European languages, namely, French, German, Italian and Spanish. These courses have been designed adopting the Task based and Communicative Approach, i.e. the latest Foreign Language Teaching methodology, in order to enable learners to attain the language competency levels specified by the internationally accepted Common European Framework of Reference for Languages (CEF), developed by the European Council. All the four programs follow a common structure, prescribed by the UGC guidelines on Choice Based Credit System. Each course aims at imparting specific linguistic skills as well as life skills that would help learners to communicate effectively in real life situations. Our endeavor is to integrate real life communicative situations in the language class rooms with the help of concrete tasks and project based collaborative teaching-learning. The B.A. (Honours) CBCS programs serve the following purposes: Develops communication skills in the chosen language and helps to acquire a broad understanding of the society, history and culture within which these languages have developed and are used. Integrates knowledge of social and political institutions, historical events, and literary and cultural movements into the acquisition of the four linguistic skills - reading, writing, listening and speaking. Develops language skills and critical thinking. Enables students to attain B2 level at the end of the program by completing stages of language learning specified by the internationally accepted Common European Framework of Reference for Languages (CEF), developed by the European Council. -

Erinnern Und Geschlecht Band I
Erinnern und Geschlecht Freiburg i.Br. Band I jos fritz verlag Ausgabe 19 Freiburger 2006 FrauenStudien Zeitschrift für Interdisziplinäre Frauenforschung Freiburger FrauenStudien 19 Herausgeberin der Reihe: Zentrum für Anthropologie und Gender Studies (ZAG)/ Abteilung Gender Studies. Herausgeberin der Ausgabe 19: Meike Penkwitt. Wissenschaftliche Leitung: Prof. Dr. Nina Degele, Prof. Dr. Joseph Jurt, Prof. Dr. Eva Manske. Die Verantwortung für die einzelnen Beiträge liegt bei den jeweiligen AutorInnen. Redaktion: Franziska Bergmann, Christina Bermann-Harms, Ruth Brand, Ursula Degener, Dr. Stefanie Duttweiler, Annegret Erbes, Dr. Regula Giuliani, Dr. Martina Grimmig, Liane Grieger, Mona Hanafi El Siofi, Irmtraud Hnilica, Antonia Ingelfinger, Gertraud Lenz, Jennifer Moos, Meike Penkwitt, Dr. Tina-Karen Pusse, Eva Voß, Nina Wehner. Öffentlichkeitsarbeit: Franziska Bergmann, Jennifer Moos, Meike Penkwitt. Umschlaggestaltung: Marion Mangelsdorf. Satz: Christoph Gebler, Coral Romà Garcia, Elmar Laubender. Abbildungen: Neun Musen von Bettina Eichin. Fotos: Jennifer Moos. Bildbearbeitung: Bernd Penkwitt. Verlag: jos fritz Verlag, Wilhelmstr. 15, 79098 Freiburg. Druck: Hausdruckerei der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i. Brsg. Umschlagsdruck: Druckwerkstatt im Grün, Auflage: 350. Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen National- bibliographie; Detaillierte Daten sind im Internet unter http://dnb.ddb.de abrufbar. Dieses Werk einschließlich seiner Teile ist urheberrechtlich -

Figuring Lateness in Modern German Culture
Figuring Lateness in Modern German Culture Karen Leeder Time . to die —Blade Runner An interest in “late style” as a category has long been important in musicology and art history. The last decade or so has seen the growing significance of this approach in cultural and literary studies, especially in light of Edward W. Said’s influential volume On Late Style (2006), which brought the ideas into general circulation. This interest both reflects and feeds into the growth of a new discipline that might be termed “humanistic (or cultural) gerontology” and operates at the intersection of humanities, medical science, and social sci- ences.1 In the United States the new discipline has led the way in analyzing the implication of aging across a broad interdisciplinary spectrum, with numerous publications on aging and creativity, old-age style, “late style,” and the impor- tance for culture and philosophy of the notion of late work. This field has a special resonance in Europe where work is also begin- ning. If the interest in the United States is arguably led by the aging academy 1. Edward W. Said, On Late Style (London: Bloomsbury, 2006). Hereafter cited as OLS. See also Robert Butler, “The Life Review: An Interpretation of Reminiscence in the Aged,” Psychiatry 26 (1963): 65–76; Marion Perlmutter, ed., Late Life Potential Washington, DC: Gerontological Soci- ety of America, 1990); Martin S. Lindauer, Aging, Creativity, and Art: A Positive Perspective on Late-Life Development (New York: Kluwer, 2003); Stephen Katz, Cultural Aging: Life Course, Lifestyle, and Senior Worlds (Peterborough, ON: Broadview, 2005); David W. -

Zur Neueren Lyrik Christa Reinigs. –
Zeit der Weiblichkeit? – Zur neueren Lyrik Christa Reinigs. – Beginnen wir mit drei Zitaten von Christa Reinig: Drei typen hab ich gerne: einen heterosexuellen, der über die homosexualität phantasiert, einen mann guten willens, der den frauen zur emanzipation verhelfen will, und einen linken professor, der über die menschlichkeit und nächstenliebe der proletarier doziert. 1[Christa Reinig: „Theweleit-Phantasien“, in: Christa Reinig: Der Wolf und die Witwen. Erzählungen und Essays, München, 1981 (1979), S. 36–45; S. 45] 4 MITTWOCH Was denkst du? – Dich! Bist du traurig? – Ich bin glücklich als ich noch nicht lieben konnte habe ich viel gelacht 5 DONNERSTAG Sie ist wieder nicht gekommen ich schließe das fenster es gibt nichts getreues außer den bildern 2[Christa Reinig: Sämtliche Gedichte. Mit einem Vorwort von Horst Bienek, Düsseldorf, 1984, S. 111. – Zitate aus diesem Band im folgenden Text: SG und Seitenzahl.] Das Prosa-Zitat entstammt einer Rezension von Theweleits Männerphantasien vom Ende der siebziger Jahre. Die beiden Vierzeiler sind dem Zyklus Müßiggang ist aller Liebe Anfang (1979) entnommen, von dem vor allem die Rede sein soll. Dabei nehme ich die Abweisungen der Autorin ernst; ich möchte zu zeigen versuchen, warum ich ihr nicht gehorchen kann. Natürlich kommt mir der Vorzug der poetischen Sprache zu Hilfe, daß sie ihre Wirklichkeit selbst schafft, so mimetisch sie sich auch gibt, und daß diese Wirklichkeit Kommunikation nur dem verweigern kann, der sich nicht mit ihr in ein hermeneutisches Gespräch einläßt, der sie also, schlicht gesagt, mißversteht. Daß man sich immer um das Verständnis des zunächst fremden bemühen muß, ist eine Binsenweisheit. Ebenso, daß immer ein mehr oder weniger bedeutender Rest bleibt, den man sich nicht aneignen kann. -
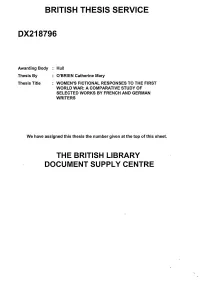
Hull Thesis By
BRITISH THESIS SERVICE DX218796 Awarding Body : Hull Thesis By : O'BRIEN Catherine Mary Thesis Title : WOMEN'S FICTIONAL RESPONSES TO THE FIRST WORLD WAR: A COMPARATIVE STUDY OF SELECTED WORKS BY FRENCH AND GERMAN WRITERS We have assigned this thesis the number given at the top of this sheet. THE BRITISH LIBRARY DOCUMENT SUPPLY CENTRE . DEPARTMENT. ................... DEGREE NAME-C.. ..... G-es ........ tv'. u. /, - THE UNIVERSITY O HULL Deposit of thesis in accordance with Senate Minute 131,1955/56, 141,1970/1 and 343,1988/89 C- M I l) R`ý hereby give m consent that a copy of my thesis g. Dc, -1D -__ ýV\, If accepted for the degree of .. V in the University of Hull and thereafter deposited in the University Library shall be available for consultation, interlihrar Ioan and photoco ying at the discretion of the University Librarian Signalure/__'' L If, by reason of special circumstances, the author wishes to withhold for a period of not more than five years from the date of the degree being awarded the consent required by Senate, and if for similar reasons lie or she does not wish details of the thesis to be included in the University Library's catalogues or forwarded to any indexing or abstracting organisation, he or she should complete and sign sections (1) and (2) below, as appropriate (1) 1 wish access to my thesis to be withheld until for the following reason Signature (2) I further wish that full details of the title and subject of my thesis are not to be included in the University Library's catalogues or forwarded to any indexing -

Sommersemester 2017 Vorlesungszeit:18.04.2017 - 22.07.2017
Sommersemester 2017 Vorlesungszeit:18.04.2017 - 22.07.2017 Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät Unter den Linden 6, 10099 Berlin, Sitz: Dorotheenstr. 24, 10117 Berlin Dekanin Prof. Dr. phil. Ulrike Vedder, DOR 24, 3.501, Tel. 2093-9712 Dekanatssekretärin Sibylle Weiß, DOR 24, 3.202, Tel. 2093-9604, Fax 2093-9601 Prodekanin für Lehre und Studium Prof. Dr. Alfrun Kliems, DOR 65, 529, Tel. 2093-5176 Prodekanin für Forschung Prof. Dr. phil. Anke Lüdeling, DOR 24, 3.342, Tel. 2093-9799 Verwaltungsleiterin Dr. phil. Annegret van Mörbeck, DOR 24, 3.344, Tel. 2093-9603, Fax 2093-9602 stellvertr. Verwaltungsleiterin Else Engelhardt, DOR 65, 458, Tel. 2093-5100 Frauenbeauftragte PD Dr. phil. Anna Helene Feulner, DOR 24, 3.213, Tel. 2093-9779 Dekanatsassistentin Laura Hausmann, DOR 24, 3.309, Tel. 2093-9604 Lehre und Studium Referentin für Lehre und Studium Dr. phil. Barbara Gollmer, DOR 24, 3.205, Tel. 2093-9606, Fax 2093-9602 Studentische Studienfachberaterin Stefanie Meißner, DOR 24, 3.206, Tel. 2093-9735 Koordinatorin für internationale Angelegenheiten M.A. Stephanie Trigoudis, DOR 24, 3.411, Tel. 2093-9798 Sprechzeit: Do 13-15 Leiter der Praktikumsbörse "Sprungbrett" Dr. phil. Rainer Fecht, FRS191, 3008B, Tel. 2093-70504, Fax 2093-70640 Promotionsangelegenheiten Vorsitzender Prof. Dr. phil. Markus Egg, UL 6, 2008A, Tel. 2093-2295 Sachbearbeiterin Uta Kabelitz, DOR 24, 3.208, Tel. 2093-9688 Prüfungsausschuss Fremdsprachliche Philologien Vorsitzender Prof. Dr. phil. Lutz Küster, DOR 65, 427, Tel. 2093-5123, Fax 2093-5125 Vorsitzender Prof. Dr. phil. Markus Asper, UL 6, 3067A, Tel. 2093-70430, Fax 2093-70436 Sachbearbeiterin für Prüfungsangelegenheiten Katharina Bordiehn, DOR 65, 476, Tel. -

Das 20. Jahrhundert 214
Das 20. Jahrhundert 214 Ein Jahrhundert im Rückblick. Teil XVII: 1971-1974 sowie viele Neueingänge Antiquariat Frank Albrecht · [email protected] 69198 Schriesheim · Mozartstr. 62 · Tel.: 06203/65713 Das 20. Jahrhundert 214 D Verlag und A Ein Jahrhundert im Rückblick S Antiquariat Teil XVII: 1971-1974 2 sowie viele Neueingänge 0. Frank J A Albrecht H Inhalt R H 1971 .............................................................................. 1 69198 Schriesheim U 1972 .............................................................................. 8 Mozartstr. 62 1973 ............................................................................ 16 N 1974 ............................................................................ 22 Tel.: 06203/65713 D Neueingänge ................................................................ 30 FAX: 06203/65311 E Register ....................................................................... 49 Email: R [email protected] T USt.-IdNr.: DE 144 468 306 D Die Abbildung auf dem Vorderdeckel Steuernr. : 47100/43458 A zeigt eine Original-Lithographie S von Marc Chagall aus Katalognr. 331. 2 0. J A H Spezialgebiete: R Autographen und H Widmungsexemplare U Belletristik in Erstausgaben N Illustrierte Bücher D Judaica E Kinder- und Jugendbuch Unser komplettes Angebot im Internet: R Kulturgeschichte http://www.antiquariat.com Kunst T Politik und Zeitgeschichte Russische Avantgarde Sekundärliteratur D und Bibliographien A S Geschäftsbedingungen Gegründet 1985 2 0. Alle angebotenen Bücher sind grundsätzlich -

Lyrische Dialektik Von Ulrich Dittmann (München)
Lyrische Dialektik von Ulrich Dittmann (München) Lieber Wolfgang, meine sehr verehrten Damen und Herren, Professor Wiesmüller und ich, wir kennen uns über einen ganzen Generationszeitraum, d.h. vor mehr als dreißig Jahren kamen wir erstmals dank der editorischen Arbeit an Stifters Prosa zusammen. Mit einem Thema aus der Lyrik überschreite ich auf Wunsch der Veranstalter unsere durch die professionelle Kooperation definierten Gattungsgrenzen. Ich tue das gerne, liegt doch ein unprofessioneller Anlass vor, zu dem ich auch sehr gerne angereist bin. Mein Thema klingt anspruchsvoll theoretisch, es wird Ihnen hier jedoch keine Theorie kreiert werden, davon hat meine Generation genug produziert; den Begriff „dialektisch“ drängten mir Texte auf, von denen ich Ihnen zwei vorstellen möchte. Ich konnte mich mit ihnen immerhin so weit identifizieren, dass ich sie wiederholt in meinen Seminaren und germanistischen Einführungskursen an der Ludwig-Maximilians-Universität verwendete. Durchaus in didaktischer Absicht ging es mir darum, den Studierenden die Vorurteile auszutreiben, die ihnen – notgedrungen, weil von Vertretern meiner Generation unterrichtet – den Zugang zu weiten Bereichen der Lyrik einschränkten oder ganz verbauten. In gewisser Weise waren also die Wahl der Texte und die Beschäftigung mit ihnen, auch eine Befreiungsreaktion auf Erfahrungen meines vor mehr als 50 Jahren, vor allem durch Gedichtlektüre motivierten Studienbeginns. Außerdem gab es zu den beiden von mir für diesen Anlass ausgewählten Texten außerfachliche Ereignisse, die sie mir nahe brachten. Ich werde davon berichten, zunächst aber zum Hintergrund meiner Textwahl aus aktiver Unterrichtszeit und für den heutigen Anlass. Bei meinem Studienanfang war Emil Staiger dank seiner Grundbegriffe der Poetik der Papst des Faches und Wolfgang Kayser sein Sprachrohr; dessen Buch Das sprachliche Kunstwerk lehrte uns ganz dogmatisch: Beim lyrischen Sprechen „ist alles Innerlichkeit. -
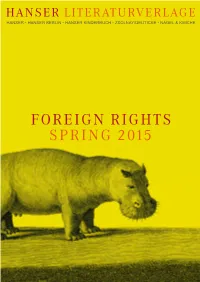
Spring 2015 Foreign Rights
HANSER LITERATURVERLAGE HANSER • HANSER BERLIN • HANSER KINDERBUCH • ZSOLNAY/DEUTICKE • NAGEL & KIMCHE FOREIGN RIGHTS SPRING 2015 REPRESENTATIVES China (mainland) Hercules Business & Culture GmbH, Niederdorfelden phone: +49-6101-407921, fax: +49-6101-407922 e-mail: [email protected] Hungary Balla-Sztojkov Literary Agency, Budapest phone: +36-1-456 03 11, fax: +36-1-215 44 20 e-mail: [email protected] Israel The Deborah Harris Agency, Jerusalem phone: +972-2-5633237, fax: +972-2-5618711 e-mail: [email protected] Italy Marco Vigevani, Agenzia Letteraria, Milano phone: +39-02-86 99 65 53, fax: +39-02-86 98 23 09 e-mail: [email protected] Italy: Children’s Books Anna Becchi, Genova phone: +39-010-2512186 e-mail: [email protected] Japan Meike Marx Literary Agency, Hokkaido phone: +81-164-25 1466, fax: +81-164-26 38 44 e-mail: [email protected] Korea MOMO Agency, Seoul Dietmar Katz phone: +82-2-337-8606, fax: +82-2-337-8702 / e-mail: [email protected] Netherlands LiTrans, Tino Köhler, Amsterdam phone: +31-20- 685 53 80, fax: +31-20- 685 53 80 e-mail: [email protected] Poland Graal Literary Agency, Warszawa phone: +48-22-895 2000, fax: +48-22-895 2001 e-mail: [email protected] Romania Simona Kessler, International Copyright Ageny, Ltd., Bucharest phone: +402-2-231 81 50, fax: +402-2-231 45 22 e-mail: [email protected] Scandinavia Leonhardt & Høier Literary Agency aps, Kopenhagen phone: +45-33 13 25 23, fax: +45-33 13 49 92 e-mail: [email protected] Spain, Portugal A.C.E.R., Agencia