Erinnern Und Geschlecht Band I
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Christa Reinig
Darstellung und Auflösung von Lebensproblemen im Werk: Christa Reinig Inaugural-Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades des Fachbereichs III der Universität Siegen vorgelegt von Sibylle Scheßwendter, Kassel, im Jahre 2000 I Darstellung und Auflösung von Lebensproblemen im Werk: Christa Reinig INHALT: Vorwort (S.1-3) A. Krieg und Tod I. Kriegstrauma: Krieg und Tod als Themen des Jugendwerkes (S45) 1) Christa Reinigs ”tiefstes Herz” in seiner Entwicklung (S.4) a) ”Das Jahr 1945” (S.5) b) ”der traum meiner verkommenheit” (S.7) 2) Das Kriegstrauma als metaphorischer Boden für die frühe Lyrik und Prosa (S.8) a) ”In die Gewehre rennen”( S.8) b) Tod, Mystik und Buddhismus (S.11) c) Spruchdichtung (S.14) d) ”Der Teufel, der stumm bleiben wollte” (S.14) e) Todesstrafe: ”Japanische Bittschrift” (S.16) f) ”Ödipus Ichtöter”, ”Einige Fahrstühle”, frühe Prosastücke (S.18) g) ”Die Ballade vom blutigen Bomme” (S.20) h) Ringelnatz und Reinig (S.24) 3) Zusammenfassung (S.26) II. Bewältigung in Phasen (S.26) 1) Bildliche Erweiterung zur Raum- und Weltraumthematik in “Orion trat aus dem Haus. Neue Sternbilder” (S.28) II 2) Abrechnung mit dem tradierten Christentum in ”Columba.Taube” (S.30) 3) Einschub: Vergleich mit Ingeborg Bachmanns Kriegs- und Todesbegriff in Lyrik und Prosa und Virginia Woolfs ”Mrs. Dalloway” (S.30) a) Ingeborg Bachmann, ”Einem Feldherrn”, ”Alle Tage”, ”Todesarten” (S.31) b) Virginia Woolfs Septimus Warren Smith (S.31) 4) Umschichtung der Sterblichkeitserfahrung durch Sapphos Dichtung und eine neue matriarchale Frömmigkeit in ”Die Frau im Brunnen” (S.33) 5) Enttraumatisierende Liebe in ”Müßigggang ist aller Liebe Anfang“ (S.35) III. Zusammenfassung (S.37) B. -

Figuring Lateness in Modern German Culture
Figuring Lateness in Modern German Culture Karen Leeder Time . to die —Blade Runner An interest in “late style” as a category has long been important in musicology and art history. The last decade or so has seen the growing significance of this approach in cultural and literary studies, especially in light of Edward W. Said’s influential volume On Late Style (2006), which brought the ideas into general circulation. This interest both reflects and feeds into the growth of a new discipline that might be termed “humanistic (or cultural) gerontology” and operates at the intersection of humanities, medical science, and social sci- ences.1 In the United States the new discipline has led the way in analyzing the implication of aging across a broad interdisciplinary spectrum, with numerous publications on aging and creativity, old-age style, “late style,” and the impor- tance for culture and philosophy of the notion of late work. This field has a special resonance in Europe where work is also begin- ning. If the interest in the United States is arguably led by the aging academy 1. Edward W. Said, On Late Style (London: Bloomsbury, 2006). Hereafter cited as OLS. See also Robert Butler, “The Life Review: An Interpretation of Reminiscence in the Aged,” Psychiatry 26 (1963): 65–76; Marion Perlmutter, ed., Late Life Potential Washington, DC: Gerontological Soci- ety of America, 1990); Martin S. Lindauer, Aging, Creativity, and Art: A Positive Perspective on Late-Life Development (New York: Kluwer, 2003); Stephen Katz, Cultural Aging: Life Course, Lifestyle, and Senior Worlds (Peterborough, ON: Broadview, 2005); David W. -

German Actresses of the 2000S – a Study of Female Representation, Acting and Stardom
German Actresses of the 2000s – A Study of Female Representation, Acting and Stardom Verena von Eicken Doctor of Philosophy University of York Theatre, Film and Television September 2014 Abstract This thesis centres on four German actresses active from the year 2000: Nina Hoss, Sandra Hüller, Sibel Kekilli and Diane Kruger. These performers have embodied a range of multifaceted female characters, as well as offering insightful representations of ‛Germanness’ at home and abroad. Their films are emblematic of the revival of German cinema in the 2000s, which has seen the proliferation of commercially successful historical dramas and the emergence of the critically lauded Berlin School art film movement. This research seeks to contribute to German film studies by considering the role actresses have played in the context of the resurging German cinema of the new millennium. The four actresses are discussed both in terms of the female representations offered by their films, and as performers and stars. The films of Nina Hoss, Sandra Hüller and Sibel Kekilli explore the particular social, political and cultural circumstances of women in contemporary Germany, such as the ramifications of reunification and a changing economic order, the persistent female inequality in the workplace and the family, and the nationally specific conception of the mother role. Contributing to the study of film acting and performance, analyses of the four actresses’ performances are conducted to demonstrate how they enhance the films. Analysing and comparing the work of actresses from the 1920s until the present day, a German screen acting tradition is identified that is characterised by the actresses’ maintenance of a critical distance to the character they portray: female performers working across different decades share a stilted, non-naturalistic acting style, which imbues their characters with a sense of mastery and counteracts their frequent experience of oppression or objectification. -

Bild Reflexion Dialog
STUDIA GERMANICA GEDANENSIA 30 BILD REFLEXION DIALOG Interkulturelle Perspektiven in der Literatur und im Theater Hg. / red. Miłosława Borzyszkowska Eliza Szymańska Anastasia Telaak WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO GDAŃSK 2014 30_ramki_na zdjęcia.indd 1 2014-10-02 20:21:35 30_ramki_na zdjęcia.indd 2 2014-10-02 20:21:35 STUDIA GERMANICA GEDANENSIA 30 BILD REFLEXION DIALOG Interkulturelle Perspektiven in der Literatur und im Theater Hg. / red. Miłosława Borzyszkowska Eliza Szymańska Anastasia Telaak WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO GDAŃSK 2014 30_ramki_na zdjęcia.indd 3 2014-10-02 20:21:35 Redaktorki tomu / Herausgeberinnen Miłosława Borzyszkowska, Eliza Szymańska, Anastasia Telaak Komitet Redakcyjny / Herausgeberbeirat Andrzej Kątny, Sławomir Leśniak, Danuta Olszewska (przewodnicząca), Mirosław Ossowski, Anna Socka (sekretarz), Marian Szczodrowski Rada Naukowa / Wissenschaftlicher Beirat Bernd Ulrich Biere (Koblencja), Marek Jaroszewski (Warszawa), Hans Wolf Jäger (Brema), Stefan Michael Newerkla (Wiedeń), Christoph Schatte (Poznań) Recenzenci / Gutachter prof. dr hab. Roman Dziergwa (Poznań), Prof. Dr. Jürgen Joachimsthaler (Marburg) Adres Redakcji / Anschrift der Redaktion Instytut Filologii Germańskiej ul. Wita Stwosza 55, PL 80–952 Gdańsk E-Mail: [email protected] Projekt okładki i stron tytułowych/Umschlag- und Titelseitengestaltung Maciej Ostoja-Lniski Fotografia na okładce/Umschlagsfoto: Andreas Labes (przedstawienie Teatru Migrantów/die Aufführung des Theaters der Migranten: Oppelner Straße – eine theatrale Reise auf den -

Sociology and the Diagnosis of the Times Or : the Reflexivity of Modernity
Sociology and the Diagnosis of the Times or: The Reflexivity of Modernity Klaus Lichtblau Attempting to orient oneself according to history while it is happening would be like trying to hold on to the waves during a shipwreck. (Löwith, 1960: 163) The subject is not only inexhaustible, but also indeterminate. because it mutates as soon as it is conceived. Situations from past history that have produced their event and no longer exist can be considered completed. One's personal situation has the stimulating feature that its thought still determines what will become of it. (Jaspers, 1978: 5) The temporalization of social self-descriptions and the perception of rapid social change presumes above all the distinction between consemative and progressive tendencies. Conservatives begin with disappointment, progressives end with disappointment, but all of them suffer from the times and agree on that much. The crisis becomes general. In the limiting case, the description of society shrivels down to a 'definition of the situation'. Even in the case of unambiguous data, the latter can always be constructed controversially. (Luhmann, 1987a: 167) POSTmodernISM Situational analyses that seek to make a diagnosis of the times are necessarily prone to a variety of risks in the. age of 'risk society' (Klages, 1966; Joas, 1988). In itself, the literary genre of the 'diagiosis of the times' is certainly no privilege of sociology as such; instead, it possesses a long tradition of its own in intellectual history. That bistory is expressed both in the various philosophical and culture-critical attempts to read the 'character of the times', and in the literary, aesthetic and journalistic reflections on the concep- tually amorphous and often whimsical 'spirit of the times' (cf. -
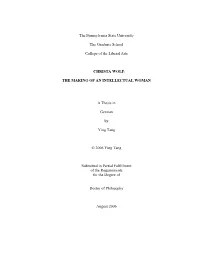
Open Dissertation Ying June06.Pdf
The Pennsylvania State University The Graduate School College of the Liberal Arts CHRISTA WOLF: THE MAKING OF AN INTELLECTUAL WOMAN A Thesis in German by Ying Tang © 2006 Ying Tang Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy August 2006 The thesis of Ying Tang was reviewed and approved* by the following: Cecilia Novero Assistant Professor of German, Comparative Literature and Women’s Studies Thesis Adviser Chair of Committee Daniel Purdy Associate Professor of German Literature Joan B. Landes Ferree Professor of Early Modern History and Women’s Studies Hartmut Heep Associate Professor of German, Comparative Literature Adrian Wanner Professor of Russian and Comparative Literature Head of the Department of Germanic and Slavic Languages and Literatures *Signatures are on file in the Graduate School. ABSTRACT Christa Wolf, a GDR intellectual, was discredited as a writer after German Unification. In 1990, she was at the center of a controversy that started around her publication of a novel titled Was bleibt (What remains). The controversy expanded to consider more generally the role of the Stasi (secret police) in GDR culture and affected in particular the generation of GDR writers born around 1930, who were not dissidents, and had not left the country in the 40 years of its existence. Prior to the demise of the GDR, Wolf’s stories, novels and essays, as well as her political interventions during 1989, were highly considered for their moral and political standing and she was regarded, especially by feminist and progressive intellectuals, as one of the few women intellectuals of the 20th century, among the likes of Simone de Beauvoir and Hannah Arendt. -

Kacunko Eva04.Indb
edition video art Band 4 eva – edition video art Band 4 Herausgeberschaft: Marcel Odenbach Professor für Film und Video, Staatliche Kunstakademie Düsseldorf Yvonne Spielmann Professorin für Medien, Kunst, Kultur, Institut für Professionelle Karriereentwicklung Slavko Kacunko Professor für Kunstgeschichte und Visuelle Kultur, Universität Kopenhagen, Dänemark Slavko Kacunko (Hg.) THEORIEN DER VIDEOKUNST Theoretikerinnen 2004–2018 λογος eva — edition video art Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. © Copyright Logos Verlag Berlin GmbH 2018 Alle Rechte vorbehalten. Diese Publikation ist gefördert durch: Gerda-Weiler-Stiftung für feministische Frauenforschung e.V. D-53894 Mechernich, www.gerda-weiler-stiftung.de Kunststiftung NRW Gestaltung: Florian Hawemann, Berlin ISBN 978-3-8325-4606-9 ISSN 2193-715X Logos Verlag Berlin GmbH Comeniushof, Gubener Str. 47, D-10243 Berlin Tel.: +49 (0)30 42 85 10 90 Fax: +49 (0)30 42 85 10 92 INTERNET: http://www.logos-verlag.com Vorwort der Herausgeberschaft Liebe Leserinnen und Leser, wir freuen uns, den vierten Band der eva – edition video art zu präsentieren. Es han- delt sich um die thematische und chronologische Fortsetzung des dritten Bandes, in dem die wichtigen deutschsprachigen Ansätze zur Theorie der Videokunst zwi- schen 1988 und 2003 zusammengefasst sind. Der vorliegende Sammelband umfasst 19 Originalbeiträge von 19 Autorinnen, die zwischen 2004 und 2018 entstanden sind. Denjenigen Leserinnen und Lesern, die sich besonders für Systematisierung und Historisierung der gesammelten Texte interessieren, wird der einleitende Aufsatz zum dritten Band empfohlen (Theoretikerinnen der Videokunst im deutschsprachigen Raum. Aspekte einer Annährung). -

Feministische Gesellschaftskritik in Friederike Roths Dramen Ritt Auf
Feministische Gesellschaftskritik in Friederike Roths Dramen Ritt auf die Wartburg. Krötenbrunnen. Die einzige Geschichte. Das Ganze ein Stück und Erben und Sterben. DISSERTATION Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy in the Graduate School of The Ohio State University By Rosalinde Girtler, H.A. * * * * * The Ohio State University 1995 Dissertation Committe: Approved by Dagmar C. G. Lorenz Leslie Adelson Va a m &J Adviser Helen Fehervary Def&rtment of Germanic Languages and Literatures UMI Number: 9533975 Copyright 1995 by Girtler, Rosalinde All rights reserved. UMI Microform 9533975 Copyright 1995, by UMI Company. All rights» reserved. This microform edition is protected against unauthorized copying under Title 17, United States Code. UMI 300 North Zeeb Road Ann Arbor, MI 48103 Copyright by Rosalinde Girtler 1995 To my parents Berti and Giovanni ii ACKNOWLEDGEMENTS I wish foremost to thank Dr. Dagmar C. G. Lorenz for guiding and encouraging me through this project and for her consistent promptness in returning draft chapters with critical and insightful comments. Thanks go also to the other members of my dissertation committee, Dr. Helen Fehervary and Dr. Leslie Adelson for their reading and encouragement. I would also like to thank all of my friends and roommates who were there when I needed them, helping me keep my confidence and perspective. VITA May 7, 1 9 6 1 ..................... Born— Br ixen, Italy 1983-1986 ....................... Study of German, English, and American Literature, University of Innsbruck, Innsbruck, Austria 1986 .............................. 1. Diplomprüfung (B.A.), University of Innsbruck, Innsbruck, Austria 1986-1992 ....................... Graduate Associate, Department of Germanic Languages and Literatures, The Ohio State University 1988 .............................