Der Erinnerung Namen Geben
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Immigrants I Through K
I Iager, John, Switzerland, came to the county in 1865, in Newton County 1882 Atlas, patrons, from Missouri Pioneers Volume XVI Iberg, Jacob, Switzerland, 81, in the 1900 Federal Census of Newton CO, MO, Neosho Township Iburg, Herman C., Germany, 54, in the 1910 Federal Census of St. Clair CO, MO, Jackson Township. Also, Herman C. Iburg, Oenhousen [Oeynhausen ?], Germany, born February 23, 1855 [MO death certificate] died October 3, 1910, in St. Clair County, father John Iburg, mother Christina Daniels, informant Mrs. Herman C. Iburg Ihde, William, Petersdorf Cris Templen, Germany, from a 1915 petition for naturalization, McDonald County, Missouri, from Missouri Pioneers Volume XXVIII. Also, William Ihde, Germany, 59, in the 1920 Federal Census of McDonald CO, MO, Cyclone Ikenruth, Adam, Germany, 52, in the 1910 Federal Census of Cedar CO, MO, Linn Township Iker, Joseph, Baden, Germany, 37, in the 1870 Federal Census of Hickory CO, MO, Montgomery Township Iles, Thomas, England, 60, in the 1910 Federal Census of Dade CO, MO, Grant Township. [On son William Carl Iles’ MO death certificate from Dade County father is listed as Thomas Iles born in England and mother Ellen Perr__man[?] ] Imme, Adolph, Germany, 55, in the 1900 Federal Census of Jasper CO, MO, Webb City Immel, John, Germany, born January 28, 1834 [MO death certificate] died August 24, 1917, in Joplin, Jasper County. And, 68, in the 1900 Federal Census of Jasper CO, MO, Joplin Immel, Mrs. Katherine, Germany, born October 7, 1849 [MO death certificate] died June 1, 1933, in Joplin, Jasper County, father Christian Miller, mother Marie Hoffman, husband [deceased] John Immel Inch, Jack, England, 32, born May, 1868, in the 1900 Federal Census of Lawrence CO, MO, Vineyard Township Indermuehle, Gottlieb, Canton Bern, Switzerland, born March 14, 1830 [MO death certificate] died March 4, 1912, in Laclede County, father Christain Indermuehle, informant J. -

Heppenheim Gültig Ab 09.12.2018 Liniennetzplan Nördliche Bergstraße – Heppenheim
www.vrn.de Fahrplan Nördliche Bergstraße – Heppenheim gültig ab 09.12.2018 Liniennetzplan Nördliche Bergstraße – Heppenheim Heppenheim - Lampertheim Heppenheim - Lorsch - Bürstadt Heppenheim - Fürth - Grasellenbach Heppenheim - Bensheim - Zwingenberg - Alsbach Bahnhof - Gunderslache - Nordstadt - Bahnhof Bahnhof – Graben - Kreis- krankenhaus – Weststadt Heppenheim - Erbach - Juhöhe Heppenheim - Laudenbach - Ober-Laudenbach Heppenheim - Hambach - Ober-Hambach Heppenheim - Rimbach - Fürth 6967 Heppenheim – Kirschhausen – Sonderbach Stand: 12/2018 | Stand: 6986 Heppenheim - Erbach 6987 Heppenheim - Lau- denbach – Ober-Laudenbach 6991 Heppenheim - Hambach - Ober-Hambach 6968 Heppenheim - Mit- tershausen – Scheuerberg Legende Haltestelle Haltestelle nur in eine Richtung Bahn Endstation Umsteigemöglichkeiten Schulverkehr Liniennummer Liniennetzplan Nördliche Bergstraße – Heppenheim Heppenheim - Lampertheim Heppenheim - Lorsch - Bürstadt Heppenheim - Fürth - Grasellenbach Heppenheim - Bensheim - Zwingenberg - Alsbach Bahnhof - Gunderslache - Nordstadt - Bahnhof Bahnhof – Graben - Kreis- krankenhaus – Weststadt Heppenheim - Erbach - Juhöhe Heppenheim - Laudenbach - Ober-Laudenbach Heppenheim - Hambach - Ober-Hambach Heppenheim - Rimbach - Fürth 6967 Heppenheim – Kirschhausen – Sonderbach Stand: 12/2018 | Stand: 6986 Heppenheim - Erbach 6987 Heppenheim - Lau- denbach – Ober-Laudenbach 6991 Heppenheim - Hambach - Ober-Hambach 6968 Heppenheim - Mit- tershausen – Scheuerberg Legende Haltestelle Haltestelle nur in eine Richtung Bahn Endstation Umsteigemöglichkeiten -
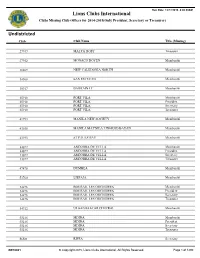
All Clubs Missing Officers 2014-15.Pdf
Run Date: 12/17/2015 8:40:39AM Lions Clubs International Clubs Missing Club Officer for 2014-2015(Only President, Secretary or Treasurer) Undistricted Club Club Name Title (Missing) 27947 MALTA HOST Treasurer 27952 MONACO DOYEN Membershi 30809 NEW CALEDONIA NORTH Membershi 34968 SAN ESTEVAN Membershi 35917 BAHRAIN LC Membershi 35918 PORT VILA Membershi 35918 PORT VILA President 35918 PORT VILA Secretary 35918 PORT VILA Treasurer 41793 MANILA NEW SOCIETY Membershi 43038 MANILA MAYNILA LINGKOD BAYAN Membershi 43193 ST PAULS BAY Membershi 44697 ANDORRA DE VELLA Membershi 44697 ANDORRA DE VELLA President 44697 ANDORRA DE VELLA Secretary 44697 ANDORRA DE VELLA Treasurer 47478 DUMBEA Membershi 53760 LIEPAJA Membershi 54276 BOURAIL LES ORCHIDEES Membershi 54276 BOURAIL LES ORCHIDEES President 54276 BOURAIL LES ORCHIDEES Secretary 54276 BOURAIL LES ORCHIDEES Treasurer 54912 ULAANBAATAR CENTRAL Membershi 55216 MDINA Membershi 55216 MDINA President 55216 MDINA Secretary 55216 MDINA Treasurer 56581 RIFFA Secretary OFF0021 © Copyright 2015, Lions Clubs International, All Rights Reserved. Page 1 of 1290 Run Date: 12/17/2015 8:40:39AM Lions Clubs International Clubs Missing Club Officer for 2014-2015(Only President, Secretary or Treasurer) Undistricted Club Club Name Title (Missing) 57293 RIGA RIGAS LIEPA Membershi 57293 RIGA RIGAS LIEPA President 57293 RIGA RIGAS LIEPA Secretary 57293 RIGA RIGAS LIEPA Treasurer 57378 MINSK CENTRAL Membershi 57378 MINSK CENTRAL President 57378 MINSK CENTRAL Secretary 57378 MINSK CENTRAL Treasurer 59850 DONETSK UNIVERSAL -

Wege Aus Der Gewalt
Weitere Beratungsstellen: Wildwasser Darmstadt e.V. Allgemeiner Sozialer Dienst (Jugendamt) Beratung, Unterstützung und Hilfe bei Informations- und Beratungsdienst, Hilfen für sexualisierter Gewalt gegen Mädchen und Frauen Familien und junge Menschen u.a. Außenstelle Bensheim Alfred-Nobel-Str. 6, 68519 Viernheim Hauptstr. 81, 64625 Bensheim Telefonische Terminvereinbarung Telefonsprechstunde Tel.: 06252 - 15-5727 Mo. & Mi. 11:00 – 13:00, Di. & Do. 15:00 – 17:00 Uhr E-Mail: [email protected] Tel.: 06251 – 7057885 Offene Sprechstunde Mo. 16:00 – 17:00 Uhr Wege aus der E-Mail: [email protected] JobCenter Neue Wege Industriestr. 20-22, 68519 Viernheim ROSA Sprechzeiten: Gewalt Wohnen Schutz und Zuflucht für junge Migrantinnen Mo.-Mi. 8:00 - 15:30, Do. 8:00 – 10:00 Uhr, Tel.: 0711 – 539825 Fr. 8:00 - 11:30 Uhr E-Mail: [email protected] Tel.: 06204 - 98695-41 oder -42 - Konflikt-leit/d- E-Mail: [email protected] Scheherazade Gewalt Schutz bei Zwangsheirat Amt für Sozialwesen faden Einsperren, Kleider zerreißen, Hotline: 0800 4151616 Wohngeld, Wohnberechtigungsschein Essen verbieten, fängt Drohungen, E-Mail: [email protected] Kettelerstr. 3, 3. OG, 68519 Viernheim, Würgen, Fesseln, Besuchsverbot, Tel.: 06204 - 988-226 YASEMIN Strangulieren, nicht Haare ausreißen, Beratungsstelle für junge Migrantinnen 12-27 J. Für Männer: beim mit Waffen bedrohen, beim Tel.: 0711 – 65 86 95-26/ -27 profamilia E-Mail: [email protected] Beratungsstelle Bensheim Reden unterbrechen, sexuelle Promenadenstr. 14, 64625 Bensheim Misshandlung, Schlagen Verbrennen, Gesprächsgruppe für Jungen und Männer, die über Caritasverband Darmstadt e.V. an Allgemeine Lebensberatung (ihre) Aggressionen nachdenken wollen Geldentzug, Beschimpfungen, Treten Außenstelle: Familienbildungswerk jeden 2. -

Ihr Weg Zum Zakb
IHR WEG ZUM ZAKB Anfahrt über die A 5 aus Richtung FRANKFURT: • Ausfahrt Heppenheim auf B460 in Richtung Heppenheim/Erbach (Odw.)/Fürth/Grasellenbach nehmen • An der Gabelung rechts halten, Beschilderung in Richtung Worms/Lorsch folgen und weiter auf B460 • Nach 1,7 km links abbiegen Richtung Viernheim/Hüttenfeld/Lorsch • Nach 450 m im Kreisverkehr dritte Ausfahrt (Starkenburgring) nehmen • Nach 2,0 km links abbiegen auf Seehofstraße • Nach 3,1 km auf der L3111 rechts abbiegen und der Straße bis zum Ende folgen Anfahrt über die A 5 aus Richtung HEIDELBERG: • Ausfahrt Hemsbach in Richtung Hemsbach/Lampertheim nehmen • Links abbiegen auf Hüttenfelder Straße • Nach 3,3 km fahren Sie weiter auf Hemsbacher Straße/Lampertheimer Straße und passieren Hüttenfeld • Nach 650 m im Kreisverkehr die erste Ausfahrt nehmen • Nach 700 m im Kreisverkehr die zweite Ausfahrt nehmen • Nach 900 m links in die zweite Straße abbiegen und bis zum Ende folgen Anfahrt über die A 67 aus Richtung MANNHEIM: • Ausfahrt Heppenheim auf B460 in Richtung Heppenheim/Lorsch/Viernheim/Groß-Rohrheim/ Einhausen nehmen • Rechts abbiegen auf B460 • Nach 1,5 km rechts abbiegen Richtung Viernheim/Hüttenfeld/Lorsch • Nach 450 m im Kreisverkehr dritte Ausfahrt (Starkenburgring) nehmen • Nach 2,0 km links abbiegen auf Seehofstraße • Nach 3,1 km auf der L3111 rechts abbiegen und der Straße bis zum Ende folgen Anfahrt über die A 67 aus Richtung FRANKFURT: • Ausfahrt Lorsch auf die B47 Richtung Lorsch/Bensheim/Heppenheim nehmen • Den rechten Fahrstreifen benutzen, um die Auffahrt B460 -
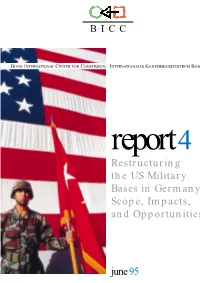
Restructuring the US Military Bases in Germany Scope, Impacts, and Opportunities
B.I.C.C BONN INTERNATIONAL CENTER FOR CONVERSION . INTERNATIONALES KONVERSIONSZENTRUM BONN report4 Restructuring the US Military Bases in Germany Scope, Impacts, and Opportunities june 95 Introduction 4 In 1996 the United States will complete its dramatic post-Cold US Forces in Germany 8 War military restructuring in ● Military Infrastructure in Germany: From Occupation to Cooperation 10 Germany. The results are stag- ● Sharing the Burden of Defense: gering. In a six-year period the A Survey of the US Bases in United States will have closed or Germany During the Cold War 12 reduced almost 90 percent of its ● After the Cold War: bases, withdrawn more than contents Restructuring the US Presence 150,000 US military personnel, in Germany 17 and returned enough combined ● Map: US Base-Closures land to create a new federal state. 1990-1996 19 ● Endstate: The Emerging US The withdrawal will have a serious Base Structure in Germany 23 affect on many of the communi- ties that hosted US bases. The US Impact on the German Economy 26 military’syearly demand for goods and services in Germany has fal- ● The Economic Impact 28 len by more than US $3 billion, ● Impact on the Real Estate and more than 70,000 Germans Market 36 have lost their jobs through direct and indirect effects. Closing, Returning, and Converting US Bases 42 Local officials’ ability to replace those jobs by converting closed ● The Decision Process 44 bases will depend on several key ● Post-Closure US-German factors. The condition, location, Negotiations 45 and type of facility will frequently ● The German Base Disposal dictate the possible conversion Process 47 options. -

Volunteer Translator Pack
TRANSLATION EDITORIAL PRINCIPLES 1. Principles for text, images and audio (a) General principles • Retain the intention, style and distinctive features of the source. • Retain source language names of people, places and organisations; add translations of the latter. • Maintain the characteristics of the source even if these seem difficult or unusual. • Where in doubt make footnotes indicating changes, decisions and queries. • Avoid modern or slang phrases that might be seem anachronistic, with preference for less time-bound figures of speech. • Try to identify and inform The Wiener Library about anything contentious that might be libellous or defamatory. • The Wiener Library is the final arbiter in any disputes of style, translation, usage or presentation. • If the item is a handwritten document, please provide a transcription of the source language as well as a translation into the target language. (a) Text • Use English according to the agreed house style: which is appropriate to its subject matter and as free as possible of redundant or superfluous words, misleading analogies or metaphor and repetitious vocabulary. • Wherever possible use preferred terminology from the Library’s Keyword thesaurus. The Subject and Geographical Keyword thesaurus can be found in this pack. The Institutional thesaurus and Personal Name thesaurus can be provided on request. • Restrict small changes or substitutions to those that help to render the source faithfully in the target language. • Attempt to translate idiomatic expressions so as to retain the colour and intention of the source culture. If this is impossible retain the expression and add translations in a footnote. • Wherever possible do not alter the text structure or sequence. -

Maps -- by Region Or Country -- Eastern Hemisphere -- Europe
G5702 EUROPE. REGIONS, NATURAL FEATURES, ETC. G5702 Alps see G6035+ .B3 Baltic Sea .B4 Baltic Shield .C3 Carpathian Mountains .C6 Coasts/Continental shelf .G4 Genoa, Gulf of .G7 Great Alföld .P9 Pyrenees .R5 Rhine River .S3 Scheldt River .T5 Tisza River 1971 G5722 WESTERN EUROPE. REGIONS, NATURAL G5722 FEATURES, ETC. .A7 Ardennes .A9 Autoroute E10 .F5 Flanders .G3 Gaul .M3 Meuse River 1972 G5741.S BRITISH ISLES. HISTORY G5741.S .S1 General .S2 To 1066 .S3 Medieval period, 1066-1485 .S33 Norman period, 1066-1154 .S35 Plantagenets, 1154-1399 .S37 15th century .S4 Modern period, 1485- .S45 16th century: Tudors, 1485-1603 .S5 17th century: Stuarts, 1603-1714 .S53 Commonwealth and protectorate, 1660-1688 .S54 18th century .S55 19th century .S6 20th century .S65 World War I .S7 World War II 1973 G5742 BRITISH ISLES. GREAT BRITAIN. REGIONS, G5742 NATURAL FEATURES, ETC. .C6 Continental shelf .I6 Irish Sea .N3 National Cycle Network 1974 G5752 ENGLAND. REGIONS, NATURAL FEATURES, ETC. G5752 .A3 Aire River .A42 Akeman Street .A43 Alde River .A7 Arun River .A75 Ashby Canal .A77 Ashdown Forest .A83 Avon, River [Gloucestershire-Avon] .A85 Avon, River [Leicestershire-Gloucestershire] .A87 Axholme, Isle of .A9 Aylesbury, Vale of .B3 Barnstaple Bay .B35 Basingstoke Canal .B36 Bassenthwaite Lake .B38 Baugh Fell .B385 Beachy Head .B386 Belvoir, Vale of .B387 Bere, Forest of .B39 Berkeley, Vale of .B4 Berkshire Downs .B42 Beult, River .B43 Bignor Hill .B44 Birmingham and Fazeley Canal .B45 Black Country .B48 Black Hill .B49 Blackdown Hills .B493 Blackmoor [Moor] .B495 Blackmoor Vale .B5 Bleaklow Hill .B54 Blenheim Park .B6 Bodmin Moor .B64 Border Forest Park .B66 Bourne Valley .B68 Bowland, Forest of .B7 Breckland .B715 Bredon Hill .B717 Brendon Hills .B72 Bridgewater Canal .B723 Bridgwater Bay .B724 Bridlington Bay .B725 Bristol Channel .B73 Broads, The .B76 Brown Clee Hill .B8 Burnham Beeches .B84 Burntwick Island .C34 Cam, River .C37 Cannock Chase .C38 Canvey Island [Island] 1975 G5752 ENGLAND. -

Liniennetzplan Ried / Nördliche Bergstraße
www.vrn.de Liniennetzplan Ried / Nördliche Bergstraße 602 Heppenheim - Lampertheim Darmstadt/Frankfurt Darmstadt 6 8 Legende 640 Bensheim - Einhausen Am Hinkelstein Im Gehren 641 Bensheim - Lorsch 641 Alsbach Buslinie mit Nummer Grenzweg Biblis - Wattenheim - Nordheim - 669 642 Europaplatz Bahnhof Orbis Hofheim - Worms Haltestelle Rathaus ÖPNV macht HP Zwingenberg 643 py 676 Stadtpark Heppenheim - Lorsch - Bürstadt Hähnlein Linde Halber Mond Haltestelle nur in eine Waage 644 Worms - Lampertheim - Viernheim Fasanenweg Richtung angefahren Christuskirche 676 Rodau Vogelherd Burggraf Bensheim - Lorsch - Einhausen - Friedhof 646 Langwaden 671 Bürstadt - Worms Zug/S-Bahn Hauptstr. Gemeinschaftshaus Im Wiesengrund Heinrichstr. Auerbach Otto-Beck-Str. Bobstadt - Bürstadt Bf -Mitte - 5 Straßenbahnlinie Post 652 Am Niederwald Boxheimerhof/Alfred-Delp-Str. mit Nummer Frankfurt Bahnhof Groß-Rohrheim Waldstr. Fehlheim Ernst-Moritz- Beh.hilfe Bergstr./ Arndt-Str. Kronepark 655 Lampertheim - Bürstadt - Riedrode Bahnhof 645 Kirche 611 Stadt-/Schulbuslinie Mühlgrabenstr. Schillerstr. 647 Scheffelstr. Bensheim - Lautertal - Lindenfels - Geschwister-Scholl-Schule/ Richard- 665 Taunusstr. Reichelsheim Orte Biblis Weyrichstr. Strauss-Str. Lorsch Hochhaus Rathausstr. Bahnhof H.-Metzendorf- Roonstr. Lautertal/Lindenfels/ Freiherr-vom-Stein-Str. Am Falltor Schule Reichelsheim/Erbach 667 Heppenheim - Fürth - Grasellenbach Berliner Str. Evangelische Kirche Schwanheim 673 Kirch- Auerbach Ortsteile Riedsee Katholische Kirche Peter-Krekel-Str. Beginenstr. Rathaus -

Informationen Zur Abfallentsorgung
Informationen zur Abfallentsorgung BEI FRAGEN BERATEN WIR SIE GERNE! Zweckverband Abfallwirtschaft Abfallberatung, Gebühren, Kreis Bergstraße (ZAKB) Behälterdienst oder sonstige Fragen: Am Brunnengewännchen 5, 68623 Lampertheim 0 62 56 / 851 881 Fax: 0 62 56 / 851 9777 Sperrmüll und Elektroschrott-Anmeldung: E-Mail: [email protected] 0 62 56 / 851 888 www.zakb.de Blitzabfuhr: Sie erreichen uns telefonisch: 0 62 56 / 851 877 Montag bis Donnerstag von 08.00 bis 17.00 Uhr Freitag von 08.00 bis 12.00 Uhr DSD (Gelber Sack): 0 62 56 / 851 684 Stand · Dezember 2018 Wer ist der Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße? Wir, der „Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße“ (ZAKB), sind eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, die im Jahr 2002 durch den Zusammenschluss von Städten, Gemeinden und dem Kreis Bergstraße entstanden ist, um die gesamte Abfallentsorgung aus einer Hand durchzuführen. Mitglieder sind aktuell die Städte Bensheim, Bürstadt, Welche Aufgaben haben wir? Heppenheim, Lampertheim, Lindenfels, Lorsch, Neckarsteinach, Unsere Aufgabe ist die Abfalleinsammlung, der Transport, die Viernheim und Zwingenberg, die Gemeinden Abtsteinach, Beseitigung und die Verwertung der eingesammelten Abfälle. Biblis, Birkenau, Einhausen, Fürth, Gorxheimertal, Grasellenbach, Darüber hinaus regeln wir den Betrieb der Wertstoffhöfe und Groß-Rohrheim, Lautertal, Mörlenbach und Rimbach sowie der Grünschnitt-Sammelstellen im Kreisgebiet. Wir erstellen die Kreis Bergstraße. Gebührenabrechnungen und beraten Sie bei allen Fragen rund ums Thema Abfallentsorgung. Zur Durchführung unserer vielfältigen Aufgaben bedienen wir uns auch unserer 100%igen Tochtergesellschaften: der ZAKB Service GmbH und der ZAKB Energie und Dienstleistungs GmbH. Kreis Bergstraße 2 ABFALL VON A-Z A Abfallbehälter: Wir stellen Ihnen Behälter bis 240 Liter kostenlos zur Verfügung. Größere Behälter (770 und 1.100 Liter) können Sie über unsere Kundenberatung kaufen. -

Landwirtschaftliche Betriebe Mit Direktvermarktung Kreis Bergstrasse (Stand September 2017)
Landwirtschaftliche Betriebe mit Direktvermarktung Kreis Bergstrasse (Stand September 2017) #WERT! Anrede Name/Bezeichnung Vorname PLZ Ortsteil Ort Straße(Postfach) Telefon 1 E-Mail Dosenwurst Gaststätte Herrn Jöst Reinhold 69518 Mackenheim Abtsteinach Vöckelsbacher Weg 1 06207-3077 [email protected] Gaststätte "Grüner Baum"; "Grüner Baum" Fax 06207-3406 www.gruenerbaum-odw.de Urlaub auf dem Bauernhof Dosenwurst Eheleute Kohl Markus und Miriam 69518 Unter-Abtsteinach Abtsteinach Hauptstraße 103 06207-3776 Eier 06207-924533 Herrn Jährling Lutz 64625 Auerbach Bensheim Im Bangert 25 06251-79127 Roggen, Dinkel, Weizen (auch gemahlen) Fax 06251-79127 Kartoffeln saisonal: Karotten, Zwiebeln Gronauer Angus- Rettig/ 64625 Gronau Bensheim Märkerwaldstraße 104/115 06251-62667 [email protected] Weidehof Ahlheim GbR Stefan Rettig 06251-2928 Günter Ahlheim Herrn Jung Werner 64625 Gronau Bensheim Märkerwaldstraße 127 06251-68873 [email protected] Kartoffeln Herrn Konold Wilhelm 64625 Hochstädten Bensheim Mühltalstraße 298 06251-71423 Eier, Weihnachtsgänse, Weihnachtsputen Fax 06251-8608696 Rosenhof Herrn Ahlheim Dietmar 64625 Schwanheim Bensheim Melibokusblick 43 06251-983850 [email protected] Spargel, Erdbeeren nach Saison Landwirtschaft Herrn Kunzelmann Gerald 64625 Schwanheim Bensheim Rohrheimer Straße 72a 06251-787555 [email protected] Gänse und Puten zu Weihnachten Hof Kunzelmann Fax 06251-935722 www.freilandgans.com Herrn Schweickert Jörg u. Beate 64625 Schwanheim Bensheim Rathausstraße 3 06251-72232 [email protected] Frischfleisch von Schwein, Rind,Pute, Hähnchen, Fax 06251-79280 www.bauernhof-schweickert.de Hausmacher Wurst (Dose,Darm), Schinken,Salami, Eier, Rapsöl Partyservice Familie Embach 68647 Wattenheim Biblis St. Christopherus-Straße 9 06245-7120 www.hof-embach.de Erdbeeren, Erdbeererzeugnisse, Bohnen, Kürbisse, Fax 06245-6078 Paprika Gurken, versch. -

Lorsch Angebote in Lorsch Angebote in Lorsch
ANGEBOTE IN LORSCH ANGEBOTE IN LORSCH ANGEBOTE IN LORSCH UNTERSTÜTZUNG ZUR ERSTORIENTIERUNG - BERATUNG ANDERE MENSCHEN KENNENLERNEN, FREUNDE FINDEN UND DEUTSCH TIPPS LERNEN ANSPRECHPARTNER IM RATHAUS LORSCH SPORT Weitere Informationen über Angebote in Lorsch erfahren Sie hier: www.lorsch.de Kaiser-Wilhelm-Platz 1 | 64653 Lorsch Hilfe bei der Suche nach einem Verein Integrationsbeauftragte der Stadt Lorsch Sportcoach | [email protected] Beratung und Unterstützung zu Themen der Integration sowie Vermittlung von Integrationslotsen 06251 5967102 | [email protected] ELTERN dienstags 10 - 12 Uhr und 14 - 16 Uhr donnerstags 10 - 12 Uhr 16 - 18 Uhr Drop In(klusive) Das ist ein Angebot für Eltern mit ihren Kindern von 0 sowie nach Vereinbarung bis 3 Jahren. Dort treffen Sie andere Mütter und Väter und Ihr Kind kann mit anderen Kindern spielen. Viele der Drop Ins sind kostenfrei und Sie können ohne Termin kommen. Giebauer Haus | Schulstraße 16 | 64653 Lorsch 06251 8053110 | [email protected] dienstags 9 - 11 Uhr KINDER UND JUGENDLICHE Jugendzentrum Lorsch | Sachsenbuckelstraße 5a | 64653 Lorsch 06251 5967105 | [email protected] (Stadthaus) 06251 54530 | [email protected] (Jugendtreff) In der Regel ist das Jugendzentrum ab 15 Uhr geöffnet. Informationen über die unterschiedlichen Gruppenangebote erhalten Sie bei den oben angegebenen Kontakten oder auf der Internetseite der Stadt Lorsch: www.lorsch.de Stadt und Bürgerbüro Kinder und Jugend Kinder- und Jugendförderung | Stand: Oktober2020 Stand: BENSHEIM JUGENDMIGRATIONSDIENST (UNTER 27 JAHREN) BÜRSTADT Diakonisches Werk | Riedstr. 1 | Bensheim MIGRATIONSBERATUNG FÜR ERWACHSENE 06251 107229 | [email protected] MIGRATIONSBERATUNG FÜR ERWACHSENE Diakonisches Werk | Riedstr. 1 | Bensheim Lernmobil e.V. | Magnusstr. 37 | Bürstadt 06204 9319664 | 06251 1072224 | [email protected] FLÜCHTLINGSBERATUNG 0159 04357915 | [email protected] für Personen im laufenden Asylverfahren oder mit Caritasverband Darmstadt e.V.