Geschichte Der Philosophie VIII
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
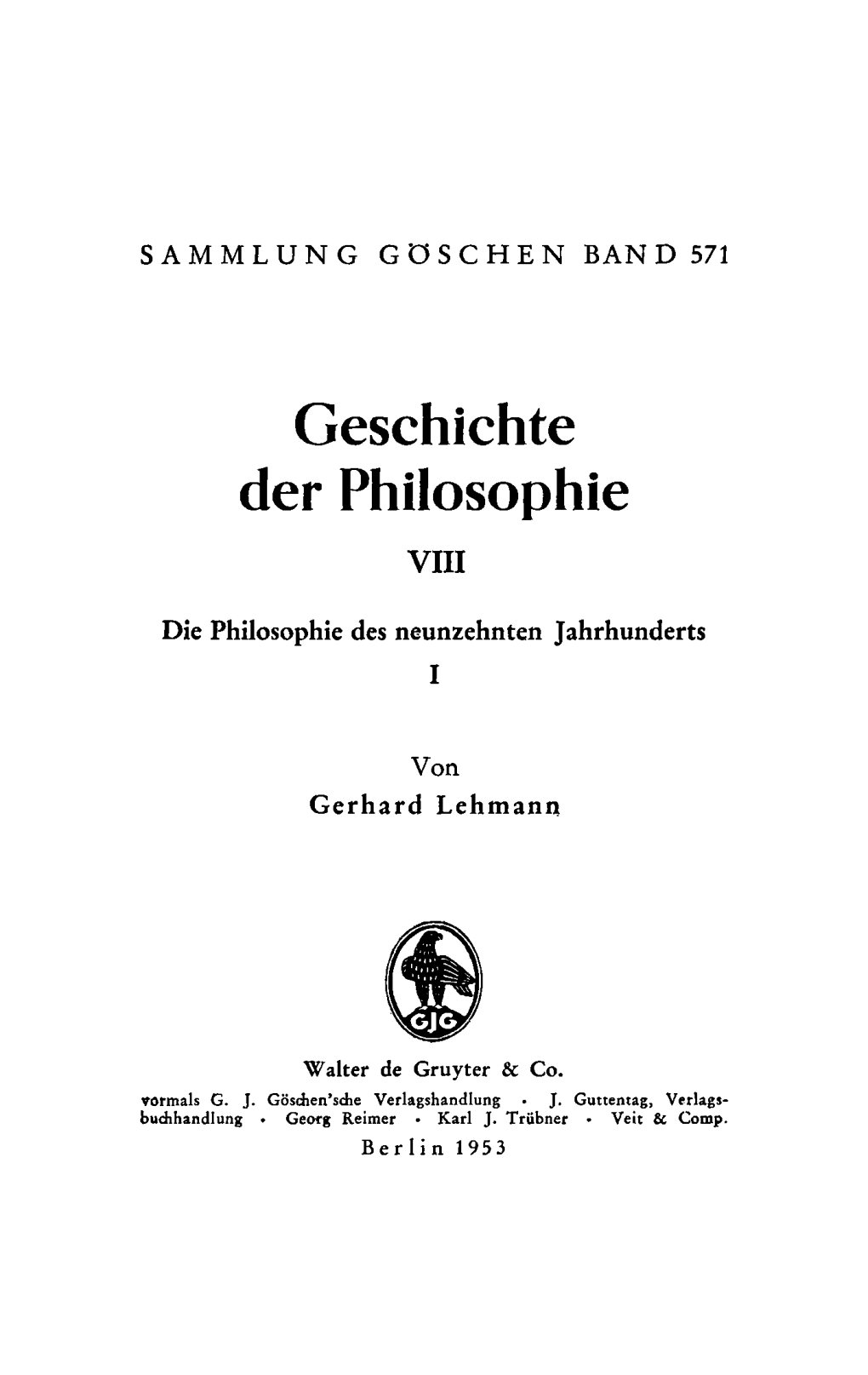
Load more
Recommended publications
-

The Idea of Mimesis: Semblance, Play, and Critique in the Works of Walter Benjamin and Theodor W
DePaul University Via Sapientiae College of Liberal Arts & Social Sciences Theses and Dissertations College of Liberal Arts and Social Sciences 8-2012 The idea of mimesis: Semblance, play, and critique in the works of Walter Benjamin and Theodor W. Adorno Joseph Weiss DePaul University, [email protected] Follow this and additional works at: https://via.library.depaul.edu/etd Recommended Citation Weiss, Joseph, "The idea of mimesis: Semblance, play, and critique in the works of Walter Benjamin and Theodor W. Adorno" (2012). College of Liberal Arts & Social Sciences Theses and Dissertations. 125. https://via.library.depaul.edu/etd/125 This Dissertation is brought to you for free and open access by the College of Liberal Arts and Social Sciences at Via Sapientiae. It has been accepted for inclusion in College of Liberal Arts & Social Sciences Theses and Dissertations by an authorized administrator of Via Sapientiae. For more information, please contact [email protected]. The Idea of Mimesis: Semblance, Play, and Critique in the Works of Walter Benjamin and Theodor W. Adorno A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy October, 2011 By Joseph Weiss Department of Philosophy College of Liberal Arts and Sciences DePaul University Chicago, Illinois 2 ABSTRACT Joseph Weiss Title: The Idea of Mimesis: Semblance, Play and Critique in the Works of Walter Benjamin and Theodor W. Adorno Critical Theory demands that its forms of critique express resistance to the socially necessary illusions of a given historical period. Yet theorists have seldom discussed just how much it is the case that, for Walter Benjamin and Theodor W. -

Critical Resistance Nietzschean French Philosophy Is Without Equal
Hoy 4/22/04 7:01 AM Page 1 “Hoy’s penetrating and multifaceted account of theories of resistance in post- Critical Resistance Nietzschean French philosophy is without equal. His analyses of genealogical From Poststructuralism to Post-Critique and deconstructionist modes of critique and his elaboration of the notion of David Couzens Hoy ‘critical resistance’ consistently evince the mastery we have come to expect from him. There is no better guide through the thickets of poststructualism This book serves as both an introduction to the and its aftermath.” concept of resistance in poststructuralist thought —Thomas McCarthy, Northwestern University Critical Critical Resistance and an original contribution to the continuing philosophical discussion of this topic. How can a “Critical Resistance offers fresh consideration of persistently vexing questions body of thought that mistrusts universal principles posed by poststructuralist philosophy: How is it possible to do away with explain the possibility of critical resistance? grounded norms and universal principles and at the same time offer a com- Without appeals to abstract norms, how can eman- pelling theoretical critique of the existing order of things? How can thinking cipatory resistance be distinguished from domina- practices that call all normativity into question also generate possibilities for From Poststructuralism tion? Can there be a poststructuralist ethics? David resistance to perceived domination or injustice? Indeed, how can such prac- Resistance Hoy explores these crucial questions -

From Ressentiment to Resentment As a Tertiary Emotion
Review of European Studies; Vol. 10, No. 4; 2018 ISSN 1918-7173 E-ISSN 1918-7181 Published by Canadian Center of Science and Education From Ressentiment to Resentment as a Tertiary Emotion Warren D. TenHouten1 1 Department of Sociology, University of California, Los Angeles, California, USA Correspondence: Warren D. TenHouten, Department of Sociology, 264 Haines Hall, UCLA, 405 Hilgard Avenue, Los Angeles, CA 90095–1551, USA. Received: May 14, 2018 Accepted: June 28, 2018 Online Published: September 5, 2018 doi:10.5539/res.v10n4p49 URL: https://doi.org/10.5539/res.v10n4p49 Abstract Resentment is a noxious emotion that can exist in sublimated form as a result of being subjected to inferiorization, stigmazation, or violence. In its active form, resentment can be a forceful response to acts that have created unjustified and meaningless suffering. We consider sociomoral conceptualizations of resentment by Adam Smith, Hume, and Lévinas. Nietzsche and Scheler developed the broader notion of ressentiment, a generalized form of resentment arising out of powerlessness and the experience of brutalization neither forgotten nor forgiven. Resentment is seen historically as a sentiment that is saturated with frustration, contempt, outrage, and malevolence. Marshall described oppositional class-consciousness as permeated with resentment and anger, but resentment also contains the basic emotions of surprise and disgust. Resentment is linked to the concept of relative deprivation. A partial classification of emotions is used to further analyze resentment as containing three secondary-level emotions: contempt (anger & disgust), shock (surprise & disgust), and outrage (surprise & anger). Thus, resentment is conceptualized as a tertiary-level emotion, containing three primary and three secondary emotions. -

Towards a Phenomenology of Liberation: a Critical Theory of Race and the Fate of Democracy in Latin America”
APA Newsletters NEWSLETTER ON HISPANIC/LATINO ISSUES IN PHILOSOPHY Volume 10, Number 1 Fall 2010 FROM THE EDITOR, BERNIE J. CANTEÑS ARTICLES CARLOS ALBERTO SANCHEZ “Against Values: Culture and Phenomenology in Jorge Portilla and Max Scheler” ALEJANDRO A. VALLEGA “Philosophy Beyond Pernicious Knowledge, from a Latin American Perspective” NYTHAMAR DE OLIVEIRA “Towards a Phenomenology of Liberation: A Critical Theory of Race and the Fate of Democracy in Latin America” BOOK REVIEW Enrique Dussel, Eduardo Mendieta, Carmen Bohórquez, Eds.: El pensamiento filósofico latinoamericano, del Caribe y “latino” [1300-2000]: Historia, Temas, Filósofos REVIEWED BY GRANT SILVA SUBMISSIONS CONTRIBUTORS © 2010 by The American Philosophical Association ISSN 2155-9708 APA NEWSLETTER ON Hispanic/Latino Issues in Philosophy Bernie J. Canteñs, Editor Fall 2010 Volume 10, Number 1 phenomenology.” De Oliveira’s thesis is developed in three ROM THE DITOR parts: (1) Philosophy of Race, (2) Liberation Philosophy, and F E (3) Critical Theory. According to de Oliveira, this new social phenomenology will avoid the “objectivist claims of Marxism” and “subjectivist ‘representations’ of postcolonial and cultural Bernie Canteñs studies.” De Oliveira adopts a “weak social constructionist” Moravian College conception of race. He understands that any account of race in Latin America will be intertwined with political and social The fall 2010 issue of the Newsletter contains Carlos Alberto psychology, and his philosophy of race intends to deconstruct Sanchez’s “Against Values: Culture and Phenomenology in racial democracy myths or scientific and historical conceptions Jorge Portilla and Max Scheler.” Sanchez’s essay compares of race, and Eurocentric myths of liberation such as democracy, the “European crisis of value” with the “Mexican crisis of liberalism, and socialism. -

Hegel: Three Studies I Theodor W
Hegel Three Studies · I Hegel Three Studies Theodor W. Adorno. translated by Shierry Weber Nicholsen with an introduction by Shierry Weber Nicholsen and Jeremy]. Shapiro \\Imi\�\\�\i\il\"t�m .� . 39001101483082 The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, and London, England ·" '.�. This edition © 1993 Massachusetts Institute of Technology This work originally appeared in German under the title Drei Studien zu Hegel, © 1963, 1971 Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, Germany. All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any fo rm or by any electronic or mechanical means (including photocopying, recording, or information storage and retrieval) without permission in writing from the publisher. This book was set in Baskerville by The Maple-Vail Book Manufacturing Group and was printed and bound in the United States of America. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Adorno, Theodor W., 1903-1969. [Drei Studien zu Hegel. English] Hegel: three studies I Theodor W. Adorno ; translated by Shierry Weber Nicholsen ; with an introduction by Shierry Weber Nicholsen and Jeremy J. Shapiro. p. cm.-(Studies in contemporary German social thought) Translation of: Drei Studien zu Hegel. Includes bibliographical references and index. ISBN 0-262-01131-X 1. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, 1770- 1831. 1. Title. 11. Series. B2948.A3213 1993 193----dc20 92-23161 CIP ..�. •. , ......... ..,..·...",...,..'''_''e ... • 11�. I },i . :-::" 7.�� <,f,' · '�: · : :-:- ;;· �:<" For Karl Heinz Haag 337389 Contents Introduction by Shierry Weber Nicholsen and IX Jeremy J. Shapiro Preface XXXv A Note on the Text xxxvii Editorial Remarks from the German Edition XXXIX Aspects of Hegel's Philosophy 1 The Experiential Content of Hegel's Philosophy 53 Skoteinos, or How to Read Hegel 89 Notes 149 Name Index 159 Introduction Shierry Weber Nicholsen Jeremy J. -

Explaining Postmodernism
SUB Hamburg Explaining Postmodernism Skepticism and Socialism from Rousseau to Foucault Expanded Edition Stephen R. C. Hicks Ockham's Razor Publishing Contents Thesis: The failure of epistemology made postmodernism possible, and the failure of socialism made postmodernism necessary. List of Tables and Charts v Chapter One: What Postmodernism Is The postmodern vanguard 1 Foucault, Lyotard, Derrida, Rorty Modem and postmodern 5 Modernism and the Enlightenment 7 Postmodernism versus the Enlightenment 14 Postmodern academic themes 15 Postmodern cultural themes 18 Why postmodernism? 20 Chapter Two: The Counter-Enlightenment Attack on Reason Enlightenment reason, liberalism, and science 23 The beginnings of the Counter-Enlightenment 24 Kant's skeptical conclusion 27 Kant's problematic from empiricism and-rationalism 29 Kant's essential argument 32 Identifying Kant's key assumptions 36 Why Kant is the turning point 39 After Kant: reality or reason but not both 42 Metaphysical solutions to Kant: from Hegel to Nietzsche 44 Dialectic and saving religion 46 Hegel's contribution to postmodernism 50 Epistemological solutions to Kant: irrationalism from Kierkegaard 51 to Nietzsche Summary of irrationalist themes 56 ii Chapter Three: The Twentieth-Century Collapse of Reason Heidegger's synthesis of the Continental tradition 58 Setting aside reason and logic 61 Emotions as revelatory 62 Heidegger and postmodernism 65 Positivism and Analytic philosophy: from Europe to America 67 From Positivism to Analysis 70 Recasting philosophy's function 72 Perception, -

Kierkegaard and Nietzsche on Resentment Daniel Conway Texas A&M University
Konturen VII (2015) 132 “The Happiness of ‘Slight Superiority’”: Kierkegaard and Nietzsche on Resentment Daniel Conway Texas A&M University My aim in this essay is to pair Kierkegaard with the German-born philosopher Friedrich Nietzsche (1844-1900). I am particularly concerned to juxtapose their complementary investigations into the etiology and operation of resentment, which both thinkers identified as exerting a powerfully retardant force within the bourgeois societies of late modern European culture. Indeed, both were concerned to demonstrate the extent to which the corrosive power of resentment had transformed the religious injunction to “love thy neighbor” into a culturally sponsored program to “beggar thy neighbor.” The result of this pairing, or so I hope to demonstrate, is a productive division of philosophical labor: From Nietzsche, on the one hand, Kierkegaard’s readers may gain a clear sense of how a community founded on ressentiment may accommodate “healthy” expressions of comparative advantage and relative superiority. Even when exaggerated and amplified, however, these expressions pose no threat to the conservative, contractionary structure of the ethical life of the community in question. In particular, as we shall see, Nietzsche’s account of ressentiment may explain that, and why, the seemingly daring meditation conducted by Johannes de silentio in Fear and Trembling yields such a muddled and unsatisfying conclusion. Daniel Conway received his BA in Philosophy and Economics from Tulane University and his PhD in Philosophy from the University of California, San Diego. He has held faculty appointments at Stanford University, Harvard University, Penn State University, and, since 2006, Texas A&M University, where he is Professor of Philosophy and Humanities and Affiliate Professor of Religious Studies and Film Studies. -

Untitled Remarks from “Köln, 30
Jewish Philosophical Politics in Germany, 1789–1848 the tauber institute series for the study of european jewry Jehuda Reinharz, General Editor Sylvia Fuks Fried, Associate Editor Eugene R. Sheppard, Associate Editor The Tauber Institute Series is dedicated to publishing compelling and innovative approaches to the study of modern European Jewish history, thought, culture, and society. The series features scholarly works related to the Enlightenment, modern Judaism and the struggle for emancipation, the rise of nationalism and the spread of antisemitism, the Holocaust and its aftermath, as well as the contemporary Jewish experience. The series is published under the auspices of the Tauber Institute for the Study of European Jewry— established by a gift to Brandeis University from Dr. Laszlo N. Tauber—and is supported, in part, by the Tauber Foundation and the Valya and Robert Shapiro Endowment. For the complete list of books that are available in this series, please see www.upne.com Sven-Erik Rose Jewish Philosophical Politics in Germany, 1789–1848 ChaeRan Y. Freeze and Jay M. Harris, editors Everyday Jewish Life in Imperial Russia: Select Documents, 1772–1914 David N. Myers and Alexander Kaye, editors The Faith of Fallen Jews: Yosef Hayim Yerushalmi and the Writing of Jewish History Federica K. Clementi Holocaust Mothers and Daughters: Family, History, and Trauma *Ulrich Sieg Germany’s Prophet: Paul de Lagarde and the Origins of Modern Antisemitism David G. Roskies and Naomi Diamant Holocaust Literature: A History and Guide *Mordechai -

Debord, Ressentiment, Ft Re'7o Lutio11ary Anarchism
Debord, Ressentiment, ft Re'7olutio11ary Anarchism Notes on Debord, Ressentiment & Revolutionary Anarchism by Aragorn! Why does the Situationist International continue to be such a rich source of inspiration for anarchist thinkers and activity today? They were a decidedly not anarchist group whose ostensible leader Guy Debord's ideas resonated much more with Marx, Korsh, and Adorno than Bakunin or Kropotkin. Naturally much of the influence of the SI is based on the theory that the general strike in France in May of 1968 represents the highest form of struggle against the dominant order in this historical period. This theory isn't necessarily supported by other social struggles of the past 30 years1 but does correspond nicely to an anarchist frameworkof what social transformation should look like. Therein lies the tension and rationale forthe continuing interest in the SI and Guy's work in particular. If the SI were represented by one book it would be Debord's Society of the Spectacle. If one portion of that book concerns anarchists and particularly anar chist self-knowledge it would be chapter four-The Proletariat as Subject and Representation. Debord damns anarchists' historical failure to theorize or accom plish that goal especially in those times when anarchists were best equipped and positioned to do exactly that. These critiques deserve further examination. In this context we will use the newest translation from Ken Knabb. Aphorism 91 The First International's initial successes enabled it to free itself from the confused influences of the dominant ideology that had survived within it. But the defeat and repression that it soon encountered brought to the surface a conflict between two different conceptions of proletarian revo lution, each of which contained an authoritarian aspect that amounted to abandoning the conscious self-emancipation of the working class. -

Alltägliches Leben
Quellen zur Geschichte Thüringens Alltägliches Leben „Gestern Abend schlief er auf dem Sofa ein ...“ Quellen zur Geschichte Thüringens „Gestern Abend schlief er auf dem Sofa ein ...“ Alltägliches Leben Herausgegeben von Heidi-Melanie Maier Titelabbildung: Journal des Luxus und der Moden. Titelzitat aus: Dorothea Michaelis-Veit-Schlegel an August Wil- helm Schlegel, 28. Oktober 1800 (Text 39). Text Rückseite: Friedrich Christian Laukhard: Bordelle in Halle, in: Friedrich Christian Laukhard: Leben und Schicksale; von ihm selbst beschrieben, und zur Warnung für Eltern und studierende Jünglinge herausgegeben. Halle 1792, 2. Theil, S. 119-120. Landeszentrale für politische Bildung Thüringen Regierungsstraße 73, 99084 Erfurt www.thueringen.de/de/lzt 2004 ISBN 3-931426-80-7 Inhalt Alltägliches Leben Inhalt Einführung Die „Künste der Geselligkeit zu lehren“ – Zwischen Alltag und Poesie . 13 Geselligkeit und Romantik . 15 Der Alltag romantischer Geselligkeit . 19 Prinzipien der Textauswahl und Textwiedergabe . 24 Alltag 1. Johann Christoph Adelung: Alltag . 27 2. Joachim Heinrich Campe: Der Alltag . 29 Thüringen 3. Fürstenthum Weimar, nebst der jenaischen Landesportion . 31 4. Fürstenthum Eisenach . 33 5. Herzogthum Gotha . 34 6. Fürstenthum Altenburg . 35 7. Grafschaft Schwarzburg . 36 8. Grafschaft Hohnstein . 37 9. Die Grafschaften Wernigerode und Stolberg . 38 10. Thüringen in Zahlen . 39 Häusliches Leben 11. Wie bey einer ungeschickten, säuischen und unordentlichen Hausfrau immer alles kränkelt und elend ist . 43 12. Herrn Flinks Haus- und Gesinde-Ordnung . 47 13. Caroline Michaelis-Böhmer-Schlegel-Schelling an Friedrich Ludwig Wilhelm Meyer, 29. Juli 1792 . 52 14. Lebenshaltung in Jena 1798 . 58 15. A. W. Schlegels Kreis . 60 16. Ein Monat im Leben der Sophie Mereau-Brentano . 61 17. -

Alex Betley PHIL278 9 May 2016 Beyond Ethical Egoism: A
Alex Betley PHIL278 9 May 2016 Beyond Ethical Egoism: A Clarification of the Nietzschean Noble Soul While it is true that James Rachels concludes his essay “Ethical Egoism” with the line, “It is this realization, that we are on a par with one another, that is the deepest reason why our morality must include some recognition of the needs of others, and why, then, Ethical Egoism fails as a moral theory,” he also prefaces this statement with a conveniently sly caveat: “Any moral doctrine that assigns greater importance to the interests of one group than to those of another is unacceptably arbitrary unless there is some difference between the members of the groups that justifies treating them differently” (Rachels 199, emphasis added). It is precisely the italicized text where a Nietzschean philosophy departs from Rachels. Nietzsche argues that there are differences between members of two groups or classes that, in fact, do make one class “so special,” to use Rachels’s wording and emphasis (Rachels 199). Contrarily, Rachels sees no fundamental difference between groups of human beings because they all have similar desires. This, he claims, is why we should care about the interests of other people: “their needs and desires are comparable to our own” (Rachels 199). I will argue in this paper that Rachels’ attack on ethical egoism is primarily an attack on an unsophisticated and possessive driven materialist philosophy1. This philosophy, propounded by the likes of Ayn Rand, and hijacked from a more thorough, persuasive, and comprehensible Nietzschean philosophy of the soul, erroneously replaces Nietzsche’s “noble” with a simplistic “self-interest.” 1 What I mean by materialist in this sense is not the same materialism of Marx. -

Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis Vorwort 21 Texte 27 1808 1 Goethe: Tagebuch, 11. April 29 2 Goethe: Tagebuch, 1. Mai 29 3 Goethe zu Johann Heinrich Meyer, 1. Mai ^29 4 Johann Heinrich Meyer zu Christian Schuchardt 29 5 Christian Schuchardt zu Robert Springer 29 6 Goethe: Tagebuch, 4. Mai 30 7 Goethe: Tagebuch, 1T Juni 30 8 Friedrich Wilhelm Riemer: Tagebuch, 1. Juni 30 9 Goethe: Tagebuch, 2. Juni 30 10 Friedrich Wilhelm Riemer: Tagebuch, 2. Juni 30 11 Friedrich Wilhelm Riemer an Friedrich Frommann, 1. Juli 30 12 Goethe an Karl Ludwig v. Knebel, 2. Juli 30 13 Goethe an Charlotte v. Stein, 2. Juli 31 14 Goethe an Friedrich Wilhelm Riemer, 19. Juli 31 15 Goethe: Tagebuch, 23. Juli 31 16 Friedrich Wilhelm Riemer: Tagebuch, 23. Juli 31 17 Goethe: Tagebuch, 24. Juli . 31 18 Goethe: Tagebuch, 25. Juli 31 19 Goethe: Tagebuch, 26. Juli 31 20 Goethe an Johann Friedrich Cotta, 26. Juli 31 21 Goethe: Tagebuch, 30. Juli , 32 22 Friedrich Wilhelm Riemer: Tagebuch, 30. Juli 32 23 Goethe an Carl August v. Sachsen-Weimar, 31. Juli 32 24 Goethe an Christiane v. Goethe, 1. August 32 26 Goethe an Silvie v. Ziegesar, 3. August 32 26 Goethe an Johanna Frommann, 14. August 32 27 Goethe an Charlotte v. Stein, 16. August 32 28 Goethe an Charlotte v. Schiller, 16. August 33 29 Goethe an August v. Goethe, 17. August 33 30 Johann Friedrich Cotta an Goethe, 20. August 33 31 Goethe an Marianne v. Eybenberg, 22. August 33 32 Friedrich Wilhelm Riemer: Tagebuch, 28. August 33 33 Goethe: Tagebuch, 30.