15-04-28 Lafnitz NGP 2015 Ist-Zustand
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
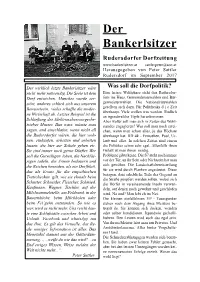
Der Bankerlsitzer September 2017
Seite 1 Der Bankerlsitzer September 2017 Der Bankerlsitzer Rudersdorfer Dorfzeitung www.bankerlsitzer.at [email protected] Herausgegeben von Peter Sattler Rudersdorf im September 2017 Der wirklich letzte Bankerlsitzer wäre Was soll die Dorfpolitik? nicht mehr notwendig. Die Seele ist dem Eine heisse Wahlphase steht den Rudersdor- Dorf entwichen. Manches wurde zer- fern ins Haus. Gemeinderatswahlen und Bür- stört, anderes schlich sich aus unserem germeisterwahlen. Die Nationalratswahlen Bewusstsein, vieles schaffte die moder- gesellten sich dazu. Für Politfreaks d i e Zeit überhaupt. Viele wollen was werden. Endlich ne Wirtschaft ab. Letztes Beispiel ist die an irgendwelche Töpfe herankommen. Schließung des Elektronahversorgerbe- Aber wofür soll man sich in Zeiten des Wohl- triebes Musser. Das wars, müsste man standes engagieren? Was soll man noch errei- sagen, und einschlafen, wenn nicht all chen, wenn man schon alles, ja das Höchste die Rudersdorfer wären, die hier woh- überhaupt hat. HD 4k - Fernsehen, Pool, Ur- nen, einkaufen, arbeiten und arbeiten laub und alles. In solchen Zeiten sind einem lassen, die hier zur Schule gehen etc. die Politiker schon sehr egal. Allenfalls ihren Sie sind immer noch gerne Dörfler. Wer Gehalt ist man ihnen neidig. soll die Gutwilligen loben, die Nachläs- Probleme gibts keine. Die S7 steht noch immer sigen tadeln, die Armen bedauern und vor der Tür, an ihr Sein oder Nichtsein hat man die Reichen beneiden, als ein Dorfblatt, sich gewöhnt. Die Landschaftsbereitstellung das als Ersatz für die empathischen für sie wird durch Planken angedeutet. Diese besagen, dass erhebliche Teile der Gegend an Tratschecken gilt, wie sie ehmals beim die Straße geopfert werden sollen, wobei sich Schuster, Schneider, Fleischer, Schmied, die Dörfer in vereinsamende Inseln verwan- Kaufmann, Wagner, Tischler, auf der deln, auf denen noch gewohnt und geschlafen Milchsammelstelle, am Feldrand, in der wird. -

Etnikai Térstruktúra, Asszimiláció És Identitás a Történelmi Vas Megyében
Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Földtudományok Doktori Iskola Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék ETNIKAI TÉRSTRUKTÚRA , ASSZIMILÁCIÓ ÉS IDENTITÁS A TÖRTÉNELMI VAS MEGYÉBEN PhD-értekezés Balizs Dániel Témavezet ő Dr. Bajmócy Péter egyetemi docens Szeged 2015 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés ............................................................................................................................................ 2 1.1. Problémafelvetés ......................................................................................................................... 2 1.2. Célkit űzések ................................................................................................................................ 3 2. Szakirodalmi el őzmények ................................................................................................................. 5 2.1. Földrajzi és történeti munkák ...................................................................................................... 5 2.2. A kutatásban szerepl ő fontosabb fogalmak ................................................................................. 6 3. Adatbázis, módszerek ..................................................................................................................... 12 3.1. Az adatok forrásai ..................................................................................................................... 12 3.2. Az adatbázis felépítésével kapcsolatos problémák .................................................................. -
Naturerlebnis-Lafnitztal.At
www.naturerlebnis-lafnitztal.at naturerlebnis powered by Naturerlebnisse, Abenteuer & Urlaub Tauchen Sie ein in die Natur, streifen Sie durch Auwälder und Wiesen, lernen Sie duftende Kräuter und seltene Pflanzen kennen und wandern Sie auf den Spuren der Tiere! Und das alles mit fachkundiger Begleitung durch unsere Naturführer. Gehen Sie auf Entdeckungsrei- se und wählen Sie unter den Angeboten - allesamt geführte Naturerlebnisse - Ihre Natur-Abenteuer- Tour aus. Ausrüstungsempfehlung für alle Naturerlebnisse: • Wanderbekleidung (lange Hose) • Gutes Schuhwerk (knöchelhohe Schuhe, wenn möglich) • Regen-, Windjacke bzw. Sonnenschutz Die angeführten Naturerlebnisse sind wahlweise mit Übernächtigung in Hotels, Gasthäusern oder Privat- zimmern buchbar. Kleinere Gruppen - Preis auf Anfrage Das Lafnitztal Bitte kontaktieren Sie unseren Partner: Reisebüro Foxtours, 7400 Oberwart, Wienerstr. 27 Naturnahe Flusslandschaften sind in Mitteleuropa Tel. +43(0)3352/34 580, e-Mail: [email protected] selten geworden. Das Lafnitztal zählt zu diesen kostbaren Lebensräumen. Mit seinen breit ausladenden Flussmäandern ist es eines der letzten unregulierten Flachlandgewässer Österreichs und als Feuchtgebiet von internationaler Bedeutung. Direkt an der Lafnitz liegen knapp 20 Gemeinden, die über ein vielfältiges Angebot verfügen: von Sport- und Freizeitaktivitäten über Naturerlebnisse, Kunst und Kultur bis zu Kulinarik und Wohnen. Neu! Die 260 km lange Paradies-Radroute, die das ganze Lafnitztal durchzieht. www.naturerlebnis-lafnitztal.at 2 3 Dialog mit der Lafnitz – Der Schatz aus der Lafnitz Wasser und Gesundheit Der Auftrag selbst ist bereits ein Abenteuer und führt Ein Fluss bringt uns in Bewegung und lässt uns durch- uns an Orte der Begegnung – mit sich, der Geschichte, atmen. Hörproben, Geruchsnoten und Spielräume am den Menschen und dem Fluss. Fluss ermöglichen einen Blick in unsere Seelenland- schaft. -

Rankings Municipality of Lafnitz
9/26/2021 Maps, analysis and statistics about the resident population Demographic balance, population and familiy trends, age classes and average age, civil status and foreigners Skip Navigation Links AUSTRIA / STEIERMARK / Province of Hartberg-Fürstenfeld / Lafnitz Powered by Page 1 L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Adminstat logo DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH AUSTRIA Municipalities Powered by Page 2 Bad Blumau Stroll up beside >> L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Großsteinbach AdminstatBad Loipersdorf logo DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH Großwilfersdorf Bad Waltersdorf AUSTRIA Hartberg Buch-Sankt Magdalena Hartberg Umgebung Burgau Hartl Dechantskirchen Ilz Ebersdorf Kaindorf Feistritztal Friedberg Lafnitz Fürstenfeld Neudau Grafendorf bei Ottendorf an der Hartberg Rittschein Greinbach Pinggau Pöllau Pöllauberg Rohr bei Hartberg Rohrbach an der Lafnitz Sankt Jakob im Walde Sankt Johann in der Haide Sankt Lorenzen am Wechsel Schäffern Söchau Stubenberg Vorau Waldbach- Mönichwald Wenigzell Provinces Powered by Page 3 BRUCK- LEIBNITZ L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin MÜRZZUSCHLAG Adminstat logo LEOBEN DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH DEUTSCHLANDSBERG AUSTRIALIEZEN GRAZ (STADT) MURAU GRAZ-UMGEBUNG MURTAL HARTBERG- SÜDOSTSTEIERMARK FÜRSTENFELD VOITSBERG WEIZ Regions BURGENLAND OBERÖSTERREICH KÄRNTEN SALZBURG NIEDERÖSTERREICHSTEIERMARK TIROL VORARLBERG WIEN Municipality of Lafnitz Foreign residents in Municipality of LAFNITZ by gender and its related demographic balance, number of foreign minors, -

Lafnitz FFH-Schutzgüter 12-05-31
Status quo der Schutzgüter Fische und Neunaugen im Natura-2000- Gebiet Lafnitzauen (AT1122916) Gerhard Woschitz Haberlgasse 32/13, 1160 Wien DWS Hydro -Ökologie Technisches Büro für Gewässerökologie und Landschaftsplanung Österreichischer Naturschutzbund – Landesgruppe Burgenland Wien, Mai 2012 Gerhard Woschitz DWS Hydro -Ökologie Haberlgasse 32/13, 1160 Wien Technisches Büro für Gewässerökologie und Landschaftsplanung Status quo der Schutzgüter Fische und Neunaugen im Natura-2000- Gebiet Lafnitzauen (AT1122916) Auftraggeber: Österreichischer Naturschutzbund Landesgruppe Burgenland Haydngasse 11, 7000 Eisenstadt Ansprechpartner: Dr. Thomas Zechmeister Auftragnehmer: Gerhard Woschitz Haberlgasse 32/13, 1160 Wien Tel. 0664 / 120 44 61 e-mail: [email protected] Seiten: 88 (ohne Deckblätter und Inhaltsverzeichnis) Autoren: Gerhard Woschitz & Dr. Georg Wolfram Datum: Wien, im Mai 2012 Inhaltsverzeichnis Zusammenfassung .................................................................................................................... 1 1 Einleitung .............................................................................................................................. 4 2 Untersuchungsgebiet ........................................................................................................... 6 2.1 Naturraum ................................................................................................................................................. 6 2.2 Geologischer Untergrund und klimatische Rahmenbedingungen ............................................................ -

Die Lafnitz Als Lebensraum Für Fische
Die Lafnitz als Lebensraum für Fische MIT UNTERSTÜTZUNG VON LAND UND EUROPÄISCHER UNION Bewusstsein für Umwelt und Natur er Erhalt der natürlichen Flusslandschaft, die sich Landesrat durch eine enorme Vielfalt an Lebewesen auszeichnet, Andreas Liegenfeld D ist ein wichtiger Beitrag zur Bewahrung der heimischen Bio- Burgenländische Landesregierung diversität. Die Lafnitz prägt das Landschaftsbild des Burgen- landes nachhaltig und dient als Heimat- und Rückzugsgebiet einer eindrucksvollen Tier- und Pflanzenwelt. Mit einem zunehmenden Bewusstsein für Umwelt und Na- tur gewinnt auch der Erhalt dieser traditionellen Lebensräume immer mehr an Bedeutung. Nachhaltige Maßnahmen, die die Natur schützen und einen wertvollen Beitrag für die regionale Artenvielfalt leisten haben hohe Priorität. Die vorliegende Bro- schüre zum Lebensraum Lafnitz widmet sich dem natürlichen Fischvorkommen im Flusslauf und beschreibt künftige Heraus- forderungen zur Sicherung und dem Ausbau der Bestände. Die Erfassung des komplexen Zustandes der Lafnitz ist ein wichtiger Beitrag und ein zentrales Element für künftige Handlungen. Die Erläuterungen helfen das Flussgebiet für kommende Genera- tionen in seiner Ursprünglichkeit zu erhalten und der Natur Raum zur Entfaltung zu geben. Als zuständiger Landesrat ist es mir ein rücksichtsvoller und schonender Umgang mit unserer Umwelt ein besonderes Anliegen. Die vorliegende Broschüre trägt einen wichtigen Teil dazu bei, über die einzigartige Natur der Lafnitz mit ihren natürlichen Fischvorkommen zu informieren und etwaige Handlungserfordernisse aufzuzeigen. 2 Die Lafnitz als Lebensraum für Fische as Lafnitztal war die längste Zeit die Außengrenze der Habs- Mag. Dr. Ernst Breitegger burger gegen den Osten. Ab 1760 lies Kaiserin Maria Theresia Obmann Naturschutzbund DGrenzsteine aufstellen, von denen noch einige erhalten sind. Wie Burgenland es im Mittellauf der Flüsse leicht passiert, ändert der Fluss durch Durchbruch von Mäandern oft seinen Weg; die Grenzstreitigkeiten folgen auf dem Fuße. -

Äschenprojekt Lafnitz
Äschenprojekt Lafnitz Kurztitel: Äschenprojekt Lafnitz Projekt-Langtitel: Fischbestandsmonitoring als Basis zur Förderung einer nachhaltigen Fischereiwirtschaft an der Lafnitz Auftraggeber: Österreichischer Naturschutzbund Landesgruppe Burgenland Esterhazystr. 15, 7000 Eisenstadt Autoren: Mag. Dr. Georg Wolfram (Fischökologie) DWS Hydro-Ökologie GmbH Gerhard Woschitz (Fischökologie) Selbständiger Fischökologe Mag. Anita Wolfram (Fischökologie) DWS Hydro-Ökologie GmbH Dr. Steven Weiss (Äschengenetik) Karl-Franzens-Univ. Graz, Institut für Zoologie Theodora Kopun (Äschengenetik) Karl-Franzens-Univ. Graz, Institut für Zoologie Dr. Klaus Michalek (Reiher-Monitoring) Dr. Joachim Tajmel (Fischotter-Monitoring) Mitarbeiter: Mag. Georg Kum (Fischökologie) Seitenzahl Bericht 131 (ohne Deckblätter) Datum: Wien, am 28. November 2007 Berichtsnummer 06/020-B04 Im Falle einer Vervielfältigung oder Veröffentlichung dieser Ausfertigung darf der Inhalt nur wort- und formgetreu ohne Auslassung oder Zusatz wiedergegeben werden. Die auszugsweise Vervielfältigung oder Veröffentlichung bedarf der schriftlichen Zustimmung der Autoren. Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung ............................................................................................................................1 1.1. Hintergrund.................................................................................................................1 1.2. Projektstruktur ............................................................................................................1 2. Modul I -

Neudau - Burgau - Fürstenfeld Gültig Ab 13
485 Hartberg - Neudau - Burgau - Fürstenfeld Gültig ab 13. September 2021 Am 24. und 31. Dezember Verkehr wie am jeweiligen Wochentag in den Schulferien Haltestelle Montag - Freitag Fahrtnummer 101 205 103 107 207 209 109 111 213 113 215 115 117 219 119 Verkehrsbeschränkung S F S S F F S S F S F S S F S Hartberg Busbahnhof 11:35 12:35 13:35 Hartberg Europaplatz (Ressavarstraße) 11:37 12:37 13:37 Hartberg Europaplatz (Ressavarstraße) 11:39 12:39 13:39 15:37 Hartberg Roseggergasse 11:40 12:40 13:40 X30 Graz Andreas-Hofer-Platz ab 10:10 12:10 14:10 14:10 16:50 16:50 X30 Gleisdorf Busbahnhof ab 5:55 5:55 10:50 12:50 14:50 14:50 X30 Hartberg Busbahnhof an N6:40 6:40 11:35 13:35 15:35 15:35 18:10 18:10 X31 Graz Andreas-Hofer-Platz ab 14:20 14:20 15:40 X31 Hartberg Busbahnhof an 15:35 15:35 16:55 Verkehrsbeschränkung SB SB 304 Bad Tatzmannsdorf J.-Haydn-Pl. ab 14:25 17:20 304 Pinkafeld (B) Hauptplatz ab 14:42 17:37 304 Hartberg Busbahnhof an 15:17 18:13 Hartberg Busbahnhof N6:40 7:00 8:10 8:10 11:40 13:40 15:40 15:40 17:05 18:25 18:25 Hartberg Rotkreuzkapelle 12:43 13:43 15:42 17:07 Hartberg Bahnhofstraße 6:42 7:02 8:12 8:12 11:42 11:42 12:44 13:42 13:44 15:42 15:43 17:08 18:27 18:27 R520 Wr. -

Wir Sind Bereits Dabei! Niederösterreich Stand: Mai 2014 Burgen- Land
Wir sind bereits dabei! Niederösterreich Stand: Mai 2014 Burgen- land Steiermark Vorarlberg Salzburg Tirol Tirol Kärnten Kilometer 0 25 50 Grafik: Österreichische Energieagentur, Geschäftsstelle von e5-Österreich, Mai 2014 Burgenland: dorf (eee), Pitten (eee), Wiesel- Tirol: Die Träger des e5-Pogrammes stehen mit Rat und Tat zur Verfügung: Deutsch Kaltenbrunn, Eltendorf, burg (eee), Bisamberg (ee), Virgen (eeeee), Kufstein (eeee), Heiligenkreuz im Lafnitztal, Pressbaum (ee), Ternitz (ee), Schwaz (eeee), Wörgl (eeee), e5 Burgenland e5 Salzburg e5 Vorarlberg Jennersdorf, Königsdorf, Laa an der Thaya Kirchbichl (eee), Schwendau DI Johann Binder / Roland Pasterk DI Helmut Strasser Karl-Heinz Kaspar MSc Minihof-Liebau, Mogersdorf, Salzburg: (eee), Volders (eee), Angerberg Burgenländische Energieagentur Salzburger Institut für Energieinstitut Vorarlberg Mühlgraben, Rudersdorf, St. Johann im Pongau (eeeee), bei Wörgl (ee), Dölsach (ee), Tel. +43 (0)5 9010 22-23 / -33 Raumordnung & Wohnen (SIR) Tel. +43 (0)5572 31202 99 St. Martin an der Raab Grödig (eeee), Neumarkt am Kundl (ee), Mutters (ee), Trins [email protected] / Tel. +43 (0)662 623455 26 karl-heinz.kaspar@energie institut.at Kärnten: Wallersee (eeee), Thalgau (eeee), (ee), Eben am Achensee (e), [email protected] [email protected] www.e5-vorarlberg.at Kötschach-Mauthen (eeeee), Weißbach bei Lofer (eeee), Natters (e), Telfs (e), Vomp (e), www.eabgld.at www.e5-salzburg.at; www.sir.at Arnoldstein (eeee), Diex (eeee), Werfenweng (eeee), Bischofs- Zirl (e), Aschau im Zillertal, Eisenkappel (eeee), Schiefling hofen (eee), Elixhausen (eee), Ass ling, Innsbruck, Ramsau im e5 Kärnten e5 Steiermark In Ihrem Bundesland Zillertal, Roppen, Stams, (eeee), Trebesing (eeee), Villach Mühlbach am Hochkönig (eee), Mag. Jan Lüke Mag. -

Die Lafnitz Als Lebensraum Für Fische
Die Lafnitz als Lebensraum für Fische MIT UNTERSTÜTZUNG VON LAND UND EUROPÄISCHER UNION Bewusstsein für Umwelt und Natur er Erhalt der natürlichen Flusslandschaft, die sich Landesrat durch eine enorme Vielfalt an Lebewesen auszeichnet, Andreas Liegenfeld D ist ein wichtiger Beitrag zur Bewahrung der heimischen Bio- Burgenländische Landesregierung diversität. Die Lafnitz prägt das Landschaftsbild des Burgen- landes nachhaltig und dient als Heimat- und Rückzugsgebiet einer eindrucksvollen Tier- und Pflanzenwelt. Mit einem zunehmenden Bewusstsein für Umwelt und Na- tur gewinnt auch der Erhalt dieser traditionellen Lebensräume immer mehr an Bedeutung. Nachhaltige Maßnahmen, die die Natur schützen und einen wertvollen Beitrag für die regionale Artenvielfalt leisten haben hohe Priorität. Die vorliegende Bro- schüre zum Lebensraum Lafnitz widmet sich dem natürlichen Fischvorkommen im Flusslauf und beschreibt künftige Heraus- forderungen zur Sicherung und dem Ausbau der Bestände. Die Erfassung des komplexen Zustandes der Lafnitz ist ein wichtiger Beitrag und ein zentrales Element für künftige Handlungen. Die Erläuterungen helfen das Flussgebiet für kommende Genera- tionen in seiner Ursprünglichkeit zu erhalten und der Natur Raum zur Entfaltung zu geben. Als zuständiger Landesrat ist es mir ein rücksichtsvoller und schonender Umgang mit unserer Umwelt ein besonderes Anliegen. Die vorliegende Broschüre trägt einen wichtigen Teil dazu bei, über die einzigartige Natur der Lafnitz mit ihren natürlichen Fischvorkommen zu informieren und etwaige Handlungserfordernisse aufzuzeigen. 2 Die Lafnitz als Lebensraum für Fische as Lafnitztal war die längste Zeit die Außengrenze der Habs- Mag. Dr. Ernst Breitegger burger gegen den Osten. Ab 1760 lies Kaiserin Maria Theresia Obmann Naturschutzbund DGrenzsteine aufstellen, von denen noch einige erhalten sind. Wie Burgenland es im Mittellauf der Flüsse leicht passiert, ändert der Fluss durch Durchbruch von Mäandern oft seinen Weg; die Grenzstreitigkeiten folgen auf dem Fuße. -

Veranstaltungstipps Region Jennersdorf
Veranstaltungstipps Region Jennersdorf Veranstaltungstipps 24.06.2016 – 09.07.2016 bis Mo., 31.10.2016 Kunstgartenausstellung „Insekten & Skulpturen“ in der Kunstoase Slatar, Hintergasse 5, Rudersdorf. Nähere Infos & Anmeldung unter 0664/ 1635145 Fr., 24.06.2016, 14-17 Uhr Waldläuferbande für Kinder – Waldausflug mit einer Waldpädagogin. Treffpunkt: Stoagupf, Grieselstein. Infos unter 0680/2150907 Fr., 24.06.2016, 15 Uhr Workshop „Energetisch Testen mit Rute und Tensor“ im Raum für Natur & Bewusstsein, Mogersdorf-Bergen 289. Infos & Anmeldung unter 0664/ 311 13 87 Fr., 24.06.2016, 17 Uhr Schulfest der Volksschule Eltendorf, Kirchenstraße 18 Fr., 24.06.2016, 17 Uhr Familienfest im Kindergarten Heiligenkreuz i.L., Untere Hauptstraße 3 Fr., 24.06.2016, 17 Uhr Spanferkelgrillen im Gasthaus Mertschnigg, Bonisdorf. Für die musikalische Unterhaltung sorgt die Neuhauser Blasmusikkapelle. Infos unter 03329/2445 oder 0664/4300664. Fr., 24.06.2016, 18 Uhr Grillabend im Berggasthaus Pfingstl, Bergstraße 7, Rudersdorf. Infos unter 03382/71170 Fr., 24.06.2016, 20 Uhr Vernissage mit Werner Loder und Lesung mit Andrea Seiler in der Liebhaberei, Obere Marktstraße 33, Deutsch Kaltenbrunn. Ausstellungsdauer: 24.-26.06.2016. Infos unter 0699/ 19213365 Sa., 25.06.2016, ab 7 Uhr Flohmarkt an der B65 am Schotter-Parkplatz in Heiligenkreuz i.L. Infos unter 0664/ 1892315 Sa., 25.06.2016, 7 Uhr Taufrisch Morgenwanderung in Heiligenkreuz i.L. Treffpunkt: Gemeindeamt Heiligenkreuz, Untere Hauptstraße 1. Infos unter 03325/ 4202 Sa., 25.06.2016, 9 Uhr „Treffpunkt Naturerlebnis“ - Ein Naturparadies stellt sich vor, Raab-Altarmanbindung Welten, Hauptstraße 18, Welten Infos unter www.volksbildungswerk.at Seite 1 Veranstaltungstipps Region Jennersdorf Sa., 25.06.2016, 9.30 Uhr Geführte Kanufahrt auf der Raab von Neumarkt bis zur ungarischen Grenze. -

Introduction
discussion paper 71 Robert Lukesch et al. Regional Development: Overview on five European Regions An INSURED Document EURES discussion paper dp-71 ISSN 0938-1805 1998 EURES Institut für Regionale Studien in Europa Schleicher-Tappeser KG Basler Straße 19, D-79102 Freiburg Tel. 0049 / 761 / 70 44 1-0 Fax 0049 / 761 / 70 44 1-44 e-mail [email protected] www.eures.de This discussion paper was written within the research project “Instruments and Strategies for Sustainable Regional Development” (INSURED) in the EC Environment and Climate Research Programme (1994- 1998): Research Theme 4: Human Dimension of Environmental Change (Contract ENV-CT96-0211). The project was carried out by • EURES-Institute for Regional Studies in Europe, Freiburg/ Germany (Coordinator) • SRS, Studio Ricerche Sociali, Firenze/ Italy • ÖAR Regionalberatung GesmbH, Österreichische Arbeitsgemeinschaft für eigenständige Regionalentwicklung, Wien/ Austria • SICA Innovation Consultants Ltd., Dublin/ Ireland • SIASR, Schweizerisches Institut für Aussenwirtschafts-, Struktur- und Regionalforschung, University of St. Gallen/ Switzerland The project was sponsored by • The Commission of the European Union, DG XII Science, Research and Development • The Federal Government of Austria • The Government of Hessen and several Local Governments/ Germany • The Federal Government of Switzerland • The Region of Tuscany INSURED Instruments for Sustainable Regional Development EC Environment and Climate Research Programme Regional Development: Overview on five European Regions An INSURED Document Robert Lukesch (ÖAR) Ruggero Schleicher-Tappeser (EURES) Filippo Strati (SRS) Gerry P. Sweeney (SICA) Alain Thierstein (SIASR) 1998 Available INSURED Reports and discussion papers: Instruments for Sustainable Regional Development The INSURED Project - Final Report Ruggero Schleicher-Tappeser et al. (1998), EURES Report 9, Freiburg i.Br.