Politik Und Wirtschaft Im Krieg
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Geschichte Der Deuts Chspr Achigen Schweizer Literatur Im 20
Geschichte der deuts chspr achigen Schweizer Literatur im 20. Jahrhundert Von einem Autorenkollektiv unter der Leitung von KLAUS PEZOLD Redaktion HANNELORE PROSCHE 7, VOLK UND WISSEN BERLIN 1991 Inhalt Vorbemerkung 8 »Dichter im Abseits« 58 Der schwierige Weg ins neue Jahrhundert. Zwischen Enge und Weite — Felix Moeschlin, Vom Tod Gottfried Kellers Meinrad Inglin, Jakob Schaffner 62 bis zum Ende der zwanziger Jahre 11 »Rebellen gegen den Seldwylergeist« - Literatur und Gesellschaft Jakob Bührer, Robert Walser, Friedrich Glauser (Klaus-Dieter Schult, und andere 67 Ilona Siegel, Wladimir Sedelnik) 11 Insel im Sturm — die Schweiz in den Zwischen Selbstbehauptung und Selbst- Jahren des ersten Weltkriegs 17 beschränkung. Die Literatur der Jahrzehnte Zwischen Aufbruch und Krise — vor und nach dem zweiten Weltkrieg die zwanziger Jahre 23 (Klaus-Dieter Schult) 75 Hauptlinien Literatur und Gesellschaft unter der literarischen Entwicklung den Konstellationen von der Jahrhundertwende bis zum Ende der Geistigen Landesverteidigung 75 des ersten Weltkriegs (Ilona Siegel) 25 Entwicklungslinien der Literatur in den dreißiger Heimatliteratur und traditionelles Erzählen — und frühen vierziger Jahren 83 Ernst Zahn, J. C. Heer, Alfred Huggenberger und andere 26 Auf der Suche nach dem neuen Menschen - Ansätze zur Sozialkritik in Bauernroman Maria Waser, C. I. Loos, Cecile Lauber, und Dorfnovelle bei Heinrich Federer Traugott Vogel 83 und Jakob Boßhart 30 Arbeiterliteratur zwischen Emanzipation Geschichte und Gegenwart im Frühwerk und Selbstaufgabe 87 von -

Die Schweiz Und Die Flüchtlinge Zur Zeit Des Nationalsozialismus
Unabhängige Expertenkommission Schweiz – Zweiter Weltkrieg Die Schweiz und die Flüchtlinge zur Zeit des Nationalsozialismus Wurde ersetzt durch die überarbeitete und ergänzte Fassung: Unabhängige Expertenkommission Schweiz – Zweiter Weltkrieg: Die Schweiz und die Flüchtlinge zur Zeit des Nationalsozialismus, Zürich 2001 (Veröffentlichungen der Unabhängigen Expertenkommission Schweiz – Zweiter Weltkrieg, Bd. 17). Bestellung: Chronos Verlag (www.chronos-verlag.ch) Herausgeber Unabhängige Expertenkommission Schweiz – Zweiter Weltkrieg Postfach 259 CH-3000 Bern 6 www.uek.ch Unabhängige Expertenkommission Schweiz – Zweiter Weltkrieg: Die Schweiz und Flüchtlinge zur Zeit des Nationalsozialismus. Bern 1999. ISBN 3-908661-04-8 Vertrieb BBL/EDMZ, 3003 Bern www.admin.ch/edmz Art.-Nr. 201.282 d 12.99 2000 H-UEK 07-10-99 Unabhängige Expertenkommission Schweiz – Zweiter Weltkrieg Die Schweiz und die Flüchtlinge zur Zeit des Nationalsozialismus Mitglieder der Kommission/Gesamtverantwortung Jean-François Bergier, Präsident Sybil Milton, Vizepräsidentin / Berichtsleitung Joseph Voyame, Vizepräsident Wladyslaw Bartoszewski Georg Kreis, Berichtsleitung Saul Friedländer, Berichtsleitung Jacques Picard, Delegierter Harold James Jakob Tanner Generalsekretariat Linus von Castelmur Projektleitung Gregor Spuhler Wissenschaftliche Beratung Marc Perrenoud Autoren und Autorinnen Valérie Boillat, Daniel Bourgeois, Michèle Fleury, Stefan Frech, Michael Gautier, Tanja Hetzer, Blaise Kropf, Ernest H. Latham, Regula Ludi (Teamleitung) Marc Perrenoud, Gregor Spuhler (Teamleitung), -

Maurizio Basili Ultimissimo
Le tesi Portaparole © Portaparole 00178 Roma Via Tropea, 35 Tel 06 90286666 www.portaparole.it [email protected] isbn 978-88-97539-32-2 1a edizione gennaio 2014 Stampa Ebod / Milano 2 Maurizio Basili La Letteratura Svizzera dal 1945 ai giorni nostri 3 Ringrazio la Professoressa Elisabetta Sibilio per aver sempre seguito e incoraggiato la mia ricerca, per i consigli e le osservazioni indispensabili alla stesura del presente lavoro. Ringrazio Anna Fattori per la gratificante stima accordatami e per il costante sostegno intellettuale e morale senza il quale non sarei mai riuscito a portare a termine questo mio lavoro. Ringrazio Rosella Tinaburri, Micaela Latini e gli altri studiosi per tutti i consigli su aspetti particolari della ricerca. Ringrazio infine tutti coloro che, pur non avendo a che fare direttamente con il libro, hanno attraversato la vita dell’autore infondendo coraggio. 4 INDICE CAPITOLO PRIMO SULL’ESISTENZA DI UNA LETTERATURA SVIZZERA 11 1.1 Contro una letteratura svizzera 13 1.2 Per una letteratura svizzera 23 1.3 Sull’esistenza di un “canone elvetico” 35 1.4 Quattro lingue, una nazione 45 1.4.1 Caratteristiche dello Schweizerdeutsch 46 1.4.2 Il francese parlato in Svizzera 50 1.4.3 L’italiano del Ticino e dei Grigioni 55 1.4.4 Il romancio: lingua o dialetto? 59 1.4.5 La traduzione all’interno della Svizzera 61 - La traduzione in Romandia 62 - La traduzione nella Svizzera tedesca 67 - Traduzione e Svizzera italiana 69 - Iniziative a favore della traduzione 71 CAPITOLO SECONDO IL RAPPORTO TRA PATRIA E INTELLETTUALI 77 2.1 Gli intellettuali e la madrepatria 79 2.2 La ristrettezza elvetica e le sue conseguenze 83 2.3 Personaggi in fuga: 2.3.1 L’interiorità 102 2.3.2 L’altrove 111 2.4 Scrittori all’estero: 2.4.1 Il viaggio a Roma 120 2.4.2 Parigi e gli intellettuali svizzeri 129 2.4.3 La Berlino degli elvetici 137 2.5 Letteratura di viaggio. -

Tradition Und Modernität in Der SVP
Tradition und Modernität in der SVP Autor(en): Jost, Hans Ulrich Objekttyp: Article Zeitschrift: Traverse : Zeitschrift für Geschichte = Revue d'histoire Band (Jahr): 14 (2007) Heft 1: Histoire des partis politiques en Suisse = Geschichte der politischen Parteien der Schweiz PDF erstellt am: 23.09.2021 Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-31834 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse -

Switzerland – a Model for Solving Nationality Conflicts?
PEACE RESEARCH INSTITUTE FRANKFURT Bruno Schoch Switzerland – A Model for Solving Nationality Conflicts? Translation: Margaret Clarke PRIF-Report No. 54/2000 © Peace Research Institute Frankfurt (PRIF) II Summary Since the disintegration of the socialist camp and the Soviet Union, which triggered a new wave of state reorganization, nationalist mobilization, and minority conflict in Europe, possible alternatives to the homogeneous nation-state have once again become a major focus of attention for politicians and political scientists. Unquestionably, there are other instances of the successful "civilization" of linguistic strife and nationality conflicts; but the Swiss Confederation is rightly seen as an outstanding example of the successful politi- cal integration of differing ethnic affinities. In his oft-quoted address of 1882, "Qu’est-ce qu’une nation?", Ernest Renan had already cited the confederation as political proof that the nationality principle was far from being the quasi-natural primal ground of the modern nation, as a growing number of his contemporaries in Europe were beginning to believe: "Language", said Renan, "is an invitation to union, not a compulsion to it. Switzerland... which came into being by the consent of its different parts, has three or four languages. There is in man something that ranks above language, and that is will." Whether modern Switzerland is described as a multilingual "nation by will" or a multi- cultural polity, the fact is that suggestions about using the Swiss "model" to settle violent nationality-conflicts have been a recurrent phenomenon since 1848 – most recently, for example, in the proposals for bringing peace to Cyprus and Bosnia. However, remedies such as this are flawed by their erroneous belief that the confederate cantons are ethnic entities. -
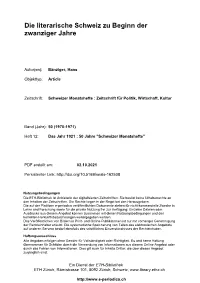
Die Literarische Schweiz Zu Beginn Der Zwanziger Jahre
Die literarische Schweiz zu Beginn der zwanziger Jahre Autor(en): Bänziger, Hans Objekttyp: Article Zeitschrift: Schweizer Monatshefte : Zeitschrift für Politik, Wirtschaft, Kultur Band (Jahr): 50 (1970-1971) Heft 12: Das Jahr 1921 : 50 Jahre "Schweizer Monatshefte" PDF erstellt am: 02.10.2021 Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-162538 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch http://www.e-periodica.ch Die literarische Schweiz zu Beginn der zwanziger Jahre HANS BÄNZIGER Wie beurteilt man, von weither und nach einem halben Jahrhundert, die Literatur der Schweiz zu Beginn der zwanziger Jahre Am besten vielleicht vom Oberflächlichsten ausgehend, indem man den Bestand einer mittleren amerikanischen Bibliothek mustert. -

Forced and Slave Labor in Nazi-Dominated Europe
UNITED STATES HOLOCAUST MEMORIAL MUSEUM CENTER FOR ADVANCED HOLOCAUST STUDIES Forced and Slave Labor in Nazi-Dominated Europe Symposium Presentations W A S H I N G T O N , D. C. Forced and Slave Labor in Nazi-Dominated Europe Symposium Presentations CENTER FOR ADVANCED HOLOCAUST STUDIES UNITED STATES HOLOCAUST MEMORIAL MUSEUM 2004 The assertions, opinions, and conclusions in this occasional paper are those of the authors. They do not necessarily reflect those of the United States Holocaust Memorial Council or of the United States Holocaust Memorial Museum. First printing, April 2004 Copyright © 2004 by Peter Hayes, assigned to the United States Holocaust Memorial Museum; Copyright © 2004 by Michael Thad Allen, assigned to the United States Holocaust Memorial Museum; Copyright © 2004 by Paul Jaskot, assigned to the United States Holocaust Memorial Museum; Copyright © 2004 by Wolf Gruner, assigned to the United States Holocaust Memorial Museum; Copyright © 2004 by Randolph L. Braham, assigned to the United States Holocaust Memorial Museum; Copyright © 2004 by Christopher R. Browning, assigned to the United States Holocaust Memorial Museum; Copyright © 2004 by William Rosenzweig, assigned to the United States Holocaust Memorial Museum; Copyright © 2004 by Andrej Angrick, assigned to the United States Holocaust Memorial Museum; Copyright © 2004 by Sarah B. Farmer, assigned to the United States Holocaust Memorial Museum; Copyright © 2004 by Rolf Keller, assigned to the United States Holocaust Memorial Museum Contents Foreword ................................................................................................................................................i -

Bibliographie
507 Bibliographie Allgemeine Nachschlagewerke und Bonorand, Conradin: Joachim Vadian. In: Füssel, Ste- Literaturgeschichten phan/Paschen, Christine (Hg.): Deutsche Dichter der frühen Neuzeit (1450 1600): Ihr Leben und Werk. Arnold, Heinz Ludwig: Kritisches Lexikon der deutsch- Berlin 1993, S. 345–358. sprachigen Gegenwartsliteratur (KLG). München Brandt, Rüdiger: Konrad von Würzburg. Kleinere epi- 1978 ff. sche Werke. Berlin 2000. Baechtold, Jakob: Geschichte der Deutschen Literatur in Brinker, Claudia/Flühler-Kreis, Dione (Hg.): edele frou- der Schweiz. Frauenfeld 1892. wen – schoene man. Die Manessische Liederhand- Calgari, Guido: Storia delle quattro litterature della schrift in Zürich. Ausstellungskatalog. Zürich 1991. Svizzera. Milano 1958/Firenze 1968 [dt.: Die vier Li- Brülisauer, Josef/Hermann, Claudia (Hg.): Die Spreuer- teraturen der Schweiz. Olten/Freiburg 1966]. brücke in Luzern. Ein barocker Totentanz von euro- Camartin, Iso/Francillon, Roger/Jakubec-Vodoz, Doris/ päischer Bedeutung. Luzern 1996. Käser, Rudolf/Orelli, Giovanni/Stocker, Beatrice: Die Dilg, Peter/Rudolph, Hartmut (Hg.): Neue Beiträge zur vier Literaturen der Schweiz. Zürich 1995, 2. Aufl. Paracelsus-Forschung. Stuttgart 1995. 1998. Fischer, Ursel: Meister Johans Hadloub: Autorbild und Ermatinger, Emil: Dichtung und Geistesleben der deut- Werkkonzeption der Manessischen Liederhandschrift. schen Schweiz. München 1933. Stuttgart 1996. Gsteiger, Manfred (Hg.): Die zeitgenössischen Literatu- Füssel, Stephan (Hg.): Deutsche Dichter der Frühen ren der Schweiz (Kindlers Literaturgeschichte der Neuzeit (1450–1600). Ihr Leben und Werk. Berlin Gegenwart, 4). 2. Aufl. 1980. 1993. Historisches Lexikon der Schweiz. Basel 2002 ff. [Online Gaberell, Roger: Der Psalter Notkers III. von St. Gallen abrufbar unter: http://www.snl.ch/dhs/externe/pro und seine Textualität. St. Gallen 2000. tect/deutsch.html]. Gaier, Ulrich: Vadian und die Literatur des 16. -

Indice V Prefazione Di Roger Francillon 3 Avvertenza 7 Introduzione 25 Anelito Preromantico Gli Esordi Lirici in Lingua Tedesca
Indice V Prefazione di Roger Francillon 3 Avvertenza 7 Introduzione 25 Anelito preromantico Gli esordi lirici in lingua tedesca 27 Albrecht von Haller 31 Salomon Gessner 35 Lo spirito e la terra Il cosmopolitismo nella letteratura romanda fra sette e ottocento 39 Isabelle de Charrière 43 Germaine de Staël 47 Benjamin Constant 53 Charles-Victor de Bonstetten 56 Henri-Frédéric Amiel 59 Liberi e svizzeri Scrittori politici di lingua italiana 62 Vincenzo Dalberti 65 Stefano Franscini 69 Chimere dell’assoluto Narrativa svizzera tedesca dell’ottocento 72 Jeremias Gotthelf 84 Gottfried Keller 99 Conrad Ferdinand Meyer 111 Cari Spitteler 117 Rinascita di un’identità La letteratura retoromancia 121 Giachen Caspar Muoth 123 Peider Lansel 127 Idilli lacustri e montani Residui ottocenteschi nella narrativa svizzera italiana 129 Francesco Chiesa 135 Angelo Nessi 139 Giuseppe Zoppi 143 Tra simbolo e realtà La letteratura romanda agli esordi del novecento 146 Charles-Ferdinand Ramuz 155 Gonzague de Reynold 159 Guy de Pourtalès 162 Charles-Albert Cingria 165 Denis de Rougemont 169 Heimatlose Narrativa e poesia svizzere tedesche d’inizio novecento, fra critica sociale e straniamento 171 Jakob Bührer 175 Rudolf Jakob Humm 179 Kurt Guggenheim 183 Meinrad Inglin 188 Ludwig Hohl 192 Hermann Hesse 203 Robert Walser 214 Jakob Schaffner 218 Friedrich Glauser 225 Karl Stamm 227 Basta con le pannocchie al sole Poesia e prosa nella Svizzera italiana dagli anni quaranta 229 Pino Bernasconi 231 Felice Menghini 233 Remo Fasani 236 Amleto Pedroli 239 Ugo Canonica 243 -

Switzerland – a Model for Solving Nationality Conflicts?
PEACE RESEARCH INSTITUTE FRANKFURT Bruno Schoch Switzerland – A Model for Solving Nationality Conflicts? Translation: Margaret Clarke PRIF-Report No. 54/2000 © Peace Research Institute Frankfurt (PRIF) Summary Since the disintegration of the socialist camp and the Soviet Union, which triggered a new wave of state reorganization, nationalist mobilization, and minority conflict in Europe, possible alternatives to the homogeneous nation-state have once again become a major focus of attention for politicians and political scientists. Unquestionably, there are other instances of the successful "civilization" of linguistic strife and nationality conflicts; but the Swiss Confederation is rightly seen as an outstanding example of the successful politi- cal integration of differing ethnic affinities. In his oft-quoted address of 1882, "Qu’est-ce qu’une nation?", Ernest Renan had already cited the confederation as political proof that the nationality principle was far from being the quasi-natural primal ground of the modern nation, as a growing number of his contemporaries in Europe were beginning to believe: "Language", said Renan, "is an invitation to union, not a compulsion to it. Switzerland... which came into being by the consent of its different parts, has three or four languages. There is in man something that ranks above language, and that is will." Whether modern Switzerland is described as a multilingual "nation by will" or a multi- cultural polity, the fact is that suggestions about using the Swiss "model" to settle violent nationality-conflicts have been a recurrent phenomenon since 1848 – most recently, for example, in the proposals for bringing peace to Cyprus and Bosnia. However, remedies such as this are flawed by their erroneous belief that the confederate cantons are ethnic entities. -

Switzerland – Second World War Schlussbericht Der Unabhängigen Expertenkommission Schweiz – Zweiter Weltkrieg
Final Report of the Independent Commission of Experts Switzerland – Second World War Schlussbericht der Unabhängigen Expertenkommission Schweiz – Zweiter Weltkrieg Rapport final de la Commission Indépendante d'Experts Suisse – Seconde Guerre Mondiale Rapporto finale della Commissione Indipendente d'Esperti Svizzera – Seconda Guerra Mondiale Final Report of the Independent Commission of Experts Switzerland – Second World War Members: Jean-François Bergier, Chairman Wladyslaw Bartoszewski Saul Friedländer Harold James Helen B. Junz (from February 2001) Georg Kreis Sybil Milton (passed away on 16 October 2000) Jacques Picard Jakob Tanner Daniel Thürer (from April 2000) Joseph Voyame (until April 2000) Independent Commission of Experts Switzerland – Second World War Switzerland, National Socialism and the Second World War Final Report PENDO Secretary General: Linus von Castelmur (until March 2001), Myrtha Welti (from March 2001) Scientific Project Management: Stefan Karlen, Martin Meier, Gregor Spuhler (until March 2001), Bettina Zeugin (from February 2001) Scientific-Research Adviser: Marc Perrenoud ICE Database: Development – Management: Martin Meier, Marc Perrenoud Final Report Editorial Team / Coordination: Mario König, Bettina Zeugin Production Assistants: Estelle Blanc, Regina Mathis Research Assistants: Barbara Bonhage, Lucas Chocomeli, Annette Ebell, Michèle Fleury, Gilles Forster, Marianne Fraefel, Stefan Frech, Thomas Gees, Frank Haldemann, Martina Huber, Peter Hug, Stefan Karlen, Blaise Kropf, Rodrigo López, Hanspeter Lussy, Sonja -

Swiss National Library 106Th Annual Report 2019
Swiss National Library 106th Annual Report 2019 Unveiling the stamp marking the 100th anniversary of Designer Bea Würgler from Bern signing the Carl Spitteler stamp Carl Spitteler’s Nobel Prize in Literature Bärndütschi dialect chansons with deeper meanings by Noti On Museum Night, the historic reading room became a racing Wümié, aka Benjamin „Toni” Noti and Grégoire „Greis” Vuilleumier track for drones View of the exhibition „Martin Disler – Rituels oubliés” „Chamanisme sibérien et musique d’ici en dialogue” at the CDN performance at the CDN Table of contents Key Figures 2 Towards the future: the NL’s strategy 2020–2028 3 A participatory process in which the NL concentrates on its strengths 3 The building context: strategic objectives for an initial period up to 2023 3 A new strategy: continuity and some new priorities 3 Main Events – a Selection 5 Notable Acquisitions 8 Monographs 8 Prints and Drawings Department 9 Swiss Literary Archives 10 Swiss National Sound Archives 11 General Collection 12 New library management system 12 Building situation 12 Alignment of activities with the new strategy 12 Acquisitions 12 Catalogues 13 Preservation and conservation 13 Circulation 14 Information retrieval 14 Outreach 14 Prints and Drawings Department 16 Building situation 16 Collection 16 User services 16 Swiss Literary Archives 17 Collection 17 Outreach 17 User services 17 Swiss National Sound Archives 18 Some figures 18 Collection 18 Outreach 18 Centre Dürrenmatt Neuchâtel 19 Budget and Expenditures 20 Commission and Management Board 21 Organization