Workshop Prof. Carin Van Heerden: „Diminution – Passaggio – Maniera“
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Le Ray Au Soleyl
Le Ray au Soleyl Musica alla corte dei Visconti alla fine del XIV secolo B © fra bernardo,f Wien 2011 LE RAY AU SOLEYL Musica alla corte dei Visconti alla fine del XIV secolo «... quando un’anima riceve un’impressione di bellezza non sensibile non in modo astratto, ma attraverso un’impressione reale e diretta, come quella avvertita quando si percepisce un canto» Simone Weil «Il canto è un animale aereo» Marsilio Ficino Verso la CORTE Del CoNTE DI VIRTÙ, sulle orme DI PETrarCA Nell’ultimo trentennio del Trecento e nei primi anni del Quattrocento il medioevo splende come una foglia d’autunno che sta per cadere e rivela colori impredicibili e irripetibili poiché conseguenza della sua estate e non di altre. L’Ars nova sembra arrivare a una fase di incandescenza, di ebbrezza per gli incredibili conseguimenti notazionali, che si accompagnano a una perizia estrema nell’arte del contrappunto e a una padronanza dell’intenzione retorica che ancora oggi si è soliti concedere solo ad epoche assai posteriori. Eminente- mente in Francia e in Italia, fioriscono maestri che raffinano l’arte musicale conducendola a vette da cui è difficile immaginare di poter muovere un solo passo ulteriore. Essi infatti giungono alle soglie della modernità, si affacciano arditamente sul Tempo Nuovo, ma per morirvi quasi senza eredità. Le prime testimonianze che legano il nome dei Visconti alla musica e ai musicisti sono più antiche di qualche decennio rispetto a questa sta- gione ultima. Risalgono infatti al II quarto del XIV secolo e ai primi maestri dell’Ars nova italiana: in particolare a Maestro Piero, Giovanni da Cascia e Jacopo da Bologna. -

JAMES D. BABCOCK, MBA, CFA, CPA 191 South Salem Road Ridgefield, Connecticut 06877 (203) 994-7244 [email protected]
JAMES D. BABCOCK, MBA, CFA, CPA 191 South Salem Road Ridgefield, Connecticut 06877 (203) 994-7244 [email protected] List of Addendums First Addendum – Middle Ages Second Addendum – Modern and Modern Sub-Categories A. 20th Century B. 21st Century C. Modern and High Modern D. Postmodern and Contemporary E. Descrtiption of Categories (alphabetic) and Important Composers Third Addendum – Composers Fourth Addendum – Musical Terms and Concepts 1 First Addendum – Middle Ages A. The Early Medieval Music (500-1150). i. Early chant traditions Chant (or plainsong) is a monophonic sacred form which represents the earliest known music of the Christian Church. The simplest, syllabic chants, in which each syllable is set to one note, were probably intended to be sung by the choir or congregation, while the more florid, melismatic examples (which have many notes to each syllable) were probably performed by soloists. Plainchant melodies (which are sometimes referred to as a “drown,” are characterized by the following: A monophonic texture; For ease of singing, relatively conjunct melodic contour (meaning no large intervals between one note and the next) and a restricted range (no notes too high or too low); and Rhythms based strictly on the articulation of the word being sung (meaning no steady dancelike beats). Chant developed separately in several European centers, the most important being Rome, Hispania, Gaul, Milan and Ireland. Chant was developed to support the regional liturgies used when celebrating Mass. Each area developed its own chant and rules for celebration. In Spain and Portugal, Mozarabic chant was used, showing the influence of North Afgican music. The Mozarabic liturgy survived through Muslim rule, though this was an isolated strand and was later suppressed in an attempt to enforce conformity on the entire liturgy. -

Departement Künste, Medien, Philosophie Repertoireliste
Departement Künste, Medien, Philosophie Universität Basel, Musikwissenschaftliches Seminar, Petersgraben 27, CH-4051 Basel Repertoireliste Bachelorstudienfach Musikwissenschaft Die nachstehende Repertoireliste dient der Vorbereitung auf die Bachelorprüfung für Studierende, die ihr Studium im oder nach dem HS 2013 aufgenommen haben. Die Prüfungsordnung sieht vor, dass im Bereich der älteren wie auch der neueren Musik je eine Prüfungsfrage Repertoirekenntnisse behandelt. Zur Handhabung Die Repertoireliste setzt sich aus je 30 Werken der älteren und neueren Musikgeschichte zusammen, die – aus durchaus unterschiedlichen Gründen – als repräsentativ für musikhistorische Phänomene angesehen werden können. Da eine solche Zusammenstellung stets willkürlich erfolgt, ist jedes der unten aufgeführten Werke austauschbar und damit an individuelle Interessen und Kenntnisse der Studierenden anpassbar. Bedingung für Änderungen ist, dass die rechte Spalte (,Klassifizierung’) in Kombination mit der genannten Epoche für das gewählte Werk weiterhin erfüllt ist und die Gesamtzahl der Werke nicht verändert wird. So könnte beispielsweise in der Liste der Neueren Musik die unter Nr. 7 genannte Beethoven-Sinfonie durch eine Sinfonie Mozarts oder eines anderen Komponisten / einer anderen Komponistin dieser Zeit ersetzt werden, nicht aber durch eine Bruckner-Sinfonie oder ein Klavierkonzert Beethovens. Empfohlen wird, bereits in den ersten Semestern des Studiums mit der Abarbeiten der vorgeschlagenen bzw. dem Anlegen einer eigenen Liste zu beginnen. Durch die Kenntnis der je 30 Werke sollten die Studierenden (durch Hör- bzw. Notenstudium) in der Lage sein, allgemeinere Fragen zur Stilistik, Form oder zum musikgeschichtlichen Kontext der jeweiligen Werke beantworten zu können. Sämtliche Änderungsvorschläge müssen im Vorfeld natürlich rechtzeitig mit den Prüfenden abgesprochen werden. Universität Basel Musikwissenschaftliches Seminar Petersgraben 27 4051 Basel, Switzerland mws.unibas.ch i Repertoireliste Bachelor Musikwissenschaft Ältere Musik Nr. -
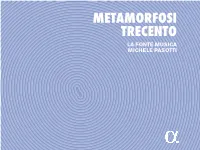
Philippe De Vitry
METAMORFOSI TRECENTO LA FONTE MUSICA MICHELE PASOTTI MENU TRACKLIST LE MYTHE DE LA TRANSFORMATION DANS L’ARS NOVA PAR MICHAEL SCOTT CUTHBERT METAMORFOSI TRECENTO PAR MICHELE PASOTTI MICHELE PASOTTI & LA FONTE MUSICA BIOS FRANÇAIS / ENGLISH / DEUTSCH TEXTES CHANTÉS MENU METAMORFOSI TRECENTO FRANCESCO LANDINI DA FIRENZE (c.1325-1397) 1 SÌ DOLCE NON SONÒ CHOL LIR’ ORFEO 2’21 PAOLO DA FIRENZE (c.1355-after 1436) 2 NON PIÙ INFELICE 5’51 JACOPO DA BOLOGNA (f.1340-c.1386) 3 FENICE FU’ 2’11 ANONYME (c.1360?) 4 TRE FONTANE (INSTRUMENTALE) 7’15 PHILIPPE DE VITRY (1291-1361) 5 IN NOVA FERT/GARRIT GALLUS/NEUMA 2’49 GUILLAUME DE MACHAUT (c.1300-1377) 6 PHYTON, LE MERVILLEUS SERPENT 4’32 SOLAGE (f.1370-1403) 7 CALEXTONE 4’40 ANTONIO ‘ZACARA’ DA TERAMO (1350/60-after 1413) 8 IE SUY NAVRÉS/GNAFF’A LE GUAGNELE 2’44 4 FILIPPOTTO DA CASERTA (f.2nd half XIVth century) 9 PAR LE GRANT SENZ D’ADRIANE 9’54 MAESTRO PIERO (f.first half XIVth century) 10 SÌ COM’AL CANTO DELLA BELLA YGUANA 4’02 NICCOLÒ DA PERUGIA (f.2nd half XIVth century) 11 QUAL PERSEGUITA DAL SUO SERVO DANNE 4’33 BARTOLINO DA PADOVA (c.1365-1405) 12 STRINÇE LA MAN (INSTRUMENTALE) 1’17 JACOPO DA BOLOGNA 13 NON AL SU’ AMANTE PIÙ DIANA PIACQUE 3’26 MATTEO DA PERUGIA (fl. ca.1400-1416) 14 GIÀ DA RETE D'AMOR 5’02 JACOPO DA BOLOGNA 15 SÌ CHOME AL CHANTO DELLA BELLA YGUANA 3’02 TOTAL TIME: 63’39 5 MENU LA FONTE MUSICA MICHELE PASOTTI MEDIEVAL LUTE & DIRECTION FRANCESCA CASSINARI SOPRANO ALENA DANTCHEVA SOPRANO GIANLUCA FERRARINI TENOR MAURO BORGIONI BARITONE EFIX PULEO FIDDLE TEODORO BAÙ FIDDLE MARCO DOMENICHETTI RECORDER FEDERICA BIANCHI CLAVICYMBALUM MARTA GRAZIOLINO GOTHIC HARP 6 MENU LE MYTHE DE LA TRANSFORMATION DANS L’ARS NOVA PAR MICHAEL SCOTT CUTHBERT Il a fallu une sorcière ayant le pouvoir de transformer les hommes en porcs pour amener Ulysse à perdre tous les autres plaisirs au monde ; mais, pour moi, il suffirait que tu sois mienne pour me faire renoncer à tout autre désir. -

From Poet's Aid to Courtier's Pastime: an Examination of the Shift in Visual Style and Sounding Function of Italian Viols During the Renaissance
FROM POET'S AID TO COURTIER'S PASTIME: AN EXAMINATION OF THE SHIFT IN VISUAL STYLE AND SOUNDING FUNCTION OF ITALIAN VIOLS DURING THE RENAISSANCE by JACOB A. MARIANI A THESIS Presented to the School of Music and Dance and the Graduate School of the University of Oregon in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts June 2014 THESIS APPROVAL PAGE Student: Jacob A. Mariani Title: From Poet's Aid to Courtier's Pastime: An Examination of the Shift in Visual Style and Sounding Function of Italian Viols During the Renaissance This thesis has been accepted and approved in partial fulfillment of the requirements for the Master of Arts degree in the School of Music and Dance by: Marc Vanscheeuwijck Chair Lori Kruckenberg Core Member Eric Mentzel Core Member and Kimberly Andrews Espy Vice President for Research and Innovation; Dean of the Graduate School Original approval signatures are on file with the University of Oregon Graduate School. Degree awarded June 2014 ii Copyright 2014 Jacob A. Mariani iii THESIS ABSTRACT Jacob A. Mariani Masters of Arts School of Music and Dance June 2014 Title: From Poet's Aid to Courtier's Pastime: An Examination of the Shift in Visual Style and Sounding Function of Italian Viols During the Renaissance This thesis examines evidence of the earliest viols in Italy. In light of recent changes in perspective on the origins of the Italian viola da gamba, a new approach to building historical models of the instrument is necessary. By using Castiglione’s description of violas as a significant signpost, I have developed a clearer picture of the early viola da gamba’s socio-musical context. -

EXPLANATION 1.10: ARS NOVA 1. the 13Th CENTURY: Ars Antiqua
UNIT 1: THE MIDDLE AGES EXPLANATION 1.10: ARS NOVA EXPLANATION 1.10: ARS NOVA 1. THE 13th CENTURY: Ars Antiqua. The 13th century saw the birth of cities, universities, the great Gothic cathedrals, the great medieval pictorial and literary works, and the motet in music. The 13th century, in music, is the "classic" period of the Middle Ages known as Ars Antiqua. Music theory was also developed thanks to two musicians: • Franco de Colonia: his contribution is on the duration of the notes, that is visible with the written notes (not like gregorian neumes). His works are known as Franconian motets. This is published in his treatise Ars Cantus Mensurabilis of 1260, in the middle of the thirteenth century. • Petrus de Cruce, at the end of the 13th century, makes other contributions, such as inventing a system of notation similar to the current one. His works are known as Petronian motets. 2. THE 14th CENTURY:Ars Nova. In the 14th century wars and epidemics took place. Also, Constantinople fell into the hands of the Turks marking for many historians the end of the Middle Ages. In music there are important changes, especially in relation to rhythm, when a type of motete called isorhythmic motet arised. In them, the composer uses rhythmic patterns, called "talea", that he repeats throughout the entire work. Several taleas form a melody sung by the tenor voice. This melody, which is a succession of taleas, is called "color". In the musical aspect it is emphasized the new musical notation, the three voice polyphony with instruments, and the motet. -

RIME PER MUSICA E DANZA* Può Accedere Attraverso Una Delle Seguenti Tre Edd.: Cecco O'ascou, L'acerba, Con Prefazione, Note E Bibliografia Di P
SEZ . IV · VE RSO UN NUOVO SISTEMA DI VALORI CAPITOLO VII stituzione del testo il saggio di riferimento resta quello di H. PFLAUM, L':A.cerba', di Cecco d'Ascoli. Saggio d'interpretazione, in AR, vol. xxm 1939, pp. 178-241). Al poema s1 RIME PER MUSICA E DANZA* può accedere attraverso una delle seguenti tre edd.: CEcco o'Ascou, L'Acerba, con prefazione, note e bibliografia di P. RosARIO, Lancuno, Carabba, 1916; FRANCESC O di AGO STINO Z IINO STABILI (CEcco o'Ascou), L'Acerba, ridotta a m1ghor leZlone e per la pnma volta inte.t:rretata col sussidio di tutte le opere dell'autore e delle loro fon n dal Prof. Dott. A. CRESPI, Ascoli Piceno, Cesari, 1927 (ma vd. la ree. dt C. MAzzANTINI e G. I. TESTO POETICO E TESTO MUSICALE BERTONI, in GSLI, vol. xciv 1929, pp. 146-51); CEcco o'Ascou, L'Acerba, secondo la lezione del Codice Eugubino dell'anno 1376 [a cura di B. CEN SORI e E. VITTORI], Quasi tutta la poesia, indipendentemente dal genere o dalla forma, nel ---"Pl..scol11"icen0,19"7l-;-scelta-in-SA""PEGNO-;-PMT,-py.-745=59;-un-passo-in-8cNTmt;-_:betto-. ------ - l'amìdlitàcome netl\11echoevo è stata m qualcne modo associata al canto·-. - - Orig. , pp. 441-43. Perle opere latine: Il Commento di Cecco d'Ascoli all'Al~abizz o , ed1to a Già le den o minazioni di alcune forme poetiche nate n el Due-Trecento - cura del P. G. BoFFITO B. TA , Ftrerrze, Olschki, 1905; G. BoFFITO, Il De eccentnm et per limitarci all' Italia -, quali ad esempio canzone, sonetto, ballata, randello, epicyclis' di Cecco d'Ascoli nova mente scoperto e illustrato, in« La Bibliofilia» , vol. -

Produzione, Consumo E Diffusione Della Musica in Italia Nel Tardo Medioevo*
Produzione, consumo e diffusione della musica in Italia nel tardo medioevo* Galliano CILIBERTI Perugia. L'improvvisa, colta e raffinata fioritura musicale che si ebbe in Italia e in special modo a Firenze, nel XIV secolo e nei primi decenni del XV vide l'affermazione di due grandi e moderni concetti: la possibilità di misurare esattamente il tempo della musica e lo sviluppo della tecnica polifonica.1 *Base di questo lavoro è il percorso della mostra <<Amor che ne la mente mi ra giona», Firenze e l'Ars Nova del XIV secolo ideata assieme a Biancamaria Brumana e allestita a Firenze in Palazzo Vecchio (17-30 aprile 1986) dall'associazione Musicus Concentus per le manifestazioni di << Firenze Capitale Europea della Cultura>>. Per non appesantire il corpo delle note si fornisce di seguito l'elenco delle sigle delle fonti citate nel corso dei riferimenti: D-B40613 = Berlin, Staatsbibliothek, 40613 (olim Wernigerode, Flirstlich Stolbergsche Bibliothek, Zb. 14); D-Mbs352b = Miinchen Bayeri sche Staatsbibliothek, Cim. 352b ( olim 3725 ); F-Pn568 = Paris, Bibliothèque Nationale, fonds ital. 568; F-Pn4379 = Paris, Bibliothèque Nationale, fond.q nouv. acq. frç. 4379; F-Pn6771 = Paris, Bibliothèque Nationale, fonds nouv. acq. frç. 6771 (Cod. Reina); GB-Lbm29987 = London, British Museum, add. 29987; GB-Obll2 = Oxford, Bodleian Library, Can. Class. lat. 112; GB-Ob213 = Oxford, Bodleian Library, Can. mise. 213; I-Bc15 =Bologna, Civico Museo Bibliografico Musicale, Q 15 ( olim Liceo 37 ); I-Fcll75 =Firenze, Biblioteca del Conservatorio, D 1175; I-F187 = Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Med. Pal. 87 (Cod. Squarcialupi); I-Fn26 = Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Panciatichi 26; I-FZcll7 = Faenza, Biblioteca Comunale, 117; I-GR16 = Grottaferrata, Biblioteca della Badia Greca, E. -
AMS Quebec City 2007: Abstracts
AMS ASHGATENew Music Titles from Ashgate Publishing… American A Song for Europe Living Electronic Music Popular Music and Politics Simon Emmerson, De Montfort in the Eurovision Song Contest University, Leicester, UK Edited by Ivan Raykoff, The New School “…a superb exploration of how we perceive and understand today’s Musicological and Robert Deam Tobin, Whitman College ASHGATE POPULAR AND FOLK MUSIC SERIES technology-based music.” July 2007. 216 pages. Pbk. 978-0-7546-5879-5 —Joel Chadabe, State University of New York, Albany July 2007. 214 pages. Pbk. 978-0-7546-5548-0 Gender in the Music Industry Program & Abstracts Society Rock, Discourse and Girl Power Marion Leonard, University of Liverpool, UK The Memetics of Music ASHGATE POPULAR AND FOLK MUSIC SERIES A Neo-Darwinian View of Musical Aug 2007. 252 pages. Pbk. 978-0-7546-3862-9 Structure and Culture Steven Jan, University of Huddersfield, UK Quebec City 2007 Sept 2007. 294 pages. 978-0-7546-5594-7 Music in Medieval Europe 1−4 November Studies in Honour of Bryan Gillingham Edited by Terence Bailey, Kate Bush and University of Western Ontario, and Hounds of Love Abstracts Alma Santosuosso, Wilfrid Laurier University Ron Moy, Liverpool John Moores “…a seminal addition to the literature on University, UK medieval music…Highly recommended.” ASHGATE POPULAR AND FOLK MUSIC SERIES —Choice “…a fascinating account of this artist’s Jan 2007. 456 pages. 978-0-7546-5239-7 achievements…will undoubtedly be of use to a wide range of scholars within the field of popular music studies.” The Music of The Other —Stan Hawkins, University of Oslo, Norway New Challenges for Sept 2007. -
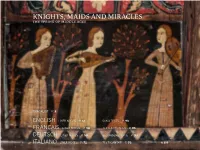
KNIGHTS, MAIDS and MIRACLES the Spring of Middle Ages
KNIGHTS, MAIDS AND MIRACLES the spring of middle ages TRACKLIST P. 2 ENGLISH LINER NOTES P. 12 SUNG TEXTS P. 93 FRANÇAIS LINER NOTES P. 30 TEXTES CHANTÉS P. 93 DEUTSCH LINER NOTES P. 50 GESUNGENE TEXTE P. 93 ITALIANO LINER NOTES P. 72 TESTI CANTATI P. 93 A 399 SPECVLVM AMORIS 2 Menu CD1 LYRICS OF MEDIAEVAL LOVE FROM MYSTICISM TO EROTICISM “Ther was a friar of order gray which loved a nunne ful meny a day; This friar was lusty, proper and yong - he offered the nunne to lerne her to syng.” (MS C.U.L., Add. 7350, 15th century] I “Adonc si leva e seina si, | San Blaze pregu’ e San Marti | que foron cavallier cortes | ques ab Dieu l’acaptron merces”. (Roman de Flamenca, c1260) 1 Laude novella sia cantata [Anonymous – Italy, late 13th century] 5’15 Cortona, Biblioteca Comunale e dell’Accademia Etrusca, MS 91 (Laudario di Cortona) — 1v, 1l/2v, 2r/3v, 3rb/4v, 4p/5s 2 Qualis est dilectus tuus [John Forest – England, late 14th century] 2’40 London, British Library, Add. MS 57950 (Old Hall) — 1l/2vl/3v/4v 3 Edi beo thu, hevene quene [Anonymous – England, 13th century] 3’17 Oxford, Corpus Christi College, MS 59 — 1l/2vl/3v, 3rb, 3h/4v, 4co 4 Procurans odium [Anonymous – France, 13th century] 2’28 Florence, Biblioteca Medicea Laurenziana, MS Pluteus 29.1 — 2r/3v/4co 5 Patrie pacis / Patria gaudentium [Anonymous – England, late 14th century] 2’28 Cambridge, Gonville and Caius College, MS 512/543 — 1l/2vl/3or/4v, 4co 6 Eya martyr Stephane [Anonymous – England, mid 15th century] 2’16 Cambridge, Trinity College Library, MS O.3.58 — 1l/2vl/3v, 3or/4v, 4p II «Se souvent vais al moustier | c’est tout pour veoir la belle | fresche comme rose nouvelle». -
Renaissance a History of Choral Music
A History of Choral Music 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 plainsong / chant (later: tenor) cantus firmus/missa/mass drone/organistrum? (controversial) ison/drone responsories precenting/lining out organum (4ths, 5ths, 8vas) +3rd, +6th +7th +9th, +2nd [since ~870] +duplum: organum duplum chorale & chorale motet [no 3rd, 6th] +triplum: motet anthem Sacred Harp gospel winds double or substitute instrumental accompaniment opera musical jazz & organ trecento chanson/canzone staff of keyboard madrigal cantata & oratorio theatre swing Guido d'Arezzo villancico barbershop rhythmic rhythmic notation of notation of Philippe de Vitry frottola madrigal caroling manuscripts Franco of Cologne printing Internet oral Notre Ars Ars tradition Antiqua Nova Renaissance Baroque Classical Romantic and Dame ModernistVernal neumes/ Francesco de Layolle Lechner de Lienas Boyce Gounod Distler Hawley Gothic........High Gothic Ferko znamën Claudin de Sermisy A. Lobo Jerusalem Biebl Gade Paulus Johannes Ciconia Nicolas Gombert Galuppi Duruflé Marenzio de Padilla T. A. Wal- Walton G. Ives Casciolini misley Philippe Verdelot Massaino Swayne Adam de la Halle Greene Verdi Finzi Zacara da Teramo John Taverner Tollius ThompsonRutter Pierre Passereau Leo Perotin Nicolò da Perugia Handl Gibbons Zipoli Liszt Weyrauch Tavener Adrian Willaert W.H.Harris CaurroyAllegri Schu- Kostiainen Leonin Francesco Landini Ludwig Senfl J.S.Bach mann Howells Clement Janequin Dering D. Scarlatti Mendels Mathews -sohn G. Holst St. Hildegard von Bingen Vicenzo da Rimini Robert Carver Victoria Durante Lauridsen S.S.Wesley Willan Donato da Cascia Richard Pygott Byrd Telemann Bainton Schrader Cost. & Sebast. Festa Applebaum Bishop Ato de Troyes Giovanni da Cascia White M. Franck Handel Berlioz Chesnokov Mateo Flecha, Sr. -

The Ensemble of the Fourteenth Century
THE ENSEMBLE OF THE FOURTEENTH CENTURY directed by John Griffiths and John Stinson Sopranos: Margo Adelson, Cathy Cameron Alto: Margaret Arnold Countertenors: Hartley Newnham, Ian McDonald Tenors: Lloyd Fleming, Geoffrey Cox Vielle: Ruth Wilkinson Lute: John Griffiths 1-12 Jacopo da Bologna 13-22 Giovanni da Firenze The Music of the Fourteenth Century is produced by the Fourteenth Century Recording Project, a performance research project funded by the University of Melbourne, La Trobe University and the Australian Research Grants Scheme. The project involves the collaboration of musicologists, literary scholars and performers under the direction of John Stinson and John Griffiths. The recordings resulting from this collaboration aim at being well-researched readings from the original sources, interpreted according to current scholarship. The Ensemble of the Fourteenth Century is a collective of specialist singers and instrumentalists brought together for the Fourteenth Century Recording Project. The ensemble was initially formed around the leading Australian medieval ensemble La Romanesca, which was expanded to provide the varied instrumental and vocal combinations required by the repertoire. Jacopo da Bologna Bologna. He tells us that they worked under could be associated with Florence in some the patronage of Mastino II della Scala, the way were also included. The performances 1 Sì come al canto (3 part version) 2’52” tyrant of Verona; and that they competed with on this record follow the readings of the 2 Sì come al canto (2 part version) 2’56” each other in the composition of “madrigals Panciatichiano manuscript wherever possible. 3 Fenice fu’ 2’17” and other songs of wonderful sweetness and When a work appears in a significantly 4 In su bei fiori 2’21” melodies of subtle intricacy”.