Die Kirche Und Die „Kärntner Seele“
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Gemeindezeitung Feber 2021
Amtliche Mitteilung · Zugestellt durch Post.at Gemeindezeitung www.steindorf.gv.at Amtliche Mitteilungen der Gemeinde Steindorf am Ossiacher See Nr. 1 | Februar 2021 | 34. Jahrgang Steindorf, Anlegestelle © Doris Eigner Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl Sonntag, 28. Feber 2021 Informationen zur Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl Seite 11 Kostenlose Beratungen zur beruflichen Weiterentwicklung Seite 12 Der Heizzuschuss kann bis zum 26. Februar 2021 beantragt werden Seite 14 Die Gemeinde Steindorf am Ossiacher See finden Sie auch auf www.facebook.com/GemeindeSteindorfamOssiachersee 2 zum Schutz der betroffenen Gemeindebürgerinnen und Gemeinde bürger. Aussicht Das gesamte Gemeindegebiet ist von vielen weiteren Wild- bächen und deren Einzugsgebieten geprägt. Vor allem die zunehmenden Wetterkapriolen und Unwetterereignisse in den letzten Jahren haben aufgezeigt, wie wichtig es zum Schutz des Siedlungsraumes ist, den notwendigen Hoch- wasserschutz voranzutreiben. Die Abteilung Wildbach- und Lawinenverbauung ist bereits mit der Ausarbeitung von Projekten betraut und wird demnächst erste Ergebnisse prä- sentieren. Diese gilt es zeitnah auszufinanzieren und umzu- setzen. Sehr geehrte Gemeindebürgerinnen TRINKWASSERVERSORGUNG DES und Gemeindebürger, GEMEINDEPFLICHTBEREICHES liebe Jugend, geschätzte Gäste! Zur Sicherstel- lung und Ge- währleistung ei- ie aktuelle Legislaturperiode neigt sich dem Ende ner guten Was- Dzu und wir alle blicken der bevorstehenden Gemein- serqualität war de- und Bürgermeisterwahl gespannt entgegen. Die letzten es erforderlich, sechs Jahre waren eine besondere, auch eine fordernde Zeit in die Wasser- für mich und ich bin stolz auf die vielen positiven Entwick- versorgungsan- lungen, die ich miterleben und -gestalten durfte! lage Bodens- dorf zu inves- Zusätzlich zu den ohnehin großen Herausforderungen der tieren. Mit dem Projekt Hochbehälter und Entsäuerungs- Zukunft stellt seit Anfang 2020 die Corona-Pandemie unsere anlage inklusive Druckunterbrecher und Leitungsführun- Lebens- und Arbeitsweise auf den Kopf. -

(Rechtlich Nicht Verbindlich) 01.07.2021 Gemeinde KG Ka
Kärnten unbewegliche und archäologische Denkmale unter Denkmalschutz 01.07.2021 (rechtlich nicht verbindlich) Gemeinde KG Katalogtitel Adresse GSTK-Nr. Denkmalschutzstatus Afritz am See 75401 Afritz Mesnerhaus Dorfstraße 26, 9542 Afritz am See (Afritz) 362 Denkmalschutz per Verordnung Afritz am See 75401 Afritz Kath. Pfarrkirche hl. Nikolaus und Friedhof Dorfstraße 15, 9542 Afritz am See (Afritz) .67, 375/4 Denkmalschutz per Verordnung Denkmalschutz per Bescheid Afritz am See 75401 Afritz Ehem. Pflegerhaus der Grafen Porcia Gassen 1 9542 Afritz am See 727 (Unterschutzstellung §3) Kalvarienweg 12, 9542 Afritz am See (Berg ob Afritz am See 75404 Berg ob Afritz Kalvarienbergkapelle Afritz) (gegenüber) .74 Denkmalschutz per Verordnung Denkmalschutz per Bescheid Albeck 72301 Albeck Schloss Neualbeck Neualbeck 1 9571 Albeck .2 (Feststellungsbescheid §2 positiv) Albeck 72301 Albeck Burgruine Alt-Albeck Sirnitz 9571 Albeck 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 738, 739 Denkmalschutz per Verordnung Albeck 72313 Großreichenau Kath. Filialkirche hl. Ruprecht Sankt Ruprecht 9571 Albeck .72 Denkmalschutz per Verordnung Albeck 72335 Sirnitz Pfarrhof Sirnitz 21, 9571 Albeck (Sirnitz) .20/1 Denkmalschutz per Verordnung Anlage Kath. Pfarrkirche hl. Nikolaus und Albeck 72335 Sirnitz Kirchhof mit Karner und Kriegerdenkmal Sirnitz 9571 Sirnitz .1, .252 Denkmalschutz per Verordnung Albeck 72329 St. Leonhard Kapelle hl. Leonhard Benesirnitz 9571 St. Leonhard .65 Denkmalschutz per Verordnung Albeck 72329 St. Leonhard Kath. Filialkirche hl. Leonhard im Bade Benesirnitz 9571 St. Leonhard .64 Denkmalschutz per Verordnung Albeck 72329 St. Leonhard Evang. Pfarrkirche A.B. Benesirnitz 9571 St. Leonhard .16/1 Denkmalschutz per Verordnung Denkmalschutz per Bescheid Althofen 74001 Althofen Burg, ehem. Fronfeste Burgstraße 12, 9330 Althofen .20 (Unterschutzstellung §3) Denkmalschutz per Bescheid Althofen 74001 Althofen Wohnhaus Burgstraße 3, 9330 Althofen .35 (Unterschutzstellung §3) Denkmalschutz per Bescheid Althofen 74001 Althofen Wohnhaus, ehem. -

Central CARINTHIA PLACES to VISIT
CENTRAL CARINTHIA PLACES TO VISIT UNWIND AND DISCOVER UNSPOILT AUTHENTICITY SUPPORTED BY where paths ‹› flourish 3 CENTRALCARINTHIA REGION THE AUTHENTIC TRAVEL EXPERIENCE CULTURE (ELECTRIC) E-BIKING The country between Hochosterwitz and Gurk, around the ducal Steeped in history as it is, Central Carinthia is bursting with seat of St. Veit and beyond the medieval town walls of Friesach, energy and is also looking to the future. At the Tourist Office on has always been the historic heart of Carinthia. Even today, the St. Veit’s Hauptplatz (main town square) energy-saving e-bikes perfectly preserved castles, the magnificent stately homes, the stand ready and waiting. With their help you can explore Central family inns so rich in tradition, the age-old pilgrim ways and the Carinthia in an environmentally friendly manner, allowing you to cultural landscape that has developed in harmony with nature all master this tract of country completely as the fancy takes you. bear witness to this fact. The electric power for the bikes is from the renewable energy sources, for which the innovative St. Veit “Energy-Cluster” is famous. where paths ‹› flourish Explore the Heart of Carinthia CULINARY DELIGHTS PILGRIMAGES Where travellers, tradesmen and pilgrims once rested on their From time immemorial there have been especially spiritual sites Central Carinthia – where pristine valleys and gentle mountain steeped in history meet the modern age; together they offer a journeys, lodging houses and inns grew up with rich traditions in Central Carinthia, where believers have founded churches and landscapes definitively shape Carinthia’s historic heart. Where truly exceptional experience, mediated by paths and by-ways that behind them; to this very day, they are still run as family businesses. -

BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT FELDKIRCHEN Epidemiegesetz
BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT FELDKIRCHEN Bereich 7 – Wasserrecht DVR 0006068 Datum 14.03.2020 Zahl FE5-GES-261/2020 (071/2020) Bei Eingaben Geschäftszahl anführen! Auskünfte Mag. Derhaschnig Telefon 050 536-67264 Fax 050 536-67200 E-Mail [email protected] Seite 1 von 2 Betreff: Epidemiegesetz 1950 Verordnung betreffend die Schließung des Seilbahnbetriebes und von Beherbergungsbetrieben zur Verhinderung der Ausbreitung von SARS-CoV-2 - Begleitschreiben In der Anlage wird eine adaptierte Ausfertigung der Verordnung der Bezirkshauptmannschaft Feldkirchen vom 14.03.2020, Zl.: FE5-GES-261/2020 (070/2020), mit der Maßnahmen betreffend die Schließung des Seilbahnbetriebs und von Beherbergungsbetrieben zur Verhinderung der Ausbreitung von SARS-CoV-2 verfügt werden, übermittelt. Die am heutigen Nachmittag übermittelte Verordnung wird somit ersetzt. Mit freundlichen Grüßen! Für den Bezirkshauptmann: Mag. Derhaschnig Ergeht an: 1. Amt der Kärntner Landesregierung, Abt. 1 – Landesamtsdirektion, Landespressebüro, [email protected]; mit dem Ersuchen um Kundmachung in der Kärntner Landeszeitung; 2. Gemeinde Albeck, Sirnitz 1, 9571 Sirnitz; per email: [email protected]; mit der Bitte um Anschlag an der Amtstafel und Übermittlung der Dokumentation des Anschlags (Anschlagzeitpunkt); 3. Stadtgemeinde Feldkirchen in Kärnten, Hauptplatz 5, 9560 Feldkirchen; per email: [email protected]; mit der Bitte um Anschlag an der Amtstafel und Übermittlung der Dokumentation des Anschlags (Anschlagzeitpunkt); 4. Gemeinde Glanegg, Glanegg 20, 9555 Glanegg; per email: [email protected] mit der Bitte um Anschlag an der Amtstafel und Übermittlung der Dokumentation des Anschlags (Anschlagzeitpunkt); 5. Gemeinde Gnesau, Gnesau 77, 9563 Gnesau; per email: [email protected] mit der Bitte um Anschlag an der Amtstafel und Übermittlung der Dokumentation des Anschlags (Anschlagzeitpunkt); 6. -

Mitteilungsblatt April 2012
Amtliche Mitteilung · Zugestellt durch Post.at Mitteilungsblatt der Gemeinde Himmelberg Nummer 76 April 2012 Jahrgang 28 Foto: LPD/Lobitzer Verleihung der Goldenen Medaille für Verdienste um die Republik Österreich an Rudolf Kofler. Die Gemeinde Himmelberg gratuliert recht herzlich! Mitteilungsblatt der Gemeinde 2 Aus dem Gemeinderat Himmelberg . aus dem Gemeinderat – April 2012 ♦ Änderung des Stellenplanes ♦ Altentag 2012 Infolge Ruhestandsversetzung des Amtsleiters Ernst Pretis per Für den Altentag im September 2012 wird ein Betrag von € 30.09.2012 ist geplant, zwecks Einarbeitung des Nachfolgers 1.500,00 zur Verfügung gestellt. diesen schon mit 02. Mai 2012 einzustellen. Gleichzeitig mit dem Beschluss auf Aufnahme, wird auch ein Beschluss auf Än- ♦ Angebote Problemstoffsammlungen und Entrümpelung derung des Stellenplanes erfolgen. 2012 und 2013 Als Billigstbieterin wird der Auftrag an die Fa. Huber Entsor- ♦ Wasserverband Ossiachersee: Nominierung Ersatzmit- gung in Feldkirchen vergeben. Die Entrümpelung soll gleich glied für den Vorstand und Mitglied der Schlichtungsstelle wie im Vorjahr durchgeführt werden. Als Ersatzmitglied für das Vorstandsmitglied: wird der 1. Vzbgm. Johann Roblek und als Mitglied der Schlichtungsstel- ♦ Firma Huber - Preisanpassung ab 2012 le: Herr DI (FH) Armin Buttazoni nominiert. Dem Ansuchen der Fa. Huber Entsorgung in Feldkirchen wird der Preisanpassung stattgegeben: 2,5 % Erhöhung im Jahr 2012 ♦ Kirchenchor Himmelberg – Ansuchen um Unterstützung und eine weitere Erhöhung um 2,5 % im Jahr 2013 ausgehend Für die häufigen kulturellen Aktivitäten in der Gemeinde wird vom Preiswert 2011. dem Kirchenchor für den Ankauf eines Ablageschrankes eine finanzielle Unterstützung von € 300.-- gewährt. ♦ Flurreinigungsaktion 2012 Gemeinsam mit der Feuerwehr, den Vereinen, der Gemeinde ♦ Verordnung mit welcher die Ortstaxen ausgeschrieben und der Bevölkerung wurde im April 2012 eine Flurreinigungs- werden aktion durchgeführt, die Kosten werden von der Gemeinde Zufolge Änderung des Orts- und Nächtigungstaxengesetzes, ist übernommen. -

STELLUNGSKUNDMACHUNG 2009 Auf Grund Des § 18 Abs
M i l i t ä r k o m m a n d o K ä r n t e n Ergänzungsabteilung: 9020 KLAGENFURT, Windisch-Kaserne, Rosenbergstraße 1-3 Parteienverkehr: Montag bis Freitag von 0800 bis 1400 Uhr Telefon: 0463 / 5863 - 0 STELLUNGSKUNDMACHUNG 2009 Auf Grund des § 18 Abs. 1 des Wehrgesetzes 2001, BGBl. I Nr. 146/2001, haben sich alle österreichischen Staatsbürger männlichen Geschlechtes des G E B U R T S J A H R G A N G E S 1 9 9 1 sowie alle älteren wehrpflichtigen Jahrgänge, die bisher der Stellungspflicht noch nicht nachgekommen sind, gemäß dem unten angeführten Plan der Stellung zu unterzie- hen. Österreichische Staatsbürger des Geburtsjahrganges 1991 oder eines älteren Geburtsjahrganges, bei denen die Stellungspflicht erst nach dem in dieser Stellungskund- machung festgelegten Stellungstag entsteht, haben am 10.12.2009 zur Stellung zu erscheinen, sofern sie nicht vorher vom Militärkommando persönlich geladen wurden. Für Stellungspflichtige, welche ihren Hauptwohnsitz nicht in Österreich haben, gilt diese Stellungskundmachung nicht. Sie werden gegebenenfalls gesondert zur Stellung aufgefordert. Für die Stellung ist insbesondere Folgendes zu beachten: 1. Für den Bereich des Militärkommandos KÄRNTEN werden die Stellungspflichtigen durch die Stellungskommission 4. Wehrpflichtige, die das 17. Lebensjahr vollendet haben, können sich bei der Ergänzungsabteilung des Militärkom- des Militärkommandos KÄRNTEN der Stellung zugeführt. Das Stellungsverfahren, bei welchem durch den Einsatz mandos KÄRNTEN freiwillig zur vorzeitigen Stellung melden. Sofern militärische Interessen nicht entgegenstehen, moderner medizinischer Geräte und durch psychologische Tests die körperliche und geistige Eignung zum Wehr- wird solchen Anträgen entsprochen. dienst genau festgestellt wird, nimmt in der Regel 1 1/2 Tage in Anspruch. -
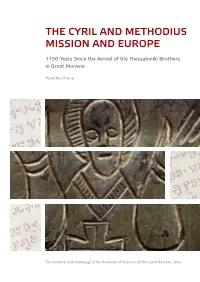
The Cyril and Methodius Mission and Europe
THE CYRIL AND METHODIUS MISSION AND EUROPE 1150 Years Since the Arrival of the Thessaloniki Brothers in Great Moravia Pavel Kouřil et al. The Institute of Archaeology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Brno THE CYRIL AND METHODIUS MISSION AND EUROPE – 1150 Years Since the Arrival of the Thessaloniki Brothers in Great Moravia Pavel Kouřil et al. The Institute of Archaeology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Brno Brno 2014 THE CYRIL AND METHODIUS MISSION AND EUROPE – 1150 Years Since the Arrival of the Thessaloniki Brothers in Great Moravia Pavel Kouřil et al. The publication is funded from the Ministry of Culture NAKI project „Great Moravia and 1150 years of Christianity in Central Europe“, for 2012–2015, ID Code DF12P01OVV010, sponsored as well by the Academy of Sciences of the Czech Republic. The Cyril and Methodius Mission and Europe – 1150 Years Since the Arrival of the Thessaloniki Brothers in Great Moravia Head of the team of authors: doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc. Authors: Maddalena Betti, Ph.D., prof. Ivan Biliarsky, DrSc., PhDr. Ivana Boháčová, Ph.D., PhDr. František Čajka, Ph.D., Mgr. Václav Čermák, Ph.D., PhDr. Eva Doležalová, Ph.D., doc. PhDr. Luděk Galuška, CSc., PhDr. Milan Hanuliak, DrSc., prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc., prof. PhDr. Martin Homza, Ph.D., prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc., prof. Sergej A. Ivanov, prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D., prof. Dr. hab. Krzysztof Jaworski, assoc. prof. Marija A. Jovčeva, Mgr. David Kalhous, Ph.D., doc. Mgr. Antonín Kalous, M.A., Ph.D., PhDr. Blanka Kavánová, CSc., prom. -

Mitteilungsblatt Dezember 2020
Amtliche Mitteilung · Zugestellt durch Post.at Mitteilungsblatt der Gemeinde Himmelberg Nummer 115 Dezember 2020 Jahrgang 36 Die Mitarbeiter*innen der Gemeinde Himmelberg wünschen ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2021! Mitteilungsblatt der Gemeinde 2 Bürgermeisterbrief Himmelberg n Aus dem Gemeinderat Dezember 2020 Zweckänderung bzw. Zweckbindung BZ-Mittel Die Zweckänderungen bzw. Bindungen von Rest-BZ-Mittel Festlegung der Höhe von Kassenkrediten und Abschluss 2019 und Rest BZ-Mittel 2020 wurden beschlossen. Kreditvertrag Übernahme einer Teilfläche in das öffentliche Gut Der Abschluss des Kreditvertrages soll aufgrund der besseren Ein Trennstück im Ausmaß von 16 m2 wird in das öffentliche Konditionen bei der Sparkasse Feldkirchen erfolgen. Gut, Grundstück Nr. 787, KG Dragelsberg, übernommen. Festlegung des Stundensatzes 2021 für Wirtschaftshof- Tarifordnung für die ganztägige Schulform an der VS personal und Stunden-bzw. Kilometersätze für Gerätelei- Himmelberg stungen Eine soziale Staffelung für die Elternbeiträge der ganztägig ge- Die Sätze wurden anhand der im Jahr 2021 veranschlagten führten VS Himmelberg ab dem Schuljahr 2020/2021 wurde Beträge im Haushalt Wirtschaftshof und der zu erwartenden beschlossen und wird verordnet. Jahresleistung ermittelt. Neuverordnung Flächenwidmungsplan Stellenplan 2021 Die als Beilagen „A“, „B“ und „C“ bezeichneten Beschlusslis- In der Hoheitsverwaltung sind für Gemeinden von 2.001 bis ten mit den Widmungen zum Differenzplan, den Widmungsän- 2.500 Einwohner fünf Planstellen vorgesehen. Im Stellenplan derungen zum Revisionsplan sowie den Widmungsänderungen sind auch fünf ausgewiesen. zur Ergänzenden Kundmachung wurden einstimmig beschlossen. Voranschlag 2021 Die vorgesehenen Aufschließungsgebiete wurden einstimmig be- Gemäß dem Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz hat der Ge- schlossen und werden verordnet. Der neue Flächenwidmungsplan meinderat für jedes Kalenderjahr als Finanzjahr durch Verord- wurde letztendlich einstimmig beschlossen und wird verordnet. -

Michael Rauter, Albert Karpf, Johann Baptist Türk, Johann Zopoth
Michael Rauter, Albert Karpf, Johann Baptist Türk, Johann Zopoth 1784 war Josef Rauter Besitzer und Betreiber eines Pulverwerkes in Eisentratten. Schießpulver ist eine Mischung aus Salpeter, Schwefel und Holzkohle. Es war im 7. Jh. n. Chr. den Byzantinern bekannt. Sein Name „Schwarzpulver“ geht auf den Freiburger Franziskanermönch Berthold Schwarz zurück. Schon 1734 wird in Himmelberg ein Jakob Moser als Pulvermacher genannt. Josef Rauters Sohn Michael verkaufte 1784 das Eisentrattener Werk und errichtete in Unterboden bei Himmelberg neue Pulvermühlen. Die Stämpfe befanden sich in Holzhütten über dem Tiebelbach. Die Stützpfeiler des alten Pulvermagazins und einige Mauerreste der an der Tiebel gelegenen Stämpfe sind noch erhalten. Das Himmelberger Arbeiter-Wohnhaus wurde von Dr. Daria Zeilinger als Privathaus umgebaut. Pulverstämpfe sind hölzerne, mit Metall beschlagene und mit einander verbundene Stößel. Sie werden durch Wasserräder in Bewegung gesetzt. Die holzreichen, von den Bächen der Lieser und Tiebel durchflossenen Täler waren daher im 17. und 18. Jahrhundert zur Anlage von Pulvermühlen besonders geeignet. Nachdem die napoleonischen Truppen am 11. bzw. 17. Mai 1809 die Forts Malborget und Predil eingenommen hatten, wurde Sachsenburg in Oberkärnten das Zentrum des österreichischen Widerstands. Dieser Festungsriegel stand unter dem Kommando des Ingenieurs Albert Karpf. Er befehligte den dortigen Landsturm, dem auch Tiroler Landwehrmänner angehörten. Auf Munitionsnachschub war er dringend angewiesen. Im Juli 1809 schrieb Karpf „An den Kaiserlichen Königlichen Pulvermacher Michael Rauter zu Himmelberg“, er möge so viel und so schnell wie möglich „eine beträchtliche Quantität Mousquetten- und Stuck-Pulvers“ liefern. Sollte Salpeter gebraucht werden, möge ein Bote geschickt werden. Diese Lieferung kam allerdings nicht mehr zustande, denn Sachsenburg musste schon wenige Tage nach diesem Auftrag an den französischen General Rusca übergeben werden. -

ANLAGE Zu § 1 Der Politische Bezirk Feldkirchen Umfasst Folgende Gemeinden: Albeck, Feldkirchen in Kärnten, Glanegg, Gnesau, Himmelberg, Ossiach, Reichenau, St
ANLAGE zu § 1 Der politische Bezirk Feldkirchen umfasst folgende Gemeinden: Albeck, Feldkirchen in Kärnten, Glanegg, Gnesau, Himmelberg, Ossiach, Reichenau, St. Urban, Steindorf am Ossiacher See, Steuerberg. Der politische Bezirk Hermagor umfasst folgende Gemeinden: Dellach, Gitschtal, Hermagor-Pressegger See, Kirchbach, Kötschach-Mauthen, Lesachtal, St. Stefan im Gailtal. Der politische Bezirk Klagenfurt-Land umfasst folgende Gemeinden: Ebenthal in Kärnten, Feistritz im Rosental, Ferlach, Grafenstein, Keutschach am See, Köttmannsdorf, Krumpendorf am Wörthersee, Ludmannsdorf, Magdalensberg, Maria Rain, Maria Saal, Maria Wörth, Moosburg, Pörtschach am Wörther See, Poggersdorf, St. Margareten im Rosental, Schiefling am Wörthersee, Techelsberg am Wörther See, Zell. Der politische Bezirk St. Veit an der Glan umfasst folgende Gemeinden: Althofen, Brückl, Deutsch-Griffen, Eberstein, Frauenstein, Friesach, Glödnitz, Gurk, Guttaring, Hüttenberg, Kappel am Krappfeld, Klein St. Paul, Liebenfels, Metnitz, Micheldorf, Mölbling, St. Georgen am Längsee, St. Veit an der Glan, Straßburg, Weitensfeld im Gurktal. Der politische Bezirk Spittal an der Drau umfasst folgende Gemeinden: Bad Kleinkirchheim, Baldramsdorf, Berg im Drautal, Dellach im Drautal, Flattach, Gmünd in Kärnten, Greifenburg, Großkirchheim, Heiligenblut am Großglockner, Irschen, Kleblach-Lind, Krems in Kärnten, Lendorf, Lurnfeld, Mallnitz, Malta, Millstatt am See, Mörtschach, Mühldorf, Oberdrauburg, Obervellach, Radenthein, Rangersdorf, Reißeck, Rennweg am Katschberg, Sachsenburg, Seeboden -

„Bisweilen Nicht Einfach, Sondern Etwas ,Kompliziert'“
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Mitt(h)eilungen der Gesellschaft für Salzburger Landeskunde Jahr/Year: 2011 Band/Volume: 151 Autor(en)/Author(s): Drobesch Werner Artikel/Article: "Bisweilen nicht einfach, sondern etwas ,kompliziert". Salzburg und Kärnten vom "finsteren" Mittelalter bis in das "lange" 19. Jahrhundert. 57-70 57 © Gesellschaft für Salzburger Landeskunde, Salzburg, Austria; download unter www.zobodat.at „Bisweilen nicht einfach, sondern etwas ,kompliziert’“. Salzburg und Kärnten vom „finsteren“ Mittelalter bis in das „lange“ 19. Jahrhundert. Von Werner Drobesch Die Beziehung zwischen Salzburg, vor allem solange dieses ein eigenständiges Territorium innerhalb des Heiligen Römischen Reiches war, und Kärnten bzw. - als dessen oberste Repräsentanten - den Kärntner Herzogen, war bis ins in die frühe Neuzeit intensiver Natur und insgesamt nicht einfach. Auch wenn der Alpenhauptkamm eine topographische Grenze bildete, war die Geschichte der beiden Länder eng miteinander verflochten, vom Mittelalter bis ins 16. Jahrhun dert mehr, nach der Zugehörigkeit Salzburgs zum Habsburgerreich — welch ein Paradoxon — ab 1816 eingeschränkter. Die nicht immer konfliktfreien Wechselbeziehungen fanden in der historiogra- phischen Literatur, und zwar nicht nur in jener der beiden Bundesländer1, sondern allgemein in den Darstellungen zur österreichischen Geschichte älteren wie jünge ren Datums2, wie auch in Spezialstudien einen entsprechenden Niederschlag. Die Zahl der einschlägigen Publikationen ist nicht gering. Quantifiziert ergibt das zu den Schlagwörtern bzw. Titelwörtern „Kärnten“, „Salzburg“, „Geschichte“ - die jüngere Literatur betreffend - im „Österreichischen Verbundkatalog“ 52 Titel, in der Online-Version der „Österreichischen Historischen Bibliographie“ für die Jahre nach 1945 12 Titel, im Online-Katalog der Universität Klagenfurt 39 und im Online-Katalog der Universität Salzburg 88 Titel3. -

Regional Intermediate Report Carinthia / Austria Test Areas Feldkirchen and Wolfsberg
Work package 5 « Regional studies » : Regional intermediate report Carinthia / Austria Test areas Feldkirchen and Wolfsberg Eva Favry Birgit Janach Eva Karpf-Fortin 30 November 2005 Klagenfurt, Vienna WP5 REGIONAL INTERMEDIATE REPORT CARINTHIA 051130 1 Regional intermediate report Carinthia / Austria Table of content 1. Introduction ...................................................................................................4 1.1 PUSEMOR: A general overview ............................................................4 1.2 Workpackage 5 Regional Studies: Goals, objectives and activities ......5 2. Country profile...............................................................................................9 2.1 Territorial organisation ...........................................................................9 2.2 Spatial policies in Carinthia....................................................................9 2.3 Roles and responsibilities in public services........................................10 Transport..............................................................................................10 Public administration............................................................................10 Health care and care for elderly...........................................................11 Child care, education and culture ........................................................11 Telecommunication..............................................................................12 Every day needs ..................................................................................13