Werra-Meißner-Kreis
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Werra-Meißner Kreis
Bund der Steuerzahler Hessen e.V. Oktober 2018 Kommunale Steuern im Werra-Meißner-Kreis im Jahr 2018 Hebesatz in Prozent Hebesatz in Prozent (Veränderung zu 2017) [Steuersatz]; (Veränderung zu 2017) Gewerbe- Grundsteuer Betten- Hundesteuer in Euro Zweitwoh- Straßenbeiträge Defizitärer Haushalt wiederkeh- Verabschie- einamlig Stadt/Gemeinde steuer A B steuer 1. Hund gefährlicher Hund nungsteuer rend 2017 2018 dung Bad Sooden- 400 620 700(+50) nein 81,00 nein nein ja nein ja ja ja Allendorf Berkatal 400 400 400 nein 72,00 600,00 nein ja nein nein nein ja Eschwege 410 420 390(-30) nein 64,80 600,00 nein nein1 nein nein nein ja Großalmerode 410 460 460 nein 63,00 516,00 nein ja2 ja3 ja nein ja Herleshausen 380 600 600 nein 85,00 1000,00 nein ja nein nein nein ja Hessisch 390 590 590 nein 96,00 nein nein ja nein nein nein ja Lichtenau Meinhard 450 650 650 nein 54,00 nein nein nein nein nein nein ja Meißner 380 400 400 nein 60,00 400,00 nein ja nein nein nein ja Neu-Eichenberg 380 380 480 nein 48,00 nein nein ja nein nein nein ja Ringgau 480 560 560 nein 100,00 800,00 nein ja nein nein nein ja Sontra 380 420 420 nein 60,00 500,00 nein ja nein nein nein ja Waldkappel 450 650 650 nein 74,00 460,00 nein ja nein ja nein ja Wanfried 440(-10) 730(-40) 730(-40) nein 96,00 800,00 nein nein4 nein nein nein ja Wehretal 380 400 400 nein 78,00 480,00 nein nein ja nein nein ja Weißenborn 380 500 500 nein 60,00 610,00 nein nein ja nein nein ja Witzenhausen 420 490 490 nein 72,00 500,00 nein ja nein nein nein ja Ø Werra- Meißner-Kreis 408 (-1) 517 (-2) 526 (-2) 0 von 16 73 606 0 von 16 11 von 16 3 von 16 3 von 16 1 von 16 16 von 16 1Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 23.08.2018 wurde die Straßenbeitragssatzung aufgehoben. -

Bad Sooden-Allendorf Großalmerode Eschwege Herleshausen Sontra Waldkappel Hessisch Lichtenau Wanfried Witzenhausen
Wandern Fahrradverleih Ausfl ugsbus Schwimmbad A38 Marzhausen A7 Hermannrode Kanufahren Kino Berlepsch-Ellerode Hebenshausen M Neuenrode Hübenthal Berge Reiten Jugendherberge Blickershausen Gertenbach Albshausen Neu-Eichenberg Eichenberg/Bahnhof Eichenberg/Dorf M Badestrand Bowling Erlebnispark Ziegenhagen B80 B27 Ziegenhagen Ermschwerd Gute Angelmöglichkeit Minigolf Gewächshaus tropischer Nutzpfl anzen M Neuseesen Hubenrode Witzenhausen Stadtführung Bücherei Kirschwanderweg Unterrieden Werleshausen Premium-Wanderweg Kleinalmerode Ellingerode 9 Wendershausen 9 Roßbach Burg Ludwigstein M Museum Dohrenbach Oberrieden M Spiel- und Ellershausen Sportplätze fi nden sich Hundelshausen Ahrenberg in jedem Ort im Werra- Meißner-Kreis Bilsteinturm Gradierwerk mit Werrataltherme Hilgershausen Großalmerode Trubenhausen BadSooden-Allendorf M Kammerbach Salzmuseum B 451 Weißenbach Weiden Dudenrode Orferode 4 8 7 Kleinvach Uengsterode Hitzerode Epterode M Kripp- und Hielöcher B27 Hitzelrode Frankenhain Frankershausen Motzenrode Rommerode Berkatal Albungen Meinhard Laudenbach Wolfterode 2 Grube Gustav Neuerode Friedrichsbrück Frau Holle Teich Wellingerode Ve lmeden Meißner Jestädt Frau Holle Park Abteröder Bär M Fürstenhagen M Grebendorf Hausen Barfußpfad Vockerode Abterode Hessisch 1 Weidenhausen Schloss Wolfsbrunnen 5 Schwebda Germerode Niederhone M Frieda Quentel Lichtenau Walburg Nikolaiturm Plesseturm M B 249 EltmannshausenEschwege Bergwildpark Wanfrieder Hafen Alberode Oberhone Wanfried Hollstein Küchen Aue Elfengrund B 452M Kletterpark Rodebach Niddawitzhausen -

Werra-Meißner-Kreis
Werra-Meißner-Kreis Satzung über die Bildung von Schulbezirken für die Grundschulen im Werra-Meißner-Kreis Aufgrund der §§ 5 und 30 Nr. 5 der Hessischen Landkreisordnung (HKO) i. d. F. vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 183), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.12.2011 (GVBl. I S. 786, 794) i. V. m. § 143 des Hessischen Schulgesetzes vom 14.06.2005 (GVBl. I S. 441), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.05.2014 (GVBl. I S. 134), hat der Kreistag des Werra-Meißner-Kreises in seiner Sitzung am 12.06.2015 folgende Satzung über die Bildung von Schulbezirken für Grundschulen beschlossen: Artikel I § 1 Für die Grundschulen werden nachstehende Schulbezirke gebildet: 1. Geschwister-Scholl-Schule – Grundschule – in Eschwege Einzugsbereich: Wohnbereich der Stadt Eschwege mit folgenden Straßen: Ahornweg Akazienweg Am Diebach Am Dornbusch Am Fuchsberg Am Steingraben Am Weißenstein Bebraer Straße Buchenweg Danziger Weg Eichenweg Eisenacher Straße Eisenbahnstraße Fliederweg Fuldaer Straße Ginsterweg Heckenrosenweg Hessenring Heubergstraße Himmelreichsgraben Satzung über die Bildung von Schulbezirken – Seite 2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Holunderweg Im Löfflersgrund Jasminweg Kasseler Straße Kastanienweg Kurt-Holzapfel-Straße Lindenweg Magnolienweg Masurenweg Meißnerring Platanenweg Platz der Deutschen Einheit Pommernweg Rotdornweg Rotenburger Straße Saazer Weg Schlehenweg Sonnenscheinweg Sontraer Straße Südring Ulmenweg Wacholderweg Westring 2. Meinhardschule – -

Werra-Meißner-Stracke Fleischerei Dreßler KG Berliner Str
Urkunde Produktname Betrieb Straße Ort GOLD Stracke geräuchert Fleischerei Peter Fey Holzhäuser Str. 17 a 37293 Herleshausen GOLD Runde geräuchert Fleischerei Peter Fey Holzhäuser Str. 17 a 37293 Herleshausen SILBER Dicke Bauern Stracke Landmetzgerei Henning Lindenweg 1 37290 Meißner-Germerode GOLD geräucherte Bauern Stracke Landmetzgerei Henning Lindenweg 1 37290 Meißner-Germerode GOLD Bauern Runde geräuchert Landmetzgerei Henning Lindenweg 1 37290 Meißner-Germerode GOLD Fenchelsäckchen Landmetzgerei Henning Lindenweg 1 37290 Meißner-Germerode GOLD Stracke geräuchert Original Hausmacher Wurst Manfred Wagner Gartenstr. 21 37293 Herleshausen GOLD Runde geräuchert Original Hausmacher Wurst Manfred Wagner Gartenstr. 21 37293 Herleshausen GOLD Stracke geräuchert Hausschlachtung Lars Heckmann Lilienstr. 2 37284 Waldkappel - Friemen GOLD Stracke luftgetrocknet Hausschlachtung Lars Heckmann Lilienstr. 2 37284 Waldkappel - Friemen SILBER Runde luftgetrocknet Hausschlachtung Lars Heckmann Lilienstr. 2 37284 Waldkappel - Friemen GOLD Runde geräuchert Hausschlachtung Lars Heckmann Lilienstr. 2 37284 Waldkappel - Friemen GOLD Werra-Meißner-Stracke Fleischerei Dreßler KG Berliner Str. 4 37247 Großalmerode GOLD Dürre Stracke Fleischerei Dreßler KG Berliner Str. 4 37247 Großalmerode SILBER Stracke geräuchert Fleischerei Dreßler KG Berliner Str. 4 37247 Großalmerode SILBER Runde luftgetrocknet Fleischerei Dreßler KG Berliner Str. 4 37247 Großalmerode GOLD Runde geräuchert Fleischerei Dreßler KG Berliner Str. 4 37247 Großalmerode GOLD Stracke luftgetrocknet -

Liste Der Stifterinnen Und Stifter (Stand April 2018), Die Einer Veröffentlichung Zugestimmt Haben
Aktuelle Liste der Stifterinnen und Stifter (Stand April 2018), die einer Veröffentlichung zugestimmt haben Privatpersonen Adam, Hartmut, Eschwege Amon, Dr., Klaus und Beatrix, Meinhard Apel, Hilmar und Linke-Apel, Beate, Witzenhausen Arnoldt, Lena, Meißner Bartholomäus, Corinna, Witzenhausen Baumgärtel-Blaschke, Ursula, Wehretal Bertram, Hans-Joachim, Eschwege Böhmert, Dr., Roswitha, Bad Sooden-Allendorf Brückmann, Uwe, Hessisch Lichtenau Bültzingslöwen, von, Helga und Wolf, Hessisch Lichtenau Eisenhuth, Heinz-Walter, Eschwege Erfurth, Sigrid, Neu-Eichenberg Falk, Matthias, Bad Sooden-Allendorf Feiertag, Alexander und Sabine Wilke, Eschwege Fischer, Wolfgang, Neu-Eichenberg Forthmann-Valtink, Werner, Witzenhausen Frank, Otto, Wanfried Franke, Holger, Meinhard Franz, Elisabeth und Jürgen, Witzenhausen Frick, Frauke, Witzenhausen Fricke, Regina (), Hann. Münden Friedrich, Ilona, Kassel Geisler, Christiane, Hessisch Lichtenau Giesübel, Dr., Werner, Eschwege Giller, Hans, Meinhard Glauner, Dr., Hans Joachim und Amei, Witzenhausen Groß, Sabine, Meinhard Hahne, Prof. Dr., Ulf, Flensburg Herwig, Claudia, Meißner Heun, Dr., Dieter, Kassel Hochschild, Bärbel, Meißner Höbbel, Peter, Eschwege Hörhammer, Claudia, Wanfried Horn, Steffen-Peter und Gabriele, Witzenhausen Hose, Peter, Großalmerode Hupfeld, Magdalene, Meißner Ingrisch, Edgar, Sontra Kaufmann, Fritz, Hessisch Lichtenau Keller, Heinrich, Meinhard Keller, Werner, Witzenhausen Kessler, Gabriele, Wehretal Kiese, Brigitte, Eschwege Kinast, Hermann (), Herleshausen Klebing, Elme und Josef, -
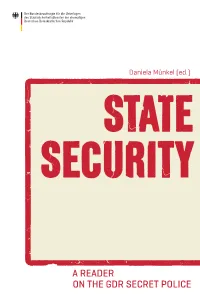
Bstu / State Security. a Reader on the GDR
Daniela Münkel (ed.) STATE SECURITY A READER ON THE GDR SECRET POLICE Daniela Münkel (ed.) STATE SECURITY A READER ON THE GDR SECRET POLICE Imprint Federal Commissioner for the Records of the State Security Service of the former German Democratic Republic Department of Education and Research 10106 Berlin [email protected] Photo editing: Heike Brusendorf, Roger Engelmann, Bernd Florath, Daniela Münkel, Christin Schwarz Layout: Pralle Sonne Originally published under title: Daniela Münkel (Hg.): Staatssicherheit. Ein Lesebuch zur DDR-Geheimpolizei. Berlin 2015 Translation: Miriamne Fields, Berlin A READER The opinions expressed in this publication reflect solely the views of the authors. Print and media use are permitted ON THE GDR SECRET POLICE only when the author and source are named and copyright law is respected. token fee: 5 euro 2nd edition, Berlin 2018 ISBN 978-3-946572-43-5 6 STATE SECURITY. A READER ON THE GDR SECRET POLICE CONTENTS 7 Contents 8 Roland Jahn 104 Arno Polzin Preface Postal Inspection, Telephone Surveillance and Signal Intelligence 10 Helge Heidemeyer The Ministry for State Security and its Relationship 113 Roger Engelmann to the SED The State Security and Criminal Justice 20 Daniela Münkel 122 Tobias Wunschik The Ministers for State Security Prisons in the GDR 29 Jens Gieseke 130 Daniela Münkel What did it Mean to be a Chekist? The State Security and the Border 40 Bernd Florath 139 Georg Herbstritt, Elke Stadelmann-Wenz The Unofficial Collaborators Work in the West 52 Christian Halbrock 152 Roger Engelmann -
20200910Schadstoffsammlung WMK 2021
Tourenplan Schadstoffsammlung Werra‐Meissner 2021 Frühjahr Herbst Kreisteil Witzenhausen 19.04.2021 25.10.2021 10.00 ‐ 11.00 Uhr Neu‐Eichenberg Hebenshausen Bauhof/Am Sportplatz 11.15 ‐ 11.35 Uhr Witzenhausen Unterrieden An der Sporthalle 11.45 ‐ 12.00 Uhr Witzenhausen Werleshausen Feuerwehrgerätehaus/Am Rasen 12.55 ‐ 13.15 Uhr Witzenhausen Wendershausen An der Werra 13.25 ‐ 15.00 Uhr Witzenhausen Festplatz/Laubenweg 20.04.2021 26.10.2021 10.00 ‐ 10.15 Uhr Hess.Lichtenau Küchen Leipziger Str. / Vor der Kirche 10.30 ‐ 10.45 Uhr Hess.Lichtenau Reichenbach Schlossstr. / Hauptstr. 11.00 ‐ 11.15 Uhr Hess.Lichtenau Hopfelde Mehrzweckhalle/Blaues Wunder 11.25 ‐ 11.40 Uhr Hess.Lichtenau Velmeden DGH/Karl‐Peter‐Str. 11.50 ‐ 12.10 Uhr Hess.Lichtenau Walburg DGH/Richtung Hopfelde 13.10 ‐ 14.10 Uhr Hess.Lichtenau Bürgerhaus/Sälzer Str./großer Parkplatz 14.25 ‐ 14.40 Uhr Hess.Lichtenau Friedrichsbrück Feuerwehr/Hirschbergstr. 14.55 ‐ 15.25 Uhr Hess.Lichtenau Fürstenhagen Mehrzweckhalle/Schulstr./Bus/Parkplatz 21.04.2021 27.10.2021 10.00 ‐ 10.20 Uhr Witzenhausen Roßbach Obere Bachstr. / Glascontainer 10.30 ‐ 10.50 Uhr Witzenhausen Dohrenbach Haus des Gastes/Ringkopfstr. 11.00 ‐ 11.30 Uhr Witzenhausen Hundelshausen Festplatz/Raiffeisenstr. 11.40 ‐ 12.00 Uhr Großalmerode Trubenhausen In der Welsebach rechts 12.50 ‐ 13.10 Uhr Großalmerode Uengsterode DGH / Am Bruch 13.20 ‐ 13.50 Uhr Großalmerode Laudenbach Feuerwehr/Weiße Gelster 14.00 ‐ 14.45 Uhr Großalmerode Rommerode Parkplatz Sportplatz/Schulstr. 14.55 ‐ 15.55 Uhr Großalmerode PP Berliner Str.38‐40/Glascontainer 22.04.2021 28.10.2021 10.00 ‐ 10.15 Uhr Bad Sooden‐Allendorf Ellershausen Landstraße 25 / Gutshofgelände 10.25 ‐ 10.45 Uhr Bad Sooden‐Allendorf Oberrieden Witzenhäuser Str./Ecke Lindenstr. -

RP325 Cohn Marion R.Pdf
The Central Archives for the History of the Jewish People Jerusalem (CAHJP) PRIVATE COLLECTION MARION R. COHN – P 325 Xeroxed registers of birth, marriage and death Marion Rene Cohn was born in 1925 in Frankfurt am Main, Germany and raised in Germany and Romania until she immigrated to Israel (then Palestine) in 1940 and since then resided in Tel Aviv. She was among the very few women who have served with Royal British Air Forces and then the Israeli newly established Air Forces. For many years she was the editor of the Hasade magazine until she retired at the age of 60. Since then and for more than 30 years she has dedicated her life to the research of German Jews covering a period of three centuries, hundreds of locations, thousands of family trees and tens of thousands of individuals. Such endeavor wouldn’t have been able without the generous assistance of the many Registors (Standesbeamte), Mayors (Bürgermeister) and various kind people from throughout Germany. Per her request the entire collection and research was donated to the Central Archives for the History of the Jewish People in Jerusalem and the Jewish Museum in Frankfurt am Main. She passed away in 2015 and has left behind her one daughter, Maya, 4 grandchildren and a growing number of great grandchildren. 1 P 325 – Cohn This life-time collection is in memory of Marion Cohn's parents Consul Erich Mokrauer and Hetty nee Rosenblatt from Frankfurt am Main and dedicated to her daughter Maya Dick. Cohn's meticulously arranged collection is a valuable addition to our existing collections of genealogical material from Germany and will be much appreciated by genealogical researchers. -
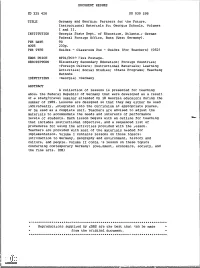
PUB DATE 90 NOTE 233P. PUB TYPE Guides-Classroom Use-Guides
DOCUMENT RESUME ED 325 426 SO 030 186 TITLE Germany and Georgia: Partners for the Future. Instructional Materials foL Georgia Schools, Volumes I and II. INSTITUTION Georgia State Dept. of Education, Atlanta.; German Federal Foreign Office, Bonn (West Germany). PUB DATE 90 NOTE 233p. PUB TYPE Guides - Classroom Use - Guides (For Teachers) (052) EDRS PRICE MF01/PC30 rlus Postage. DESCRIPTORS Ele.lentary Secondary Education; Foreign Countries; *Foreign Culture; Instructional Materials; Learning Activities; Social Studies; *State Programs; Teaching Methods IDENTIFIERS *Georgia; *Germany ABSTRACT A collection of lessons is presented for teaching abouL the Federal Republic of Germany that were developed as a result of a study/travel seminar attended by 18 Georgia educators during the summer of 1989. Lessons are designed so that they may either be used individually, J.ntegrated into the curriculum at appropriate places, or be used as a complete unit. Teachers are advised to adjust the materials to accommodate the needs and interests of performance levels of students. Each lesson begins with an outline for teaching that includes instructional objective, and a sequenced list of procedures for using the activities provided with the lesson. Teachers are provided with most of the materials ne.eded for implementation. Volume 1 contains lessons on these topics: introduction to Germany, geography and environment, history and culture, and people. Volume II conta. Ns lesson on these topics concerning contemporary Germany: goveLnment, economics, society, -

Notfall- Versorgung
Copyright-Hinweis: Basisdaten © OpenStreetMap-Mitwirkende | Kartografie © grebemaps | Grafik © IHR VERMERK NIEDERSACHSEN Friedland Marz- Klinikum Plus hausen Ihr GesundheitsmagazinHESSEN für die Werra-Meißner Region Berge Blickershausen Neu-Eichenberg Albshausen THEMENSPECIAL Eichenberg- LEGENDE Dorf Ziegenhagen Witzenhausen: Ermschwerd Krankenhaus Ärztl. Bereit- Notaufnahme NOTFALL- Hubenrode Witzenhausen schaftsdienst Kleinalmerode (Hubschrauberlandestelle VERSORGUNG Werleshausen in Krankenhausnähe) Rettungs- Notarzt- Hubschrauber- Roßbach wache standort landestelle Ober- im Werra-Meißner-Kreis rieden Ellers- hausen Hundelshausen Wenn die Gesundheit oder gar das Leben bedroht ist, muss Wohin soll ich mich im Ernstfall wenden? Kaufunger Wald Ahrenberg Werra-Meißner-Kreis schnell und kompetent geholfen werden. Wir zeigen Ihnen, wie Patienten können selbst dazu beitragen, dass Notfall- Hilgershausen Bad Sooden- teams zuerst den Menschen helfen können, die dies am das im Werra-Meißner-Kreis funktioniert. Trubenhausen Allendorf dringendsten benötigen. Großalmerode Orferode Dudenrode Uengsterode Faulbach Kleinvach Ärztlicher BEREITSCHAFTSDIENST: Frankenhain Hitzerode Sie sind krank und die Arztpraxis ist geschlossen? Wenn Sie Berkatal Motzenrode Eschwege: Rommerode Laudenbach Albungen sich sicher sind, dass es nicht lebensbedrohlich ist und Sie Wolfterode THÜRINGEN Friedrichsbrück Neuerode nicht auf die nächste Öffnungszeit Ihrer Arztpraxis warten Velmeden Wellingerode Föhren Jestädt Meinhard können, wenden Sie sich an den Ärztlichen Bereitschafts- -

Informationsbroschüre Politik Im Werra
Inhalt 1. Demokratischer Aufbau der Kreisorgane .......................................................................................................................................................... 2 2. Kreistag .............................................................................................................................................................................................................. 3 2.1. Kreistagsvorsitz ............................................................................................................................................................................................... 3 2.2. Kreistagsfraktionen ......................................................................................................................................................................................... 3 2.2.1. Sozialdemokratische Partei Deutschlands – SPD ....................................................................................................................................... 3 2.2.2. Christlich Demokratische Union – CDU ...................................................................................................................................................... 4 2.2.3. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – GRÜNE ....................................................................................................................................................... 4 2.2.4. FREIE WÄHLER Werra-Meißner – FREIE WÄHLER ................................................................................................................................ -

Hauptamtliche Koordinator*Innen Der Kommunen Und Ergänzende Lokale
Hauptamtliche Koordinator*innen der Kommunen und ergänzende lokale Ansprechpartner*innen Integration im Werra- Meißner-Kreis _Stand 01.03.2020 Stadt/Gemeinde Ansprechpartner/in eMail Telefonnummer Bürozeit 37242 Bad Sooden-Allendorf www.bad-sooden- allendorf.de/fluechtlingshilfe.html Marktplatz Frau Annette Ruske-Wolf [email protected] 05652/9585325 Hochzeitshaus, Aristan Atalan [email protected] 0178/8089685 Freitag 13:00 – 14:00 Uhr Marktplatz 9 [email protected] (Hochzeitshaus) Kleiderkammer Mittwoch, 16:30-17:30 Uhr (Rhenanusschule) (Rhenanusschule) 37297 Berkatal Berkastraße 54 Herr Friedel Lenze [email protected] 05657/ 989112 37269 Eschwege www.eschwege.de Obermarkt 22 NN Unterstützungslotsen Frau Aylin Abhau [email protected] 05651/7410844 Die, 10:00 – 12:00 Uhr und Begegnungsstätte Herr Karl Montag 15:00 – 16:00 Uhr Hospitalplatz 1-3 37247 Großalmerode www.grossalmerode.de/cms/Leben%20und% 20Freizeit/Fluechtlingshilfe/Fluechtlingshilfe Marktplatz Herr Matthias Gude [email protected] 05604/933517 Mo, Die, Mi, Fr, 9:00 – 12:00 Uhr und Do, 15:00 – 17:00 Uhr 37293 Herleshausen Bahnhofstraße 15 Frau Alexandra Lehmann [email protected] 05654/989514 Nordstraß2 27 Herr Thomas Lehmann [email protected] 05654/6592 37235 Hessisch-Lichtenau 1 Hauptamtliche Koordinator*innen der Kommunen und ergänzende lokale Ansprechpartner*innen Integration im Werra- Meißner-Kreis _Stand 01.03.2020 Landgrafenstraße 52 Frau Bettina Ludwig [email protected] 05602/807120