Betriebliche Weiterbildung
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
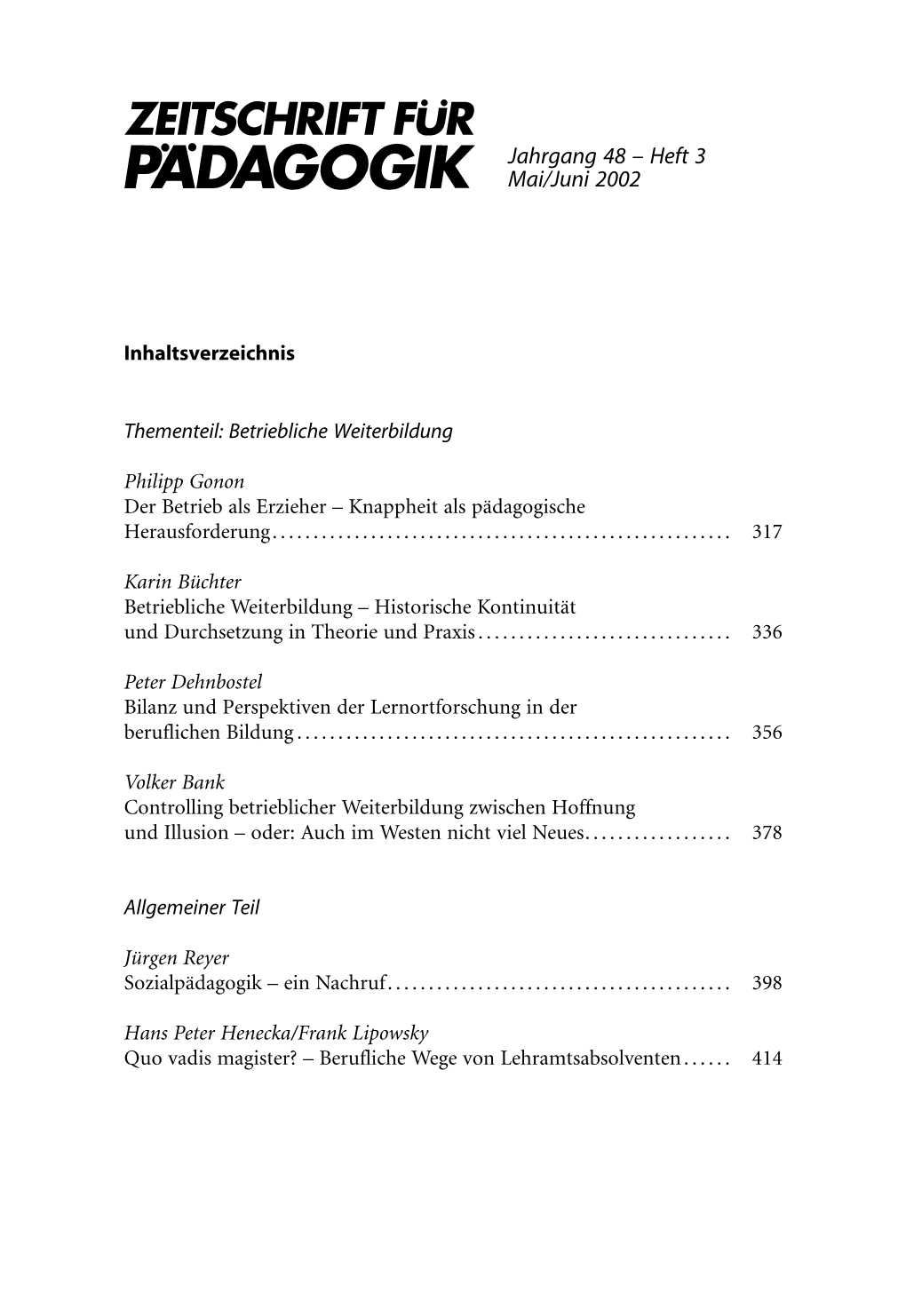
Load more
Recommended publications
-

AIVAR PÕLDVEE Bengt Gottfried Forselius Ja Rahvahariduse Lätted
DISSERTATIONES HISTORIAE UNIVERSITATIS TARTUENSIS 20 DISSERTATIONES HISTORIAE UNIVERSITATIS TARTUENSIS 20 AIVAR PÕLDVEE Bengt Gottfried Forselius ja rahvahariduse lätted Eesti- ja Liivimaal TARTU ÜLIKOOLI KIRJASTUS Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituut, Tartu, Eesti Kaitsmisele lubatud Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna ajaloo ja arheoloogia instituudi nõukogu otsusega 1. juulist 2010. a Juhendaja: prof dr Mati Laur Oponent: riigiarhivaar emeritus dr Kari Tarkiainen (Kansallisarkisto, Helsingi) Doktoritöö kaitsmine toimub 23. septembril 2010. a kell 16.15 Tartu Ülikooli nõukogu saalis Tartus, Ülikooli 18 ISSN 1406–443X ISBN 978–9949–19–447–6 (trükis) ISBN 978–9949–19–448–3 (PDF) Autoriõigus Aivar Põldvee, 2010 Tartu Ülikooli Kirjastus www.tyk.ee Tellimuse nr 403 EESSÕNA Festina lente! Need sõnad kirjutas Keila pastor Anton Heidrich 1688. aasta talvel Bengt Gottfried Forseliuse ortograafiatraktaati lugedes märkmelehele. Liiga kiiresti toimus kõik see kirja- ja õppeviisi muutmine tema jaoks. 1984. aasta paiku arhiivis Heidrichi kirju lugedes välgatas mu peas korraks mõte, et Forseliuse kohta on veel nii mõndagi öelda. Ja päris lahti see mõte mind enam ei lasknud... Tänan kõigepealt professor Sulev Vahtret, kes julgustas, et kodu- kihelkonna ajalugu XVII sajandil võiks olla hea teema diplomitöö kirjuta- miseks. Nii palju see asi ka õnnestus, et Arvo Tering oponendina nägi töös alget, mille võiks Keele ja Kirjanduse artikliks arendada. Audiatur et altera pars, kirjutas ta retsensioonis. Teadmine, et kihelkondlikud seigad, personaalia jm esmapilgul kõrvaline varia pole üksnes väärtuslik faktimaterjal, vaid ka lähtekoht meetodile, mis võimaldab leida varjatud varandusi ja esitada teist- moodi küsimusi, selgines hiljem. Kui see ei kõlaks vabandusena, võiks meetodiks pidada ka aeglast küpsemist ja pikki pause. Asudes väitekirja juurde – mis ei sündinud professor Mati Lauri tänuväärse taganttõukamiseta – oli silme ees koondav monograafia. -

CONSCIENCE & CONNECTIONS. Marcellus
CONSCIENCE & CONNECTIONS. Marcellus Franckheim (1587-1644) and his contacts in the Habsburg World at the eve of the Thirty Years War. ‘my soul is not for sale’ (Marcellus Franckheim to Franz Gansneb Tengnagel, 8 October 1620) Willemijn Tuinstra S1791923 08-08-2019 # Words: 22.917 (25.968 with Annexes) Thesis MA History Europe 1000-1800 Prof.dr. J.F.J. Duindam Abstract The Dutch glassmaker’s son and rector of the Latin school in Zutphen, Marcellus Franckheim (Zutphen 1587- Dunkirk 1644), converted from Calvinism to Catholicism in 1614 and became secretary to Cardinal Melchior Khlesl at the court of the Habsburg Emperor Matthias. He ended his life as councillor to the Spanish King Philip IV in the admiralty of the Flanders fleet. By analysing Franckheim’s surviving correspondence and publications, this thesis shows that while Franckheim’s life on first sight seems full of unexpected moves and change, there is a remarkable continuity in his faith, his contacts and his opinions. It also shows that the Dutch Gomarist-Arminian controversy during the Twelve Years Truce directly influenced his decision to convert and that a group of engaged Zutphen Catholic citizens connected him to the Counter-Reformation world of the Habsburg courts in Europe. Using Marcellus Franckheim as an exemplary case, this thesis addresses the broader question of how Dutch Catholics in the early seventeenth century, both in the Low Countries and in exile, participated in local and transnational networks to promote and consolidate their faith. It also provides insight in the interconnectedness of the political and religious conflicts in the Low Countries and the Holy Roman Empire, in particular with regard to the ways in which individuals felt involved and tried to influence these events. -

20604691 LPROB.Pdf
Archive for Reformation History An international AnJournal International concerned Journal with the history of the concerned withReformation the history and of itsthe significance Reformation in andworld its affairs, significance published in world affairs, published underunder the the auspices auspices of of the the Verein Verein für für Reformationsgeschichte Reformations- and geschichtethe andSociety the Societyfor Reformation for Reformation Research Research Supplement Literature Review Board of Editors Jodi Bilinkoff, Greensboro/North Carolina – Gérald Chaix, Nantes – David Cressy, Columbus/Ohio – Michael Driedger, St. Catharines/Ontario – Mark Grengrass, 6KHIÀHOG²%UDG6*UHJRU\1RWUH'DPH,QGLDQD²6FRWW+HQGUL[3ULQFHWRQ1HZ -HUVH\²0DFN3+ROW)DLUID[9LUJLQLD²6XVDQ&.DUDQW1XQQ7XFVRQ$UL]RQD² 7KRPDV.DXIPDQQ*|WWLQJHQ²(UQVW.RFK/HLS]LJ²8WH/RW]+HXPDQQ7XVFRQ $UL]RQD²-DQXV]0DââHN7RUXľ²6LOYDQD6HLGHO0HQFKL3LVD²%HUQG0RHOOHU *|WWLQJHQ²&DUOD5DKQ3KLOOLSV0LQQHDSROLV0LQQHVRWD²+HLQ]6FKHLEOH+HLGHO EHUJ²+HLQ]6FKLOOLQJ%HUOLQ²$QQH-DFREVRQ6FKXWWH&KDUORWWHVYLOOH9LUJLQLD² &KULVWRSK6WURKP+HLGHOEHUJ²-DPHV'7UDF\0LQQHDSROLV0LQQHVRWD²5DQGDOO &=DFKPDQ1RWUH'DPH,QGLDQD Managing Editor under the auspices of the Verein für Reformationsgeschichte and the Leibniz-Institute for European History, Mainz Markus Wriedt Vol. 42 · 2013 Gütersloher Verlagshaus Archiv für Reformationsgeschichte Internationale Zeitschrift,QWHUQDWLRQDOH=HLWVFKULIW zur Erforschung der Reforma- ]XU(UIRUVFKXQJGHU5HIRUPDWLRQXQGLKUHU:HOWZLUNXQJHQtion und ihrer Weltwirkungen, herausgegeben im Auftrag KHUDXVJHJHEHQLP$XIWUDJGHV9HUHLQVIU5HIRUPDWLRQVJHVFKLFKWHdes -

On Cultural Contacts and Their Impact on Literature in Tallinn in the Early 17Th Century
DOI: https://doi.org/10.22601/PET.2019.04.07 ON CULTURAL CONTACTS AND THEIR IMPACT ON LITERATURE IN TALLINN IN THE EARLY 17TH CENTURY Aigi Heero Tallinn University Abstract. The present paper describes the literary field in Tallinn in the early modern period, specifically the early 1630s.1 It was a time when sev- eral cultural innovations reached this region (via social carriers as well as via the book trade). Hereby, the professors of the newly founded gym- nasium (1631) played a crucial role. Thanks to these scholars completely new genres (such as the autobiography) are documented. Furthermore, new core texts were introduced, which had a huge impact on further cul- tural developments in Tallinn and in Northern Estonia: the formation of German-language (occasional) poetry and the emergence of Estonian- language literary culture. Keywords: early modern era, 17th century, Tallinn gymnasium, German- language casual poetry, early Estonian-language literature, autobiography, Timotheus Polus, Reiner Brockmann, David Gallus 1 The present article is based on the results of the project “Cultural Contacts and Their Reflection in the (Auto)Biographical Texts from the Early Modern Period” (2012−2016), funded by the Estonian Science Foundation (grant 9026). This was an original study that explored German-language literature and culture in Tallinn in the early 17th century and described the role of both literature and culture, and present lite- rary texts in a broader, cross-border context. The main sources included unpublished archival materials and printed texts from the 17th and 18th centuries. A more detailed overview of the main outcomes of this project (in German) can be found in Heero, Saagpakk, Tarvas (2016). -

Weymarische Bibel« Ein Riesiges Kommentarwerk Thüringer Theologen Aus Den Jahren 1636 Bis 1640
Herbert von Hintzenstern Die »Weymarische Bibel« Ein riesiges Kommentarwerk Thüringer Theologen aus den Jahren 1636 bis 1640 Erschienen in: »Laudate Dominum«: Achtzehn Beiträge zur thüringischen Kirchengeschichte. Festgabe zum 70. Geburtstag von Landesbischof D. Ingo Braecklein. Thüringer kirchliche Studien; Bd. 3, Berlin 1976, S. 151-159. Im Verlag von Wolfgang Endter zu Nürnberg erschien im Jahre 1641 ein Buch in Großfolioformat, das zu den umfangreichsten Bibelausgaben gehört, die jemals hergestellt wurden. Für 6 Taler wurde eine ganze Bibliothek der Bibelwissenschaft geboten. Auf den 1512 Seiten war nicht nur Luthers Übersetzung des Alten und Neuen Testaments in der Fassung von 1545 nachgedruckt, sondern auch eine Fülle von Beigaben wurde »auf gnädigste Verordnung des Durchleuchtigen/Hochgeborenen Fürsten und Herrn Ernsts/Herzog zu Sachsen, Jülich, Cleve und Berg etc.« hinzugefügt. Neben den üblichen biblischen Registern gab es z. B. einen »Bericht von der Vergleichung der jüdischen und biblischen Monden, Maßen, Gewichten und Münzen mit den unsrigen«, ferner eine »Beschreibung der Stadt Jerusalem samt verschiedenen Landkarten und anderen schönen Kupferstichen« und derselben Beschreibung: »Welches alles den Christlichen Leser nicht allein belustigen, sondern auch denselben zu mehrern Verstand der Schrift gute Anleitung geben kann«. Auf 13 Kupferstichen waren Luthers Grabmal in der Jenaer Stadtkirche sowie die Gestalten der Kurfürsten der Reformationszeit und ihrer Nachfahren zu sehen, zu denen der Protektor des riesigen Bibelwerkes, Herzog Ernst der Fromme (1601 bis 1675), gehörte. (jene Abbildungen gaben den Anlaß, daß die »Weymarische Bibel« da und dort als »Kurfürstenbibel« bezeichnet wurde.) Den Beschluß des Werkes bildete der Abdruck der vier christlichen Hauptsymbole sowie ein »schöner Bericht von der Augspurgischen Confession samt den Artickeln der Confession selbsten, wie sie in dem rechten Original, so im Jahre 1530 Kaiser Carl V. -

Erhard Weigel D(1625-1699) War in Der Zweiten Hälfte Des 17
er Mathematiker, Astronom, Pädagoge, Philosoph und Erfi nder Erhard Weigel D(1625-1699) war in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts Professor an der Universität Jena und gilt als zentrale und bemerkenswert schillernde Persönlichkeit Katharina Habermann, der Wissenschaft des 17. Jahrhunderts. Sein Wirken hatte einen maßgeblichen Anteil am Aufstieg der Salana während der Barockzeit und machte Jena im weitgefächerten Klaus-Dieter Herbst (Hg.) Bereich der mathematischen Wissenschaften zu einem inspirierenden Ausgangsort wissenschaftlicher Innovation. Der von Weigel als zentralem Impulsgeber ausgehende Wissens- und Methoden- Erhard Weigel (1625–1699) transfer vollzog sich über ein ausgedehntes personelles Beziehungsgefüge unter den Gelehrten der damaligen Zeit. Viele Zeugnisse von denen, die bei ihm studierten, und seine Schüler lassen ihn als einen glänzenden Lehrer erkennen. Zu Weigels Studenten zählen sehr bedeutende wie Gottfried Wilhelm Leibniz, der 1663 von Leipzig nach Jena kam, aber auch zahlreiche, die heute relativ unbekannt sind, in ihrer Zeit jedoch eine angese- hene Stellung bekleideten. Beiträge des 7. Erhard-Weigel-Kolloquiums 2014 Der hier – im Leibniz-Jahr 2016 – vorgelegte Tagungsband basiert auf den Vor- trägen des siebenten Erhard-Weigel-Kolloquiums, welches am 5. und 6. Dezember 2014 gemeinsam mit der Erhard-Weigel-Gesellschaft Jena an der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen veranstaltet wurde und sich sowohl mit der allgemeinen Thematik des akademischen Lehrer-Schüler-Verhältnisses befasst als auch einzelne Weigel-Schüler und ihr Wirken näher untersucht hat. Katharina Habermann, Klaus-Dieter Herbst (Hg.) Erhard Weigel (1625–1699) und seine Schüler Erhard Weigel Katharina Habermann, Klaus-Dieter Herbst (Hg.) ISBN: 978-3-86395-259-4 Universitätsverlag Göttingen Universitätsverlag Göttingen Katharina Habermann, Klaus-Dieter Herbst (Hg.) Erhard Weigel (1625–1699) und seine Schüler Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz. -

Philipp Jakob Spener Briefe Aus Der Frankfurter Zeit 1666–1686 Band 4
Philipp Jakob Spener Briefe aus der Frankfurter Zeit 1666–1686 Band 4 Philipp Jakob Spener Briefe aus der Frankfurter Zeit 1666–1686 Band 4: 1679–1680 Herausgegeben von Johannes Wallmann in Zusammenarbeit mit Martin Friedrich und Peter Blastenbrei Mohr Siebeck Gedruckt mit Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft. ISBN 3-16-148593-9 Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar. © 2005 Mohr Siebeck Tübingen. Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außer- halb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Microverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Das Buch wurde von Martin Fischer in Tübingen aus der Bembo-Antiqua gesetzt, von Gulde- Druck in Tübingen auf alterungsbeständiges Werkdruckpapier gedruckt und von der Buch- binderei Spinner in Ottersweier gebunden. Vorwort Zwei Jahre, nachdem der Band 1 der Spenerbriefe der Dresdner Zeit mit den Briefen vom Dresdner Amtsantritt 1686 bis zum Ende des Jahres 1687 erschien, folgt nun der vierte Band aus der Reihe der Spenerbriefe der Frankfurter Zeit 1666–1686. Der Band enthält die Briefe aus den Jahren 1679 und 1680, setzt also die Reihe fort, die in Band 1 mit den Briefen des ersten Frankfurter Jahrzehnts (1666–1674) begann und mit dem die Briefe von 1675–1676 umfassenden Band 2 und dem die Briefe 1678–1679 um- fassenden Band 3 fortgeführt wurde. Wie die beiden vorangehenden Bände enthält auch dieser Band wiederum die Briefe aus einem Zeitraum von zwei Jahren. -

Guido Heinrich Impuls Und Transfer. Literarische Feldbildungsprozesse
Guido Heinrich Impuls und Transfer. Literarische Feldbildungsprozesse in Magdeburg im 17. und 18. Jahrhundert Dissertation Fakultät für Geistes-, Sozial- und Erziehungswissenschaften Universität Magdeburg Magdeburg 2006 2 3 Vorbemerkung Die vorliegende Untersuchung wurde im März 2006 von der Fakultät für Geistes-, Sozial- und Erzie- hungswissenschaften der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg als Dissertation angenommen. Sie wurde am 8. Februar 2007 an der Magdeburger Universität verteidigt. Die Arbeit stellt Resultate eines dreijährigen Forschungsprojektes dar, dass – gefördert durch Mittel des Landes Sachsen-Anhalt – von 2002 bis 2005 unter dem Titel „Impuls und Transfer. Kultur- und Literaturgeschichte in der Region Magdeburg 1631-1815“ am Institut für Germanistik der Otto-von- Guericke-Universität unter der Leitung von Prof. Dr. Gunter Schandera und Prof. Dr. Wolfgang Adam durchgeführt wurde. Mein herzlicher Dank gilt all jenen Personen und Institutionen, die auf unterschiedliche Weise zum Gelingen des Vorhabens beigetragen haben – besonders aber Herrn Prof. Gunter Schandera, der die Beschäftigung mit dem Thema angeregt und nachhaltig unterstützt, und meinem Doktorvater, Herrn Prof. Dr. Wolfgang Adam, der die Arbeit mit großem Verständnis der Sache begleitet hat. Der Text wurde für die Veröffentlichung überarbeitet und aktualisiert. Magdeburg, den 3. Februar 2009 Guido Heinrich 4 5 Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung 1.1 Literatur und städtischer Raum ……………………………………….. 9 1.2 Forschungsstand …………………………………………………….. 12 1.3. Methodische -

Comenius-Gesellschaft
Monatshefte der Comenius-Gesellschaft. Herausgegeben von Ludwig Keller. Vierter Band. Neuntes und zehntes Heft. November—Dezember 1895. ------------------------------------------— ♦ - 4 « » - » ■ ------------------------------------ Berlin und Münster i:/w. Verlag der Comenius-Gesellschaft. Johannes Bredt in Kommission. ' ' p t ; 1895. Der Bezugspreis beträgt im Buchhandel und bei der Post jährlich 10 Mark. Alle Rechte Vorbehalten. Das Personen- und Orts-Register zum IV. Bande wird mit dem 1. Hefte des V. Bandes ausgegeben. Inhalt d e s neunten und zehnten Heftes 189 5. Abhandlungen. Seite Dr: Paul Natorp, Ludwig Natorp. Ein Beitrag zur Geschichte der Ein führung Pestalozzischer Grundsätze in die Volksschule Preussens . 261 Dr. Karl Dissel, Der Weg des Lichtes. Die Via lucis des Comenius . 295 Dr. Georg Schmid, Sigismund E v e n iu s ....................................................306 Litter aturb eric h t ............................... 314 G. Voigt, Bischof Bertram von Metz (1180—1212). — H. Haupt, deutsch-böhmische Wal denser. — Uebingcr, Beiträge zur Geschichte Nicolaus von Cusas. — Knaake, Joh. Pupper von Goch.— Fr. Wächter, Briefe an Erasmus. — K. Krafft, Gerh. Oeiniken. — A. Wirth, Die ev. Schule des 16. u. 17. .Tahrh. — H . S. Burrage, The Anabaptists of the 16. Century. — Alfr. Rausch, Christian Thomasius und Erh. Weigel. — Alb. F (5 camp, D. G. Morhof. — W. F a - bricius, Die Studentenorden des 18. Jahrli. Preisaufg-abe der Comenius-Gesellseliaft für 1896 . 318 Nachrichten ............... .... 319 E / Troeltsch (Prof. in Heidelberg), Über Religion und Kirche. — K. Burdach (Prof. in Halle), Über den Zusammenhang zwischen Luther und den böhmischen Brüdern. — „Pickarden“ und Reformierte. — Jos. Rebers Ausgabe der Naturkunde des Comenius. — Der Jesuit B. B ai bin us über Comenius. — Die Bibliothek des Comenius in Fulnek. -
Wolfgang Ratke (Ratichius) and His Educational Writings
Durham E-Theses Wolfgang Ratke (Ratichius) and his educational writings Walmsley, John Brian How to cite: Walmsley, John Brian (1990) Wolfgang Ratke (Ratichius) and his educational writings, Durham theses, Durham University. Available at Durham E-Theses Online: http://etheses.dur.ac.uk/6048/ Use policy The full-text may be used and/or reproduced, and given to third parties in any format or medium, without prior permission or charge, for personal research or study, educational, or not-for-prot purposes provided that: • a full bibliographic reference is made to the original source • a link is made to the metadata record in Durham E-Theses • the full-text is not changed in any way The full-text must not be sold in any format or medium without the formal permission of the copyright holders. Please consult the full Durham E-Theses policy for further details. Academic Support Oce, Durham University, University Oce, Old Elvet, Durham DH1 3HP e-mail: [email protected] Tel: +44 0191 334 6107 http://etheses.dur.ac.uk ABSTRACT John Brian Walmsley Wolfgang Ratke (Ratichius) and his educational writings Wolfgang Ratke (Ratichius, 1571-1635) presents something of a paradox in educational history. Born in Holstein, he first came into prominence through the Memorandum he presented at the election of the Holy Roman Emperor in Frank• furt in 1612. The Memorandum contained a brief proposal for reforming schools and bringing about unity of government, language and religion throughout the empire. Apart from these few facts, there is almost nothing concerning Ratke on which historians agree. -
Stockholmer Germanistische Forschungen 77
ACTA UNIVERSITATIS STOCKHOLMIENSIS Stockholmer Germanistische Forschungen 77 (Re-)Contextualizing Literary and Cultural History The Representation of the Past in Literary and Material Culture Edited by Elisabeth Wåghäll Nivre, Beate Schirrmacher, and Claudia Egerer © The authors and Acta Universitatis Stockholmiensis, Stockholm 2013 The publication is avaible for free on www.sub.su.se Cover photographs: The Cloisters museum and gardens, The Metropolitan Museum of Art, New York © Elisabeth Wåghäll Nivre ISSN 0491-0893 ISBN 978-91-87235-21-4 (e-copy) ISBN 978-91-87235-22-1 Printed in Sweden by US-AB, Stockholm 2013 Distributor: Stockholm University Library, Sweden Contents Preface and Acknowledgements .................................................................. vii I Theorizing Literary and Cultural History ................................................ 11 No Contextualization without Literary Theory and Concepts: Problems, Kinds and Criteria of Contextualizing Literary History Ansgar Nünning ........................................................................................ 13 Context—Intertext: A Prerequisite of Cultural Relevance and Value Maik Bierwirth ........................................................................................... 49 II Ordering Thoughts—Making Sense of the World ................................. 63 Early Modern Dramaturgy of “Horror” Cora Dietl .................................................................................................. 65 Landscaping Literature in Early Modern England: -

Źródła Agricola G., De Re Metallica Libri XII, Il. R.M. Deutsch, Z. Specklin
Źródła Agricola G., De re metallica libri XII, il. R.M. Deutsch, Z. Specklin, Basel 1556. Aldrovandi U., Ornithologia hoc est de avibus, Francofurti 1640. Aldrovandi U., De quadrupedibus, Bononiae 1645. Aldrovandi U., De insectis, Frankfurt 1623. Alsted J.H., Artium liberalium ac facultatum omnium systemum mnemonicum, de modo discendi cum Encyclopaediae, Artis Lullisticae et Cabbalisticae perfectissima explicatione, Francofurti 1610. Alsted J.H., Systema Mnemonicum duplex. I. Minus succincto praeceptorum ordine quatuor libris adornatum. II. Maius, pleniore praeceptum Methodo, et commentariis scriptis ad praeceptorum illustrationem adornatum septem libris. In quibus artes memoravivae praecepta plene et methodice tradundur, Francofurti 1610, 8o, 830+731 S. Alsted J.H., Consiliarius Academicus et scholasticus: id est Methodus Formandorum Studiorum: Continens Commonefactiones, Consilia, Regulas, Typos, Calendaria, Diaria, De ratione bene discendi & ordine studiorum recte instituendo: perpetuis Tabulis adornata: in gratiam Studiosorum tam Academicorum quam trivialium in Scholis particularibus, ut vocant. Accessit Consilium De Copia Rerum et Verborum, id est Methodo disputandi de omni scibili, Argentorati 1610. Alsted J.H., Methodus Admirandorum Mathematicorum: Complectens Novem libros Metheseōs universae: In Quorum 1 Mathematica generalis. 2 Arithmetica. 3 Geometria. 4 Cosmographia. 5 Uranoscopia. 6 Geographia. 7 Optica. 8 Musica. 9 Architectonica, Herbornae Nassoviorum 1613 (wydania kolejne: 1623, 1641, 1657). Alsted J.H., Metaphysica tribus librios distincta: 1. Praecepta methodica, 2. Theoremata selecta et 3. Commentariola dilucida..., Herbornae Nassoviorum 1616. Alsted J.H., Encyclopaedia Septem tomis distincta..., Herbornae Nassoviorum 1630. Alsted J.H., Clavis Artis Lullianae, Argentorati 1633. [Alvares M. SJ] Emmanuelis Alvarii, De institutione grammatica libri tres, Venetiis 1581. [Amman J.] Jost Amman’s Stände und Handwerker. Mit Versen von Hans Sachs, Mūnchen 1884 (Liebhaber-Bibliothek alter Illustratoren in Facsimile-Reproduktion, Bd.