Zukunfts(T)Raum Elstertal
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
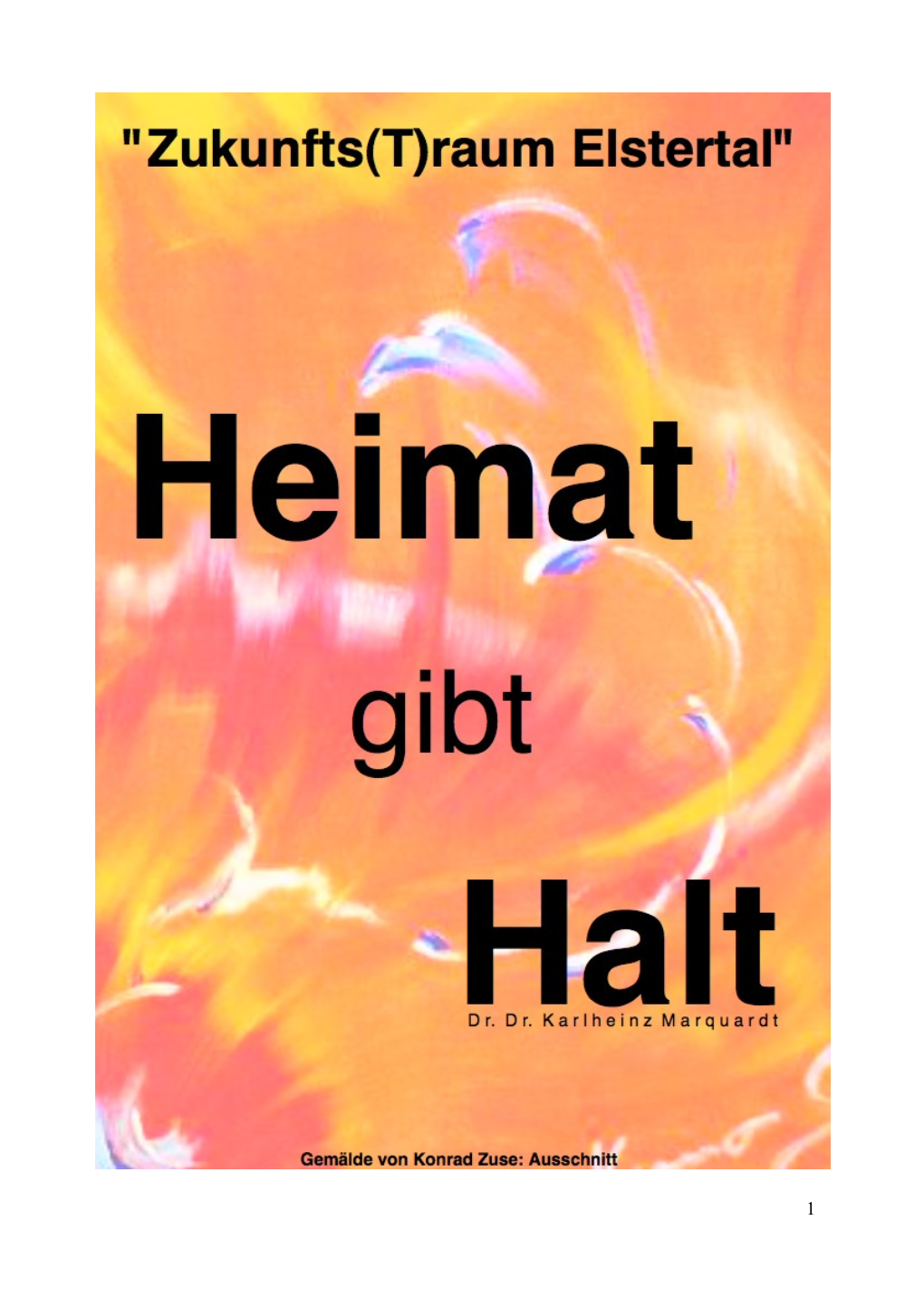
Load more
Recommended publications
-

Official Journal L 338 Volume 35 of the European Communities 23 November 1992
ISSN 0378 - 6978 Official Journal L 338 Volume 35 of the European Communities 23 November 1992 English edition Legislation Contents I Acts whose publication is obligatory II Acts whose publication is not obligatory Council Council Directive 92 /92/ EEC of 9 November 1992 amending Directive 86/ 465 / EEC concerning the Community list of less-favoured farming areas within the meaning of Directive 75 / 268 / EEC (Federal Republic of Germany) 'New Lander* 1 Council Directive 92 /93 / EEC of 9 November 1992 amending Directive 75 /275 / EEC concerning the Community list of less-favoured farming areas within the meaning of Directive 75 / 268/ EEC (Netherlands) 40 Council Directive 92 / 94/ EEC of 9 November 1992 amending Directive 75 / 273 /EEC concerning the Community list of less-favoured farming areas within the meaning of Directive 75 / 268/ EEC (Italy) 42 2 Acts whose titles are printed in light type are those relating to day-to-day management of agricultural matters, and are generally valid for a limited period . The titles of all other Acts are printed in bold type and preceded by an asterisk. 23 . 11 . 92 Official Journal of the European Communities No L 338 / 1 II (Acts whose publication is not obligatory) COUNCIL COUNCIL DIRECTIVE 92/92/ EEC of 9 November 1992 amending Directive 86 /465 / EEC concerning the Community list of less-favoured farming areas within the meaning of Directive 75 /268 / EEC (Federal Republic of Germany ) 'New Lander' THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES , Commission of the areas considered eligible for inclusion -

Richtlinie Sonderprogramm Klimaschutz
Richtlinie des Freistaates Thüringen für die Zuweisungen an Gemeinden und Landkreise für Klimaschutz 1. Zuweisungszweck, Rechtsgrundlage 1.1 Der Freistaat Thüringen, vertreten durch die Ministerin für Umwelt, Energie und Naturschutz, gewährt Zuweisungen nach Maßgabe dieser Richtlinie auf der Grundlage des Thüringer Corona-Pandemie-Hilfefondsgesetzes und des Thüringer Klimagesetzes sowie des Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetzes unter Anwendung der §§ 23 und 44 der Landeshaushaltsordnung (ThürLHO) sowie der hierzu erlassenen Verwaltungsvorschriften in den jeweils geltenden Fassungen. 1.2 Zweck der Zuweisung ist es, Investitionen von Gemeinden und Landkreisen für Klimaschutz nach § 7 Absätze 1 und 4 ThürKlimaG zu ermöglichen und damit gleichzeitig Hilfen für die Stabilisierung der kommunalen Haushalte und zum Erhalt der Leistungsfähigkeit nach § 2 Abs. 2 Punkt 8 Thüringer Corona-Pandemie- Hilfefondsgesetz im Bereich Klimaschutz zu leisten. Ziel der Investitionen sind kommunale Beiträge zur Klimaneutralität. 1.3 Ein Rechtsanspruch auf die Zuweisung besteht nicht. 2. Gegenstand der Zuweisung Gegenstand der Zuweisung sind Finanzhilfen für Investitionen im kommunalen Klimaschutz. 3. Zuweisungsempfänger Zuweisungsempfänger nach dieser Richtlinie sind die Thüringer Gemeinden und Landkreise. 4. Art und Umfang, Höhe der Zuweisung 4.1 Art und Form der Zuweisung, Finanzierungsart Die Zuweisung wird als nicht rückzahlbarer Zuschuss in Form einer Projektförderung als Festbetragsfinanzierung gewährt. 4.2 Verwendung Die Zuweisung kann für sämtliche Projektausgaben für Investitionen und die Vorbereitung solcher im kommunalen Klimaschutz im Sinne von §§ 4, 5, 7, 8 und 9 ThürKlimaG verwendet werden. Eine nicht abschließende Positivliste von möglichen Maßnahmen findet sich in Anlage 1 der Richtlinie. 4.3 Höhe der Zuweisung Die Höhe der Zuweisung bemisst sich für Gemeinden, Landkreise und kreisfreie Städte nach den Anlagen 2a, 2b und 2c dieser Richtlinie, soweit nicht nach Nr. -

Amtsblatt Der Verwaltungsgemeinschaft Heideland-Elstertal-Schkölen
Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Heideland-Elstertal-Schkölen mit den Gemeinden Crossen a. d. Elster, Hartmannsdorf, Heideland, Rauda, Silbitz, Walpernhain und der Stadt Schkölen 26. Jahrgang Samstag, den 10. Oktober 2020 Nr. 10 SPRECHZEITEN UND RUFNUMMERN Crossen Telefon: 036693 / 470 - 0 Meldebehörde: Telefon: 036693 / 470 - 19 Montag geschlossen Dienstag 09.00 - 11.30 Uhr und 13.00 - 16.00 Uhr Mittwoch 09.00 - 11.30 Uhr Donnerstag 09.00 - 11.30 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr Freitag 09.00 - 12.00 Uhr Königshofen Telefon: 036691 / 51 771 Dienstag 09.00 - 11.00 Uhr Donnerstag 16.00 - 18.00 Uhr Schkölen Telefon: 036694 / 403 - 0 Meldebehörde Telefon: 036694 / 403 - 16 Montag geschlossen Dienstag 09.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 16.00 Uhr Mittwoch geschlossen Donnerstag 08.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 17.30 Uhr Freitag 09.00 - 11.30 Uhr jeden letzten Samstag nach Vereinbarung Bürgermeister Crossen a.d. Elster Herr Berndt donnerstags 17.00 - 19.00 Uhr Tel. dienstl. 036693 / 470 - 16 Hartmannsdorf Herr Baumert donnerstags 17.00 - 18.00 Uhr Tel. dienstl. 036693 / 22 463 Heideland Herr Baumann mittwochs 17.15 - 18.15 Uhr Tel. dienstl. 036691 / 51 771 Rauda Herr Dietrich mittwochs 17.00 - 18.00 Uhr Tel. dienstl. 036691 / 43 402 Schkölen Herr Dr. Darnstädt donnerstags 15.00 - 17.30 Uhr Tel. dienstl. 036694 / 40 312 Silbitz Herr Mahl donnerstags 16.00 - 17.00 Uhr Tel. dienstl. 036693 / 22 343 Seifartsdorf Herr Mahl donnerstags 17.30 - 18.00 Uhr Tel. dienstl. 036691 / 43 365 Walpernhain Herr Weihmann dienstags 18.00 - 19.00 Uhr Tel. -

Abfallkalender 2021 Saale-Holzland-Kreis.Pdf
ABFALLKALENDER Dienstleistungsbetrieb des Saale-Holzland-Kreises 2021 Anmeldung Sperrmüll, Schrott, Elektro- und Elektronikgeräte ✆ 03641 47 253-14 03641 47 253-20 [email protected] Bitte den Abfallkalender nicht gleich entsorgen! Zuverlässig entsorgen Veolia Umweltservice betreibt Wertsto - höfe in Eisenberg und Kahla. An diesen Standorten sammeln und entsorgen wir für Sie: • Elektrogeräte, Glas, Holz, Metalle • Gewerbeabfälle, Baustellenabfall und Bauschutt, Grünabfall und Astschnitt, Asbestabfälle • und viele weitere Abfallarten Öffnungszeiten: Siehe Abfallkalender Containerdienst 3-36 m3 (Anmeldung unter 03641-47253-12) Veolia Umweltservice Ost GmbH & Co. KG Wertstoffhof Wertstoffhof Mozartstraße 4, Ölwiesenweg 7, 07607 Eisenberg 07768 Kahla, Mobil 0172-1051451 Mobil 0171 8189922 [email protected] www.veolia.de Ressourcen für die Welt Inhaltsverzeichnis Öffnungszeiten Wertstoffhöfe ............................................................................4 Anmeldung Sperrmüll, Elektro- und Elektronikgeräte und Schrott Zuverlässig entsorgen einschließlich Selbstanlieferung ........................................................................5 Ihr Ansprechpartner im Dienstleistungsbetrieb / Abfallwirtschaft ......................6 Abfallgebühren ................................................................................................. 7 Veolia Umweltservice betreibt Wertsto - Was entsorge ich wo? | Glasrecycling ........................................................ 8 – 11 höfe in Eisenberg und Kahla. An diesen Entsorgung -

Heideland-Elstertal-Schkölen
Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Heideland-Elstertal-Schkölen mit den Gemeinden Crossen a. d. Elster, Hartmannsdorf, Heideland, Rauda, Silbitz, Walpernhain und der Stadt Schkölen 26. Jahrgang Samstag, den 14. November 2020 Nr. 11 SPRECHZEITEN UND RUFNUMMERN Crossen Telefon: 036693 / 470 - 0 Meldebehörde: Telefon: 036693 / 470 - 19 Montag geschlossen Dienstag 09.00 - 11.30 Uhr und 13.00 - 16.00 Uhr Mittwoch 09.00 - 11.30 Uhr Donnerstag 09.00 - 11.30 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr Freitag 09.00 - 12.00 Uhr Königshofen Telefon: 036691 / 51 771 Dienstag 09.00 - 11.00 Uhr Donnerstag 16.00 - 18.00 Uhr Schkölen Telefon: 036694 / 403 - 0 Meldebehörde Telefon: 036694 / 403 - 16 Montag geschlossen Dienstag 09.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 16.00 Uhr Mittwoch geschlossen Donnerstag 08.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 17.30 Uhr Freitag 09.00 - 11.30 Uhr jeden letzten Samstag nach Vereinbarung Bürgermeister Crossen a.d. Elster Herr Berndt donnerstags 17.00 - 19.00 Uhr Tel. dienstl. 036693 / 470 - 16 Hartmannsdorf Herr Baumert donnerstags 17.00 - 18.00 Uhr Tel. dienstl. 036693 / 22 463 Heideland Herr Baumann mittwochs 17.15 - 18.15 Uhr Tel. dienstl. 036691 / 51 771 Rauda Herr Dietrich mittwochs 17.00 - 18.00 Uhr Tel. dienstl. 036691 / 43 402 Schkölen Herr Dr. Darnstädt donnerstags 15.00 - 17.30 Uhr Tel. dienstl. 036694 / 40 312 Silbitz Herr Mahl donnerstags 16.00 - 17.00 Uhr Tel. dienstl. 036693 / 22 343 Seifartsdorf Herr Mahl donnerstags 17.30 - 18.00 Uhr Tel. dienstl. 036691 / 43 365 Walpernhain Herr Weihmann dienstags 18.00 - 19.00 Uhr Tel. -

Amtsblatt Der Verwaltungsgemeinschaft Heideland-Elstertal-Schkölen
Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Heideland-Elstertal-Schkölen mit den Gemeinden Crossen a. d. Elster, Hartmannsdorf, Heideland, Rauda, Silbitz, Walpernhain und der Stadt Schkölen 25. Jahrgang Montag, den 12. August 2019 Nr. 9 SPRECHZEITEN UND RUFNUMMERN Crossen Telefon: 036693 / 470 - 0 Meldebehörde: Telefon: 036693 / 470 - 19 Montag geschlossen Dienstag 09.00 - 11.30 Uhr und 13.00 - 16.00 Uhr Mittwoch 09.00 - 11.30 Uhr Donnerstag 09.00 - 11.30 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr Freitag 09.00 - 12.00 Uhr Königshofen Telefon: 036691 / 51 771 Dienstag 09.00 - 11.00 Uhr Donnerstag 16.00 - 18.00 Uhr Schkölen Telefon: 036694 / 403 - 0 Meldebehörde Telefon: 036694 / 403 - 16 Montag geschlossen Dienstag 09.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 16.00 Uhr Mittwoch geschlossen Donnerstag 08.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 17.30 Uhr Freitag 09.00 - 11.30 Uhr jeden letzten Samstag nach Vereinbarung Bürgermeister Crossen a.d. Elster Herr Berndt donnerstags 17.00 - 19.00 Uhr Tel. dienstl. 036693 / 470 - 16 Hartmannsdorf Herr Baumert donnerstags 17.00 - 18.00 Uhr Tel. dienstl. 036693 / 22 463 Heideland Herr Baumann mittwochs 17.15 - 18.15 Uhr Tel. dienstl. 036691 / 51 771 Rauda Herr Dietrich mittwochs 17.00 - 18.00 Uhr Tel. dienstl. 036691 / 43 402 Schkölen Herr Dr. Darnstädt donnerstags 15.00 - 17.30 Uhr Tel. dienstl. 036694 / 40 312 Silbitz Herr Mahl donnerstags 16.00 - 17.00 Uhr Tel. dienstl. 036693 / 22 343 Seifartsdorf Herr Mahl donnerstags 17.30 - 18.00 Uhr Tel. dienstl. 036691 / 43 365 Walpernhain Herr Weihmann dienstags 18.00 - 19.00 Uhr Tel. -

Familienbuch Graitschen Bei Bürgel 1
Familienbuch Graitschen bei Bürgel 1 FAMILIENBUCH GRAITSCHEN bei BÜRGEL Buchstaben J bis M Nr. 678 bis 927 678 Jacob , Friedrich Wilhelm, ledig , Bürger in Bürgel, Schäfer Thiemendorf , G 07.06.1825 Bürgel Historie des Ehemanns: Vater: Gottfried Jacob, gew. Bürger und Hutmacher zu Bürgel H 30.07.1850 Graitschen/B. Titscher , Johanna Sophia, ledig , <1390> , G 14.02.1825 ebd. 679 Jäger , Georg Andreas, ledig , N.u.E. Hainspitz, Maurer , G Hainspitz Historie des Ehemanns: Vater: Johann Jäger, N.u.E. in Hainspitz, ält. Sohn H 13.06.1731 Graitschen/B. Aepfler , Maria Elisabeth, ledig , <20> , G 30.08.1706 ebd. 680 Jähnert , Gottlieb, Dienstknecht Graitschen/B. , G 1810 Thalbürgel , D 09.12.1886 Graitschen/B. , Alter: 76 J. , ledig 681 Jahn , Johann 1, ledig , N.u.E. Graitschen/B. , <684> , «682» , G um 1648 Graitschen/B. Historie des Ehemanns: <Pate bei> Johann Rudolph 1667 Johann Beyer 1675 Maria Merckel 1685 Johann Nicolaus Draber 1687 Joh. Georg Goßrau 1691 H 1) 24.12.1673 Bobeck Zeise , Catharina, ledig , G um 1653 ebd. , Alter: 27 J. Historie der Ehefrau: Sterbeeintrag fehlt wegen Lücke im KB . Kind: 1) Andreas , G 23.10.1675 Graitschen/B. <Paten> Andreas, Joh. Schillings filius Johannes, Samuel Friedels in Bobeck Sohn Christina, Andreas Weidners Obermüllers filia 682 Jahn , Johann 1, Witwer , N.u.E. Graitschen/B. , <684> , «681» , G um 1648 Graitschen/B. H 2) 08.01.1680 ebd. Fischer , Anna, ledig , <363> , G um 1654 ebd. Historie der Ehefrau: <Pate bei> Anna Magdalena Draber Anna Aepfler 1691 Zur Familie: Mann 1691 als Eseltreiber bezeugt - Kinder: 1) Johann 2, G 23.09.1682 ebd. -

Heideland-Elstertal
Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Heideland-Elstertal mit den Gemeinden Crossen a. d. Elster, Hartmannsdorf, Heideland, Rauda, Silbitz und Walpernhain 15. Jahrgang Montag, den 9. März 2009 Nr. 02 SPRECHZEITEN UND RUFNUMMERN Verwaltungsgemeinschaft Crossen an der Elster: Telefon: (036693) 470-0 Meldebehörde: Telefon: (036693) 470-19 Verwaltungsstelle Königshofen: Telefon: (036691) 51771 Montag geschlossen Dienstag 09.00 - 11.30 Uhr und 13.00 - 16.00 Uhr Mittwoch 09.00 - 11.30 Uhr Donnerstag 09.00 - 11.30 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr Freitag 09.00 - 12.00 Uhr Bürgermeister Crossen a. d. Elster Herr Lüdtke donnerstags 17.00 - 19.00 Uhr Tel. dienstl. 036693 / 470-11 Hartmannsdorf Herr Baumert donnerstags 17.00 - 18.00 Uhr Tel. dienstl. 036693 / 22 463 Heideland Herr Herbst donnerstags 17.15 - 18.15 Uhr Tel. dienstl. 036691 / 51 771 Rauda Herr Dietrich mittwochs 17.00 - 18.00 Uhr Tel. dienstl. 036691 / 43 402 Silbitz Herr Schlag donnerstags 16.00 - 17.00 Uhr Tel. dienstl. 036693 / 22 343 Seifartsdorf Herr Schlag donnerstags 17.15 - 18.00 Uhr Tel. dienstl. 036691 / 43 365 Walpernhain Herr Hanf dienstags 17.00 - 18.00 Uhr Tel. dienstl. 036691 / 46 938 Forstrevierleiterin Frau Thar Jeden letzten Donnerstag im Monat, Sprechstunde von 16.00 - 18.00 Uhr im Mehrzweckgebäude in Königshofen, Pillingsgasse 2. In dringenden Angelegenheiten telefonisch erreichbar unter Nummer: 036427 / 20061 Fax: 036427 / 20717 Kontaktbereichsbeamter Herr Kurth in Crossen Nöben 3 donnerstags 16.00 - 18.00 Uhr Tel. 036693 / 23 839 in Königshofen Pillingsgasse 2 dienstags 15.00 - 16.00 Uhr Tel. 036691 / 51 771 Schiedsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Heideland-Elstertal Nach telefonischer Vereinbarung: Frau llona Bachmann, Walpernhain, 036691 / 43982 Frau Carola Bergmann, Crossen an der Elster, 036693 / 20601 Frau Barbara Schmidt, Hartmannsdorf, 0170 / 2270613 Verwaltungsgemeinschaft Heideland-Elstertal - 2 - Nr. -

Umwelt Regional
Bevölkerungsentwicklung 1989 bis 2018 Saale-Holzland-Kreis und kreisfreie Stadt Jena 1989-2004 2004-2018 Burgenlandkreis Burgenlandkreis Dornburg- Dornburg- Landkreis Landkreis Thier- Thier- Weimarer Land Wichmar schneck Weimarer Land Wichmar schneck Frauen- Walpern- Frauen- Walpern- Schkölen Schkölen prießnitz hain prießnitz hain Camburg Heideland Camburg Heideland Zimmern Zimmern Merten- Merten- Hainichen Gösen Hainichen Gösen dorf Petersberg Crossen dorf Petersberg Crossen Tautenburg Tautenburg Lehesten Neuen- a.d. Elster Lehesten Neuen- a.d. Elster Rauschwitz Rauschwitz gönna Hartmanns- gönna Hartmanns- Golms - Löber- Eisenberg Sil- Golms - Löber- Eisenberg Sil- Pox- Rauda dorf Pox- Rauda dorf dorf schützGrait- bitz dorf schützGrait- bitz dorf Hain- dorf Hain- schen schen Jena- Serba spitz Jena- Serba spitz löbnitz Nausnitz löbnitz Nausnitz Bürgel Bürgel Weißenborn Tauten- Weißenborn Tauten- Groß- Groß- hain hain Jena löbichau Waldeck Bad Jena löbichau Waldeck Bad Schön- Klosterlausnitz Schön- Klosterlausnitz gleina Schei- gleina Schei- ditzAlbersd. Herms- ditzAlbersd. Herms- Schlöben Schlöben Bobeck dorf Bobeck dorf Ruttersdorf- Schleif- Ruttersdorf- Schleif- Lotschen Bollberg Lotschen Bollberg Bucha reisen Rei- Bucha reisen Rei- Laas- Laas- Zöllnitz Quirla Mörsdorf chenbach Zöllnitz Quirla Mörsdorf chenbach dorf St. dorf St. Sulza Raus- Stadtroda Möckern Gangloff Sulza Raus- Stadtroda Möckern Gangloff Rothen- Großbocke-dorf Rothen- Großbocke-dorf Milda Tissa Milda Tissa stein K l e i n - dra Tröbnitz Eine- stein K l e i n - dra Tröbnitz Eine- bockedra Lippersd.- Otten- born bockedra Lippersd.- Otten- born Altenberga Geisen-Walters- Tau- Altenberga Geisen-Walters- Tau- Schöps Gneus Erdmannsd. dorf Schöps Gneus Erdmannsd. dorf Unter- hain dorf tendorf Unter- hain dorf tendorf Groß- Klein- Groß- Klein- bodnitz Rattels-Weiß- bodnitz Rattels-Weiß- pürschütz ebersd. pürschütz ebersd. -

Verbandssatzung
VERBANDSSATZUNG des Zweckverbandes Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung Eisenberg Präambel Die Städte und Gemeinden Eisenberg, Hainspitz, Petersberg, Rauschwitz, Gösen, Merten- dorf, Schkölen, Heideland, Crossen a. d. Elster, Hartmannsdorf, Silbitz, Rauda, Walpern- hain, Seifartsdorf, Serba, Thierschneck, Bürgel, Graitschen b. Bürgel, Poxdorf und Nausnitz schließen sich nach § 16 (1) des Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (KGG) vom 11. Juni 1992 (GVBl. S. 232) geändert durch Gesetz vom 10. November 1995 (GVBl. S. 346) zu einem Zweckverband zusammen. § 1 Name und Sitz Der Zweckverband führt den Namen "Zweckverband Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung Eisenberg" (ZWE) und hat seinen Sitz in 07607 Eisenberg, Teichstraße 16. § 2 Verbandsmitglieder (1) Verbandsmitglieder sind die Städte und Gemeinden Eisenberg, Hainspitz, Petersberg, Rauschwitz, Gösen, Mertendorf, Schkölen, Heideland, Crossen a. d. Elster, Hartmannsdorf, Silbitz, Rauda, Walpernhain, Seifartsdorf, Serba, Thierschneck, Bürgel, Graitschen b. Bürgel, Poxdorf und Nausnitz. (2) Die Stadt Bürgel und die Gemeinden Graitschen b. Bürgel, Poxdorf und Nausnitz sind Verbandsmitglieder des ZWE nur im Bereich Wasser. § 3 Räumlicher Wirkungskreis Der räumliche Wirkungskreis des ZWE umfaßt das Gebiet seiner Verbandsmitglieder. Ausgenommen ist der Bereich Abwasser für das Gebiet der Verbandsmitglieder laut § 2 (2). § 4 Aufgaben und Befugnisse (1) Aufgabe des ZWE ist die Versorgung mit Wasser und die Beseitigung des Abwassers im Verbandsgebiet. Zu diesem Zweck übernimmt der ZWE die Aufgabe, für seine Mitgliedsge- meinden die dafür erforderlichen Anlagen zu planen, zu errichten, zu betreiben, zu unterhal- ten und bei Bedarf zu erneuern. Die damit verbundenen Rechte und Pflichten der Ver- bandsmitglieder gehen auf den ZWE über. (2) Der ZWE hat das Recht, für den ihm übertragenen Aufgabenbereich Satzungen und Ver- ordnungen im Verbandsgebiet der Verbandsmitglieder zu erlassen. -

ABFALLKALENDER Dienstleistungsbetrieb Des Saale-Holzland-Kreises 2020
ABFALLKALENDER Dienstleistungsbetrieb des Saale-Holzland-Kreises 2020 Anmeldung Sperrmüll, Schrott, Elektro- und Elektronikgeräte ✆ 03641 47 253-14 03641 47 253-20 [email protected] Bitte den Abfallkalender nicht gleich entsorgen! Zuverlässig entsorgen Veolia Umweltservice betreibt Wertsto - höfe in Eisenberg und Kahla. An diesen Standorten sammeln und entsorgen wir für Sie: • Al extilien, Elektrogeräte, Folie, Glas, Holz, Metalle sowie Altreifen • Gewerbeabfälle, Baustellenabfall und Bauschutt, Grünabfall und Astschnitt, Asbestabfälle • und viele weitere Abfallarten Öffnungszeiten: Siehe Abfallkalender Containerdienst 3-36 m3 (Anmeldung unter 03641-47253-12) Veolia Umweltservice Ost GmbH & Co. KG Wertstoffhof Wertstoffhof Mozartstraße 4, Ölwiesenweg 7, 07607 Eisenberg 07768 Kahla, Mobil 0172-1051451 Mobil 0171 8189922 [email protected] www.veolia.de Ressourcen für die Welt Inhaltsverzeichnis Öffnungszeiten Wertstoffhöfe ................................................................................................................ 4 Anmeldung Sperrmüll, Elektro- und Elektronikgeräte und Schrott | Ihre Ansprechpartner im Dienstleistungsbetrieb / Abfallwirtschaft ........................................................................................... 5 Abfallgebühren | Restmülltonne defekt – was tun? ............................................................................... 6 Zuverlässig entsorgen Verkaufsstellen für Restmüllsäcke | Wie erfolgt die Entsorgung bei Baumaßnahmen? Müllkübel eingefroren – was tun? ......................................................................................................... -

Nr. 2 Amtsblatt Des Saale-Holzland-Kreises 26 25.02.2017 - Nr
25.02.2017 - Nr. 2 Amtsblatt des Saale-Holzland-Kreises 26 25.02.2017 - Nr. 2 Amtsblatt des Saale-Holzland-Kreises 27 meinschaftsvorsitzende nach vorheriger Anhörung der Kommunalauf- Amtlicher Teil sicht. schließen die Gemeinden Crossen an der Elster, Hartmannsdorf, Hei-(2) Für den Fall, daß einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung Kommunalaufsicht deland, Rauda, Seifartsdorf, Silbitz, und Walpernhain, im Folgenden rechtsunwirksam sein sollten, wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Beteiligte genannt - jeweils vertreten durch den Bürgermeister - und die Bestimmungen nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung ist in eine Zweckvereinbarung zur Übertragung von Aufgaben Verwaltungsgemeinschaft „Heideland-Elstertal“ - vertreten durch den Ge-gesetzlich wirksame zu ändern, wie es dem Sinn und Zweck der Verein- meinschaftsvorsitzenden - nachfolgende Zweckvereinbarung: barung entspricht. nach dem Thüringer Schiedsstellengesetz zwischen der Verwaltungsgemeinschaft Heideland-Elstertal § 1 Übertragene Aufgaben § 7 Überleitungsbestimmungen und den Gemeinden Crossen, Hartmannsdorf, Heideland, Rauda, Seifartsdorf, Silbitz, Walpernhain (1) Die Beteiligten übertragen die ihnen nach dem Thür. Schiedsstellen-Bis zum Amtsantritt der Schiedsperson üben die bisherigen Schiedsper- vom 27.11.1996 und ihrer Genehmigung gesetz obliegenden Aufgaben und Verpflichtungen auf die Verwaltungs-sonen ihr Amt weiter aus. gemeinschaft. § 8 Inkrafttreten Genehmigung (2) Die Verwaltungsgemeinschaft richtet im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes über die Schiedsstellen in den Gemeinden vom 13. Sep- der Zweckvereinbarung zur Übertragung von Aufgaben nach dem Diese Zweckvereinbarung tritt zum 01.01.1997 in Kraft. Gleichzeitig tre- tember 1990 (DDR-GBl. I Nr. 61) in der Form der Neubekanntmachung Thüringer Schiedsstellengesetz i. d. F. der Neubekanntmachung ten der öffentlich-rechtliche Vertrag zwischen den Gemeinden 1. Crossen vom 17.05.1996 (GVBl. S. 61 ff) eine Schiedsstelle mit der Bezeichnung des Thüringer Schiedsstellengesetzes vom 17.