Umweltbericht 2008 Situation Und Perspektiven Bereich Wasser
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
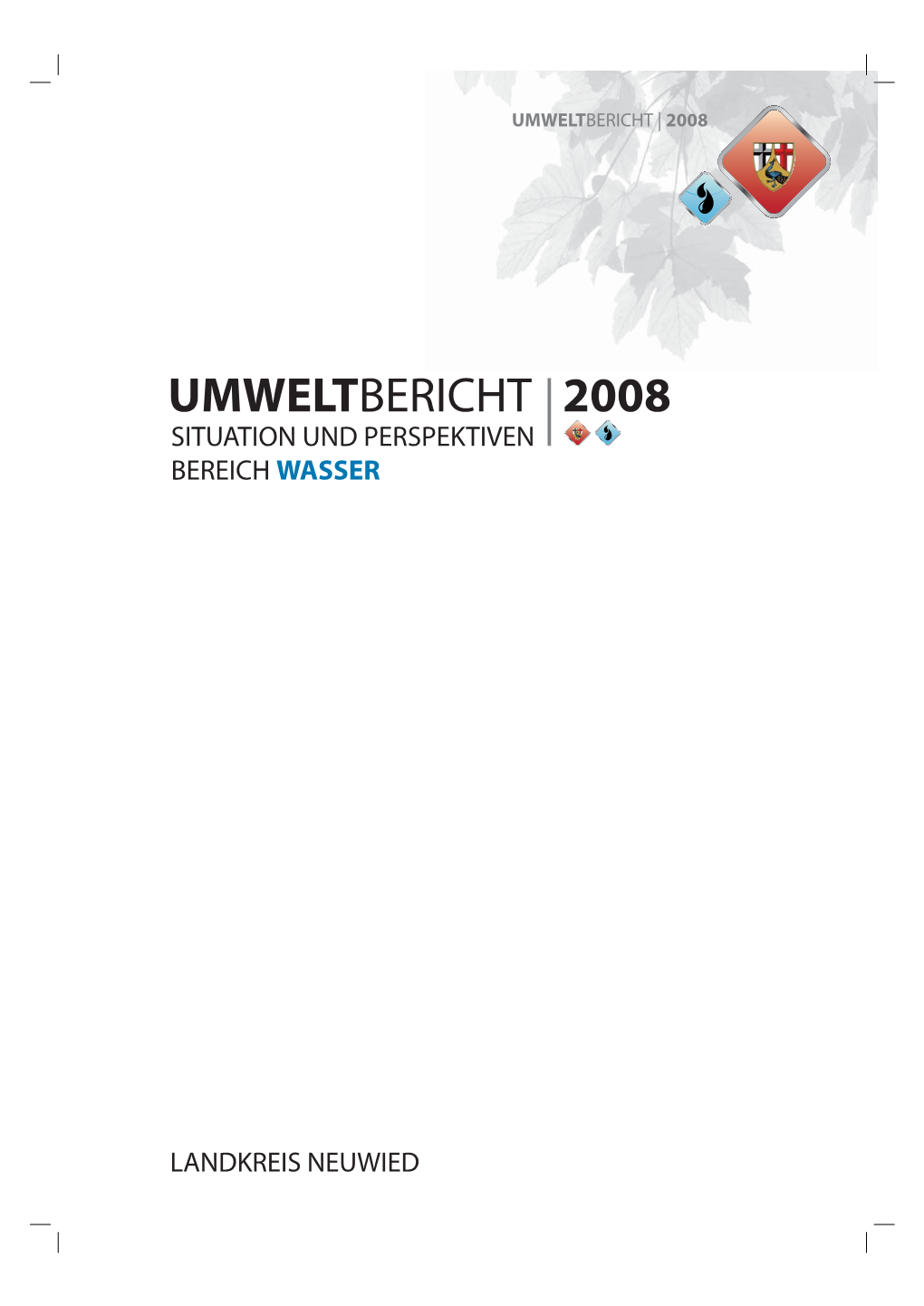
Load more
Recommended publications
-

Verbandsgemeinde Altenkirchen (Westerwald)
Niederschrift 16/2009-2014, Seite 209 Verbandsgemeinde Altenkirchen (Westerwald) Niederschrift über die Sitzung des Verbandsgemeinderats Tag Mittwoch, 9. April 2014 Ort großer Ratssaal im Rathaus Altenkirchen Beginn der Sitzung 17:08 Uhr Ende der Sitzung 18:43 Uhr anwesend 1. Bürgermeister Heijo Höfer als Vorsitzender 2. Claudia Adorf 3. Matthias Augst 4. Guido Barth 5. Rainer Düngen 6. Anne von Dahl 7. Klaus Ehlgen 8. Götz Gansauer 9. Dagmar Hassel 10. Harald Hüsch 11. Horst Klein 12. Gottfried Klingler 13. Ralf Koch 14. Klaus Lauterbach 15. Bernd Lindlein 16. Stefan Löhr 17. Torsten Löhr 18. Wilhelm Meuler 19. Helmut Nestle 20. Monika Otterbach 21. Achim Ramseger 22. Jürgen Salowsky 23. Margot Sander 24. Erhard Schumacher 25. Dr. Kirsten Seelbach 26. Wilfried Stahl 27. Helmut Wagner 28. Franz Weiss (ab TOP 3) 29. Walter Wentzien 30. Klaus Zimmer (ab TOP 3) 31. Friedhelm Zöllner Beigeordnete Heinz Düber Elke Orthey Albert Pauly abwesend Frank Bettgenhäuser Christa Griffel Ulf Imhäuser Iris Kolb Jens Walterschen Dietmar Winhold Niederschrift 16/2009-2014, Seite 210 Ortsbürgermeisterinnen/Ortsbürgermeister/Ortsbeigeordnete der Ortsgemeinden anwesend 1. Altenkirchen 2. Berod 3. Birnbach 4. Fiersbach 5. Forstmehren 6. Gieleroth 7. Hasselbach 8. Helmeroth 9. Hemmelzen 10. Heupelzen 11. Hilgenroth 12. Hirz-Maulsbach 13. Ingelbach 14. Kraam 15. Michelbach 16. Neitersen 17. Oberirsen 18. Oberwambach 19. Rettersen 20. Werkhausen 21. Weyerbusch 22. Wölmersen abwesend 1. Almersbach 2. Bachenberg 3. Busenhausen 4. Eichelhardt 5. Ersfeld 6. Fluterschen 7. Helmenzen 8. Idelberg 9. Isert 10. Kettenhausen 11. Kircheib 12. Mammelzen 13. Mehren 14. Obererbach 15. Ölsen 16. Racksen 17. Schöneberg 18. Sörth 19. Stürzelbach 20. -
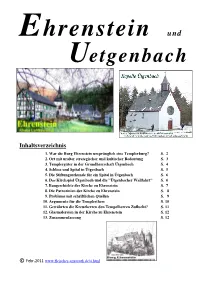
Ehrenstein.Pdf
Ehrenstein und Uetgenbach Inhaltsverzeichnis 1. War die Burg Ehrenstein ursprünglich eine Templerburg? S. 2 2. Ort mit uralter strategischer und kultischer Bedeutung S. 3 3. Templergüter in der Grundherrschaft Ütgenbach S. 4 4. Schloss und Spital in Ütgenbach S. 5 5. Die Stiftungsurkunde für ein Spital in Ütgenbach S. 6 6. Das Kirchspiel Ütgenbach und die "Ütgenbacher Wallfahrt" S. 6 7. Baugeschichte der Kirche zu Ehrenstein S. 7 8. Die Patrozinien der Kirche zu Ehrenstein S. 8 9. Probleme mit schriftlichen Quellen S. 9 10. Argumente für die Templerthese S. 10 11. Gewährten die Kreuzherren den Tempelherren Zuflucht? S. 11 12. Glasmalereien in der Kirche zu Ehrenstein S. 12 13. Zusammenfassung S. 12 © Febr.2011 www.fleischer-amteroth.de/4.html 2 Ehrenstein und Ütgenbach 1. War die Burg Ehrenstein ursprünglich eine Templerburg? Kurz vor der Mündung des Mehrbaches in die Wied steht das anmutige Kloster Ehrenstein. Es wirkt als ein Besuchermagnet im mittleren Wiedtal. Der Mehrbach umschlängelt das Kloster und bildet hier die Grenze zwischen den Verbandsgemeinden Flammersfeld und Asbach. Das Kloster heißt eigentlich Lieb- frauenthal . Ehrenstein ist der Name der Burg, 1 die sich auf der Bergnase oberhalb der Klosterkirche be- fand und von der heute nur noch gewaltige Mauerreste von ihrer einstigen Pracht Zeugnis ablegen. Über die Entstehung der Burg ist nichts bekannt. Wir wissen nur, dass sie im Jahr 1330 gestanden haben muss, als Ritter Rorich (1312-1347) von Ütgenbach nach Ehrenstein umzog und sich ab dem Jahr 1331 Herr zu Ehrenstein nannte. 2 - Eine ziemlich genaue Abbildung der einst unein- nehmbaren Burg dürfte sich auf einem Kir- chenfester in Ehrenstein befinden. -

Muehlentabelle 2005
Mühlenspuren um Altenkirchen (sortiert nach Bachläufen) Stand: Dez. 10 Wassermühlen heutiger Wissenswertes Zustand Irsener Bachtal Irsener Mühle (1) 1577 wurde die Mühle mit oberschlächtigem Wasserrad erstmals erwähnt. 1948 um eine Walzenmühle erweitert. Bis 1990 als Lieferant für Bäckereien in Betrieb, heute noch voll funktionsfähig, in Betriebnahme zu Schuzwecken möglich, Innenbesichtigung nach Absprache Ansprechpartner Herr Alois Schneider Tel. 02686/1795 F Rimbacher Mühle (2) Mühle existierte nachweisbar seit der ersten Hälfte des 14 Jahrhunderts und war H früher eine sehr bedeutende Mühle mit teilweise 2 Mahlwerken. Seelbach Thalhausener Mühle (3) Da der im Westen befindliche Talzug als "Mühlental" benannt wird kann davon ausgegangen werden, dass die Thalhausener Mühle nicht die einzige Mühle am Seelbach war. Heute befinden sich in dem Gebäude Eigentumswohnungen und nur noch die Lage weist auf einen typischen Mühlenstandort hin. S Birnbachtal Hemmelzer Mühle (4) Die Mühle, die ursprünglich am Ölfener Bach stehen sollte wurde 1714 am H Birnbach errichtet. Sie war etwa 200 Jahre in Betrieb. Ölmühle Neitersen am Kleines Modell der alten Ölmühle von Neitersen ist im Landschaftsmuseum Birnbach (5) S Hachenburg zu sehen. Wiedtal Krambergsmühle bei Die ehemalige Ölmühle wurde im 17 Jahrhundert erbaut. Winkelbach (6) H Marzauer Mühle (40) Mühle aus dem 12. Jahrhundert, ehemalige wichtige Bannmühle, noch voll funktionsfähig und heutige Nutzung zur Schrotung von Futtermittel. Wasserkraft wird zusätzlich zur Stromerzeugung (20 KW) genutzt. Besichtigung durch Gruppen nach Voranmeldung über Herrn Jung möglich (Tel: 02680/235) F Hammermühle bei Hanwerth 1707 wurde der Standort als "Hahnwerther Hammer" erwähnt. Die Bauerlaubnis (7) für diese Mühle gab es jedoch schon 1687. Im 18 Jahrhundert kam die Nutzung als Knochenmühle hinzu sowie ein zusätzlicher Ölgang. -

Zur Mineralogie Und Geologie Des Koblenzer Raumes Des Hunsrücks Und Der Osteifel
Der Aufschluß Sonderband 30 (Koblenz) Heidelberg 1980 Zur Mineralogie und Geologie des Koblenzer Raumes des Hunsrücks und der Osteifel Schriftleitung: BolkoCRUSE, Koblenz Herausgegeben von der Vereinigung der Freunde der Mineralogie und Geologie (VFMG) e. V., Heidelberg Druck: PELLENZ-DRUCKEREI - E. Badock - 5472 Plaidt V INHALT VORWORT (Bolko Cruse) VII MEYER, W.: Zur Erdgeschichte des Koblenzer Raumes 1 CRUSE, B.: Neue Haldenfunde von Corkit im Bad Emser Gangzug im Vergleich zu denen der „Grube Schöne Aussicht" bei Dernbach/Ww. 11 CRUSE, B.; KNOP, H.; RONDORF, E.; TERNES, B.: Mineralvorkommen im nördlichen Rheinland-Pfalz (mit 15 Fundortbeschreibungen und 16, teils färb., Mineralfotos) . 19 BEYER, H.: Eine Magnesium-Mineralgenese als Folge primärer biologi scher Stoffanlage und sekundärem vulkanischem Erhitzungsprozeß am Arensberg/Eifel 45 LEHNEN. O.: Einführung in die Nomenklatur und die Klassifikation der Effusivgesteine des Laacher Vulkangebietes 57 REBSKE, W.: Allgemein-vulkanische Exkursion mit Einführung in die äußere Form der Vulkane, Ergüsse, Maarbildungen, etc. des ter tiären und quartären Vulkanismus 65 KNEIDL, V.: Zur Geologie des Hunsrücks 87 WILL, V.: Haldenfunde im Hunsrückschief er 101 SIMON, W.: Erdgeschichte am Rhein - Historische Anmerkungen .... 109 VII Vorwort Die Grundlage dieses Sonderbandes bildet die Tagungsunterlage der VFMG- Sommertagung 1979 in Koblenz. Die darin enthaltenen Fundortbeschreibungen waren als Exkursionsführer gedacht. Sie stehen auch in diesem Band im Mit telpunkt. Umrahmt werden sie von Beiträgen -

Planung Vernetzter Biotopsysteme Bereich Landkreis Altenkirchen
Planung Vernetzter Biotopsysteme Bereich Landkreis Altenkirchen Impressum Planung Vernetzter Biotopsysteme Bereich Landkreis Altenkirchen Impressum Herausgeber Ministerium für Umwelt Rheinland-Pfalz, Kaiser-Friedrich-Str. 7, 55116 Mainz Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz, Amtsgerichtsplatz 1, 55276 Oppenheim Bearbeitung Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz, 55276 Oppenheim • Dr. Rüdiger Burkhardt, Erika Mirbach Faunistisch-Ökologische Arbeitsgemeinschaft, Auf der Redoute 12, 54296 Trier • Martin Schorr, Manfred Smolis, Jochen Lüttmann, Karen Minhorst, Ralf Rudolf Beiträge Gesellschaft für Naturschutz und Ornithiologie Rheinland-Pfalz e.V., Im Mühlbachtal 2, 5408 Nassau • Frank Eislöffel, Christoph Fröhlich, Markus Kunz Graphische Realisation Faunistisch-Ökologische Arbeitsgemeinschaft, Trier • Anja Hares, Wolfgang Schramm, Carla Schmitz Redaktion Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz, 55276 Oppenheim Titelfoto Dr. Jürgen Ott, c/o LAUB GmbH, 6750 Kaiserslautern Druck Grafische Betriebe Staats GmbH, Rossfeld 8, 4780 Lippstadt Auflage 1500 Drucklegung Dezember 1991 Gliederung I Gliederung Gliederung I Verzeichnis der Abbildungen und Tabellen IV A. Einleitung 1 A.1 Zielsetzung ...................................................................................................................... 1 A.2 Methode und Grundlagen................................................................................................ 4 A.3 Hinweise zur Benutzung ................................................................................................ -

Tour 3: "Zwischen Birnbach Und Mehrbach"
Tour 3: "Zwischen Birnbach und Mehrbach" Beschilderung: Die Tour ist ausgeschildert Beginn: Parkplatz am Dorfgemeinschaftshaus Hilkhausen Länge: 15 km Steigung: Der zu überwindende Höhenunterschied liegt bei unter 100 m. Beschaffenheit: Die Tour verläuft überwiegend auf geteerten landwirtschaftlichen Wegen oder verkehrsarmen Dorfverbindungsstraßen. Gastronomie in: Mehren/Adorf und Hemmelzen Wegebeschreibung: Ab Parkplatz links, "Alte Dorfstrasse", auf L276 rechts bis Heuberg, Hinweis nach Kraam folgen, bergab bis zum Mehrbach, hinter Brücke links, nach ca. 500 m links nach Mehren-Adorf abbiegen, nach Ortsende Beschilderung Richtung Giershausen folgen, L 276 queren und links nach Walterschen, hinab bis zum Birnbach, hinter Brücke links nach Hemmelzen, am Ortseingang scharf links nach Hilkhausen Besonderheiten der Tour: In Hilkhausen fahren wir in westlicher Richtung durch die „Alte Dorfstrasse“ hinauf zu Raiffeisenstrasse (L276), eine alte Höhenverbindung zwischen Weyerbusch und Flammersfeld. Links von uns liegt der Asberg, der mit seinen 333 Höhenmetern einen weiten Ausblick in die Umgebung bietet. Wir fahren ein Stück weit die stärker befahrene L 276 entlang um in Heuberg nach Kraam abzubiegen. Wer jedoch die fast kreisrunde Bergkuppe des Asberges umfahren möchte sollt noch vor dem Ort Heuberg links abbiegen. Die Wege sind hier nicht durchgehend befestigt, dennoch lohnt sich der Blick von dort über den Westerwald. Es folgt eine gemütliche Fahrt bergab, mit einem wunderschönen Blick ins Mehrbachtal. Rechts blicken wir nach Forstmehren und links können wir sogar die Kirche des Fachwerkdorfes Mehren erkennen. Im Tal angekommen blickt man unmittelbar gegenüber der Brücke auf die ehemalige Kraamer Mühle aus dem 16. Jahrhundert. Noch vor dem Abzweig nach Mehren-Adorf besteht die Möglichkeit zu einem Abstecher in das teilweise denkmalgeschützte Fachwerkdorf Mehren (von hier 500 m weiter geradeaus). -

Altenkirchen-Flammersfeld,To Urismus Und Kultur, Ansprechpartnerin: Martina Beer, Te L
Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde AK Nr. 26 • Donnerstag, 25.06.2020 • Jahrgang 1 straße ersfeld 2020 i eisen Flamm in Raiff Jun haus, 28. eisen am Raiff am garten Bauern Tag der offenen Gartentür im Saarland und in Rheinland-Pfalz Eine Aktion der Gartenbauvereine Suchen Sie Ideen für Ihren eigenen Garten? Wollten Sie schon immer mal einen Blick in den Bauerngarten am Raiffeisenhaus in Flammersfeld werfen? Am Sonntag, 28. Juni 2020 bietet sich von 10 bis 18 Uhr dazu die Gelegenheit, denn dann heißt es: „Tag der offenen Gartentür“. Weitere Informationen über die landesweite Veranstaltung finden Sie auf der Homepage: www.gartenbauvereine.de. Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld,To urismus und Kultur, Ansprechpartnerin: Martina Beer, Te l. 02681 / 85 –193. Altenkirchen-Flammersfeld 2 Donnerstag, 25.06.2020 Fotos: ABBA - Heinz-Günter Augst, Rottund StillCollins - Maria Walter,Hachenburg Altenkirchen-Flammersfeld 3 Donnerstag, 25.06.2020 Das aktuelle Programm auf der Homepage www.waeller-autokino.de oder über den QR-Code! Fotos: ABBA - Heinz-Günter Augst, Rott und Still Collins - Maria Walter,Hachenburg Altenkirchen-Flammersfeld 4 Donnerstag, 25.06.2020 Stadführer/in gesucht! Die Geschichte der Kreisstadt Altenkirchen wird erlebbar In der Kreisstadt Altenkirchen die Geschichte unserer Stadt daran, anderen unsere Stadt erlebbar zu machen? Dann sind lebendig werden zu lassen ist eine besondere, aber auch Sie die richtige Person! Die praktische und theoretische Ein- sehr schöne Sache. Darüber berichteten die Stadführer Gün- arbeitung in die Geschichte der Stadt wird gemeinsam vom ter Imhäuser, Stefan Fürst und die kürzlich verabschiedete bewährten Team und den Mitarbeitenden des Historischen Stadtführerin Doris Enders, gemeinsam mit Ulrich Stope für Quartiers begleitet. -

Bundesamt Für Verbraucherschutz Und Lebensmittelsicherheit Bekanntmachung Nr
elektronischer Bundesanzeiger Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit Bekanntmachung Nr. 09/01/004 über die zugelassenen und/oder registrierten Futtermittelunternehmer sowie Bekanntmachung des Verzeichnisses der Kommission gemäß Artikel 19 Absatz 6 der Verordnung (EG) Nr. 183/2005 (Stand: 28. Januar 2009) Bekanntmachungstext in www.ebundesanzeiger.de Bekanntmachungstext im Elektronischen Bundesanzeiger – – Seite 1 von 350 – Nichtamtlicher Hinweis der Bundesanzeiger Verlagsges.mbH: Auftraggeber der Veröffentlichung: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit Erlassdatum: 26. März 2009 Fundstelle: eBAnz AT76 2009 B1 – veröffentlicht am 30. Juli 2009 – Quelle: elektronischer Bundesanzeiger elektronischer Bundesanzeiger Anhang 10 Land Rheinland-Pfalz Verzeichnis der zugelassenen und/oder registrierten Futtermittelunternehmer des Landes Rheinland-Pfalz Zulassungs- Name oder Firmenbezeichnung Ortsteil, Straße Nr. PLZ Stadt/Großgemeinde Land Tätigkeit Überwachungs- kennnummer behörde 1 2 3 4 5 6 7 8 Elisabeth Arnoldy Trierer Straße 14 54298 Aach RP A 07 01 Horst Feiler Beßlicher Straße 13 54298 Aach RP A 07 01 Arno Reh Kapellenstraße 2 54298 Aach-Hohensonne RP A 07 01 Willi Neumann Aacherstraße 10 54298 Aach-Hohensonne RP A 07 01 Harald Thiel Boeckingstraße 2 55767 Abentheuer RP A 07 01 Horst Antes Dellstraße 5 55767 Abentheuer RP A 07 01 Andreas Mohr St.Antoniushof 2 55568 Abtweiler RP A 07 01 Bernhard Heinrich Doerr Huehnerhof 3b 55568 Abtweiler RP A 07 01 Heiko Bachmann Huehnerhof 6 55568 Abtweiler RP A 07 01 Martin Schneider Hühnerhof 9 55568 Abtweiler RP A 07 01 Peter Landfried St.Antoniushof 1a 55568 Abtweiler RP A 07 01 Peter Michel Hauptstr 37 55568 Abtweiler RP A 07 01 Schappert GbR St Antoniushof 6 55568 Abtweiler RP A 07 01 Bekanntmachungstext in www.ebundesanzeiger.de Wolfgang Rockenfeller St. -

Rheinland-Pfalz
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz Jahr/Year: 2000-2002 Band/Volume: 9 Autor(en)/Author(s): Mückschel Claus, Dierichs Monika Artikel/Article: Zum Vorkommen von bemerkenswertem sowie seltenen und gefährdeten Pflanzenarten im Kreis Neuwied (Rheinland-Pfalz) 425- 446 Mückschel und Dierichs: Bemerkenswerte Pflanzenarten im Kreis Neuwied 425 Fauna Flora Rheinland-Pfalz 9: Heft 2 (2000): S.425-446. Landau Zum Vorkommen von bemerkenswertem sowie seltenen und gefährdeten Pflanzenarten im Kreis Neuwied (Rheinland-Pfalz) von Claus Mückschel und Monika Dierichs Inhaltsübersicht Kurzfassung Abstract 1. Einleitung 2. Untersuchungsgebiet 3. Fundortangaben, Karten und Erläuterungen 4. Zusammenfassung und Schlußfolgerungen 5. Literatur Kurzfassung Es wird über floristische Beobachtungen von Pflanzenarten im Kreis Neuwied (Rheinland-Pfalz) berichtet. Hierzu sind zahlreiche Neuentdeckungen, Wiederfunde sowie bemerkenswerte Veränderungen im Gebiet zusammengestellt worden. Die Vor kommen - ein Schwerpunkt liegt auf den Arten der bachbegleitenden Auen - werden auf der Basis von 1/16 Meßtischblatt angegeben. Zusätzlich wird auf einige wichtige floristische Arbeiten, die während der letzten Jahre veröffentlicht wurden, hingewiesen. Abstract Occurences of remarkable as well as rare and threatened plant species in the district Neuwied (Rhineland-Palatinate) This article deals with observations of plant species in the district Neuwied (Rhineland- Palatinate). Numerous recent discoveries, refinds, as well as remarkable changes of the vegetation of the area, are listed. An emphasis is laid on the species living alongside ri vers and is listed on the basis of 1/16 ordnance survey map. In addition, several important articles on the subject are mentioned which have been published during the past years. -

Flammersfeld (Ost-West)
Prädikats-Fernwanderweg Westerwald-Steig 12. Etappe Weyerbusch - Flammersfeld (Ost-West) Gütesiegel STANDARD Länge 14,9 km Schwierigkeit mittel Bewertungen (0) Höhenmeter 291 m Kondition Erlebnis 344 m Technik Landschaft Dauer 3:42 h Empfohlene Jahreszeiten J F M A M J J A S O N D outdooractive Kartografie, Deutschland: Geoinformationen © Vermessungsverwaltungen der Bundesländer und BKG (www.bkg.bund.de), Österreich: 1996-2012 NAVTEQ. All rights reserved., Italien: © 1994-2012 NAVTEQ. All rights reserved., Schweiz: Geodata swisstopo (5704002735) 1 Prädikats-Fernwanderweg Westerwald-Steig 12. Etappe Weyerbusch - Flammersfeld (Ost-West) Wegeart Asphalt 2.4 km Weg 11.4 km Pfad 1.1 km Beschreibung mit schönen Fachwerkhäusern und Bauerngärten. Durch einen Wald wie aus dem Märchen erreicht Kurzbeschreibung man, vorbei am Sportplatz, Flammersfeld. Wir Durch das Raiffeisenland führt die Tour von umgehen den Ort im Westen, unterqueren die B256 Weyerbusch ins romantische Fachwerkdorf Mehren und kommen durch Wiesen zum Zielpunkt der im Mehrbachtal und über Ahlbach mit schönen Etappe und haben von dort nur noch eine kurze Gärten nach Flammersfeld. Strecke über einen Zuweg bis zur Ortsmitte. Beschreibung Alternativ ist diese auch vom westlichen Ortsrand über einen Zuweg erreichbar (Schleife durch Weyerbusch wurde besonders bekannt durch Flammersfeld). In der Ortsmitte finden wir das Friedrich Wilhelm Raiffeisen, der hier im Jahre 1845 Raiffeisenmuseum, das ca. 250 Jahre alte als Amtsbürgermeister eingesetzt wurde. Im Bürgermeisterhaus. Es zeigt, wie zu Raiffeisens Hungerwinter 1846/47 schuf er den Weyerbuscher Zeiten gearbeitet und gelebt wurde. Brodverein und begründete damit das Genossenschaftswesen. Um die Gemeindebewohner Zuwege (Markierung: grünes W auf gelbem während dieser schwierigen Zeit mit billigem Brot Grund): zu versorgen, ließ er ein Backhaus errichten und bot vom Waldrand östlich Kescheid nach Kehscheid (ca. -

Drucksache 17/7001
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 17/ 17.Wahlperiode 7001 14. 08. 2018 Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD, CDU, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Landesgesetz über den Zusammenschluss der Verbandsgemeinden Altenkirchen (Westerwald) und Flammersfeld A. Problem und Regelungsbedürfnis Im Zuge der Kommunal- und Verwaltungsreform sollen die Gebiets- und Verwal- tungsstrukturen auf der Ebene der ver-bandsfreien Gemeinden und Verbandsge- meinden optimiert werden. Ziel ist eine weitere Steigerung der Leistungsfähigkeit, Wettbewerbsfähigkeit und Ver- waltungskraft von verbandsfreien Gemeinden und Verbandsgemeinden. Eine Optimierung kommunaler Gebietsstrukturen soll durch Gebietsänderungen er- reicht werden. Bis zum 30. Juni 2012 ist eine Freiwilligkeitsphase angesetzt gewesen. In der für die Kommunen mit vielfältigen Vorteilen verbundenen Freiwilligkeitsphase haben ver- bandsfreie Gemeinden und Verbandsgemeinden selbst Gebietsänderungen auf den Weg bringen können. Für die Verbandsgemeinde Flammersfeld besteht nach Maßgabe des Landesgesetzes über die Grundsätze der Kommunal- und Verwaltungsreform vom 28. September 2010 (GVBl. S. 272, BS 2020-7) ein eigener Gebietsänderungsbedarf. Die Verbandsgemeinden Altenkirchen (Westerwald) und Flammersfeld streben die Bildung einer neuen Verbandsge-meinde zum 1. Januar 2020 an. Sie haben im Hinblick auf diese Gebietsänderungsmaßnahme intensive Verhandlungen miteinander geführt. Die Verhandlungsergebnisse enthält eine vom Bürgermeister der Verbandsgemeinde Altenkirchen (Westerwald) und vom Ersten Beigeordneten -

Verbandsgemeinde Altenkirchen (Westerwald)
Niederschrift 10/2014-2019, Seite 126 Verbandsgemeinde Altenkirchen (Westerwald) Niederschrift über die Sitzung des Verbandsgemeinderats Tag Dienstag, 4. Oktober 2016 Ort großer Ratssaal im Rathaus Altenkirchen Beginn der Sitzung 17:02 Uhr Ende der Sitzung 19:15 Uhr anwesend 1. Bürgermeister Heijo Höfer als Vorsitzender zu TOP 1 bis 4.2 und 5 bis 13 2. Guido Barth 3. Frank Bettgenhäuser 4. Christian Chahem 5. Ellen Creutzburg, anwesend bis 19:07 Uhr, TOP 11 6. Klaus Ehlgen 7. Jörg Gerharz 8. Regina Härtel 9. Dagmar Hassel 10. Harald Hüsch 11. Ulf Imhäuser 12. Horst Klein 13. Susanne Kramer 14. Jürgen Kugelmeier 15. Wolfgang Lanvermann 16. Kevin Lenz 17. Bernd Lindlein 18. Stefan Löhr, anwesend bis 19:07 Uhr, TOP 11 19. Torsten Löhr 20. Wilhelm Meuler 21. Winfried Oster 22. Monika Otterbach 23. Helma Radermacher 24. Achim Ramseger 25. Jürgen Salowsky 26. Margot Sander 27. Erhard Schumacher 28. Ralf Schwarzbach 29. Dr. Kirsten Seelbach 30. Markus Trepper 31. Helmut Wagner 32. Franz Weiss, als Vorsitzender zu TOP 4.3 33. Dietmar Winhold 34. Klaus Zimmer Beigeordnete Erster Beigeordneter Heinz Düber, anwesend ab TOP 2 Beigeordneter Wilfried Stahl abwesend Beigeordnete Elke Orthey Rainer Düngen Christa Griffel Klaus Lauterbach Niederschrift 10/2014-2019, Seite 127 Ortsbürgermeisterinnen/Ortsbürgermeister/Ortsbeigeordnete/Ortsvorsteher der Ortsge- meinden anwesend 1. Altenkirchen 2. Bachenberg 3. Berod 4. Birnbach 5. Fiersbach 6. Fluterschen 7. Gieleroth 8. Hasselbach 9. Hilgenroth 10. Ingelbach 11. Neitersen 12. Oberirsen 13. Oberwambach 14. Rettersen 15. Stürzelbach 16. Werkhausen 17. Weyerbusch 18. Weyerbusch-Hilkhausen abwesend 1. Almersbach 2. Busenhausen 3. Eichelhardt 4. Ersfeld 5. Forstmehren 6.